in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 traten sie vor das Theaterpublikum und erzählten, unterstützt von Ensemblemitgliedern der Burg. Bis auf den großen "Stadttempel" in der Seitenstettengasse gingen damals alle Bethäuser und Synagogen sowie zahlreiche jüdische Geschäfte in Flammen auf, wurden verwüstet oder in die Luft gejagt.
Doch schon am 11. März jenes Jahres, einen Tag bevor deutsche Truppen in den austrofaschistischen Ständestaat einmarschierten, ja noch bevor am Abend dieses Freitags Bundeskanzler Schuschnigg seinen Rücktritt erklärte und die österreichischen Truppen aufforderte, die Nachbararmee ohne Gegenwehr einrücken zu lassen, zog die Polizei bereits mit Hakenkreuzarmbinden auf, gab es in jeder Straße Wiens junge Männer in SA-Uniformierung. Juden wurden gezwungen, die Straßen mit Scheuerbürsten, oft auch nur Zahnbürsten, und mit die Hände verätzenden Chemikalien von Parolen für eine noch von Schuschnigg geplante Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Österreichs zu säubern. Am Samstag, als die Deutschen in Wien einzogen, von vielen lautstark bejubelt, begannen sofort Enteignungen, die erst von den neuen Machthabern unterbunden wurden. Freilich nicht aus moralischen Beweggründen, vielmehr sollte alles geregelt ablaufen.
Auch Großtante Käthe wurde für längere Zeit inhaftiert, um die Überschreibung ihres nicht unbeträchtlichen Vermögens zu erpressen. Akribisch schildert Tim Bonyhady, Historiker und Direktor des australischen Centre for Climate Law and Policy, was er über dieses Kapitel seiner Familiengeschichte in jahrelanger Recherche herausfand. Die Familien Gallia und Hamburger, jene Vorfahren, auf die sich Bonyhady hauptsächlich bezieht, zählten durch die für einen Großteil von ihnen geglückte Emigration zu den Privilegierten. Zuvor waren sie binnen einer Generation zu beachtlichem Reichtum und Ansehen gelangt. Vor allem nach dem Ende des Deutschen Bundes 1866 und der österreichischen Niederlage gegen Preußen musste sich die Monarchie um Unterstützung im Inneren bemühen. Im Dezember 1867 wurde ein Staatsgrundgesetz, das Bürgerrechte, unter anderem die freie Wohnsitzwahl für alle Bürger Österreichs (nicht Ungarns) gestattete, erlassen.
Moriz Gallia brachte es durch Geschäftstüchtigkeit und unternehmerisches Risiko zu Wohlstand. Zusammen mit seiner Ehefrau Hermine, geborene Hamburger, zählte er zu den Förderern der blühenden Wiener Kunstszene im Fin de Siècle. Gustav Klimt porträtierte Hermine, Josef Hoffmann richtete den neu erbauten Familiensitz in der Wohllebengasse ein, der Bonyhadys Buch den Titel lieh, und in der Wiener Werkstätte, deren Teilhaber und später Vorstandsmitglied Moriz Gallia wurde, kaufte man allerlei Nippes wie Tintenfässchen, Aschenbecher oder Essbesteck. Der Sohn Erni diente als Offizier im Ersten Weltkrieg, die älteste Tochter Gretl, Bonyhadys Großmutter, rebellierte gegen die ihr zugedachte Rolle als Hausfrau durch eine eilige Hochzeit und baldige Trennung. Die Zwillingstöchter Käthe und Lene gehörten zu den ersten Frauen, die in Wien als Chemikerinnen promoviert wurden.
Das Familienvermögen überstand das Ende der Monarchie und die folgende Währungskrise ziemlich unbeschadet. In religiösen Dingen war die Familie gespalten. Einige ließen sich katholisch taufen, andere blieben dem jüdischen Glauben treu, manche bekannten sich zu gar keiner Religion, irgendwelche Onkel und Tanten waren protestantisch, einige, etwa Bonyhadys Mutter Anne, wechselten gleich mehrfach das Bekenntnis. Freilich nutzte das alles nichts, als auch auf sie die verbrecherischen Nürnberger Rassegesetze angewandt wurden.
Für Österreicher sollten das keine neuen Erkenntnisse sein. Für den in Australien geborenen Tim Bonyhady war das alles aber wohl unbekannt, erschreckend, ungeheuer aufregend und berührend. Ausgehend von den wenigen erhaltenen, aber offenbar sehr ausführlichen Tagebüchern seiner Großmutter und angespornt durch die zahlreichen in die neue Heimat mitgenommenen Einrichtungsgegenstände - in der Wohnung in Cremorne, einem Vorort Sydneys, lebte es sich wie in einem zu engen Museum, schreibt er -, rekonstruiert er die Geschichte der Familie. Seine 2003 gestorbene Mutter hatte ihm mit ihren Erinnerungen geholfen, wenn auch anfangs nur zögerlich.
Das starke Eigeninteresse, soll heißen: die persönliche Betroffenheit, ist vermutlich auch die Erklärung für einige nur schwer erträgliche Längen des Buches, das zudem sehr an den ungleich gelungeneren Roman "Der Hase mit den Bernsteinaugen" von Edmund de Waal erinnert. Absatzweise werden da frühere Besitztümer bis hin zu Teegeschirr aufgezählt, Details aus den Geschäften des Urgroßvaters wiedergegeben, werden wenig interessante, weil letztendlich ins Nichts führende Schwärmereien und Beschreibungen von Tanzabenden aus den Aufzeichnungen der Großmutter Gretl ausgebreitet. Aber - und das ist ein gewichtiges "Aber" - die entscheidenden Kapitel sind spannender als mancher Kriminalroman. Das betrifft nicht nur die Schilderung der Vorbereitung zur Emigration nach Australien, sondern auch das Einleben in der neuen Heimat und nicht zuletzt den Blick auf die alte Heimat Wien.
Ein Glanzstück an durch Understatement ausgezeichnete tiefste Abneigung bildet etwa die Episode um die Bemühungen des 2010 verstorbenen Sammlers Rudolf Leopold, weit unter Wert an einige Gemälde der Familie zu gelangen. Man darf annehmen, dass Tim Bonyhady als Jurist weiß, wie weit hier er gehen konnte, ohne eine Klage wegen übler Nachrede zu provozieren. Schon allein dafür lohnt sich die Lektüre dieses in der zweiten Hälfte gar nicht mehr sperrigen Werks.
MARTIN LHOTZKY
Tim Bonyhady: "Wohllebengasse". Die Geschichte meiner Wiener Familie. Aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2013. 448 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
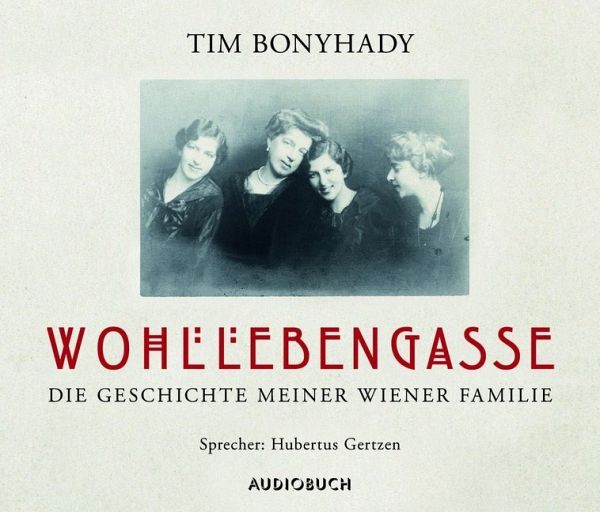





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.11.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.11.2013