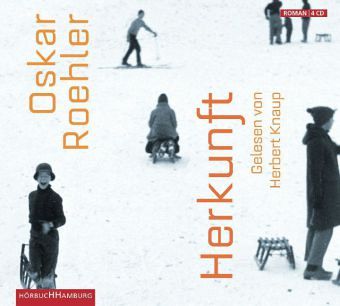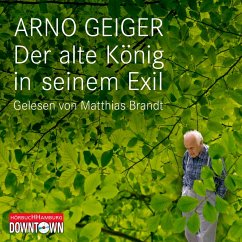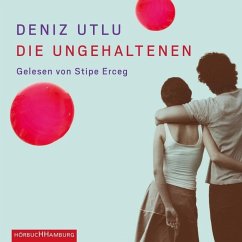Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





'Eine Familie, drei Generationen, die Geschichte der Bundesrepublik: Robert Freytags Großvater Erich, der Kriegsheimkehrer, der seine Frau an eine andere Frau verliert. Roberts Eltern, die Schriftsteller Nora und Rolf, die sich in einer Amour Fou zerfleischen und über ihrem Streben nach Selbstverwirklichung und freier Liebe zugrunde gehen. Robert selbst, der zwischen der Geborgenheit im Haus seiner Großeltern und dem enthemmten Leben der 68er aufwächst, immer auf der Suche nach dem eigenen Glück, das so schwer zu finden ist. Oskar Roehlers Roman ist die Geschichte einer Familie und zuglei...
'Eine Familie, drei Generationen, die Geschichte der Bundesrepublik: Robert Freytags Großvater Erich, der Kriegsheimkehrer, der seine Frau an eine andere Frau verliert. Roberts Eltern, die Schriftsteller Nora und Rolf, die sich in einer Amour Fou zerfleischen und über ihrem Streben nach Selbstverwirklichung und freier Liebe zugrunde gehen. Robert selbst, der zwischen der Geborgenheit im Haus seiner Großeltern und dem enthemmten Leben der 68er aufwächst, immer auf der Suche nach dem eigenen Glück, das so schwer zu finden ist. Oskar Roehlers Roman ist die Geschichte einer Familie und zugleich ein sehr persönliches Zeitdokument von großer poetischer Kraft.
Oskar Roehler wurde 1959 als Sohn der Schriftstellerin Gisela Elsner und des Schriftstellers und Verlagslektors Klaus Roehler geboren. Er wuchs in London, Rom und Nürnberg auf. Seit Anfang der 80er Jahre lebt Roehler in Berlin, arbeitete zunächst als freier Journalist und Autor. 1984 erschien bei Luchterhand der Erzählband "Das Abschnappuniversum". Seine Filmkarriere begann Oskar Roehler als Drehbuch-Autor. Er drehte u.a. die Filme "Silvester Countdown", "Gierig", "Latin Lover" und nach "Die Unberührbare" "Suck my Dick".
Produktdetails
- Verlag: Hörbuch Hamburg
- Gesamtlaufzeit: 289 Min.
- Erscheinungstermin: 14. September 2011
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783899030372
- Artikelnr.: 33472333
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.09.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.09.2011Das Logbuch des Entkommenseins
Oskar Roehler, gefürchtet als Filmregisseur, hat einen Roman geschrieben: "Herkunft", ein Wagnis, ein Wahnsinn
Gerechtigkeit ist kein Programm. Nicht, wenn jemand einen Roman schreibt, der von den eigenen Eltern handelt. Und schon gar nicht, wenn diese Eltern so waren wie die von Oskar Roehler, 52, Autor und Regisseur von Filmen wie "Die Unberührbare", "Jud Süß - Film ohne Gewissen" oder "Elementarteilchen". Die Mutter, die Schriftstellerin Gisela Elsner, setzte sich ab, als er drei war, der Vater, der Lektor und Autor Klaus Roehler, vernachlässigte den Sohn, wenn er glaubte, sich um ihn kümmern zu sollen; die Großeltern kümmerten sich, so gut es eben ging, weil sie glaubten, ihn
Oskar Roehler, gefürchtet als Filmregisseur, hat einen Roman geschrieben: "Herkunft", ein Wagnis, ein Wahnsinn
Gerechtigkeit ist kein Programm. Nicht, wenn jemand einen Roman schreibt, der von den eigenen Eltern handelt. Und schon gar nicht, wenn diese Eltern so waren wie die von Oskar Roehler, 52, Autor und Regisseur von Filmen wie "Die Unberührbare", "Jud Süß - Film ohne Gewissen" oder "Elementarteilchen". Die Mutter, die Schriftstellerin Gisela Elsner, setzte sich ab, als er drei war, der Vater, der Lektor und Autor Klaus Roehler, vernachlässigte den Sohn, wenn er glaubte, sich um ihn kümmern zu sollen; die Großeltern kümmerten sich, so gut es eben ging, weil sie glaubten, ihn
Mehr anzeigen
nicht vernachlässigen zu sollen.
Gerechtigkeit ist der Tod aller Prosa, die aufs Ganze geht, in der einer etwas über sich selbst erfahren will, indem er eine, seine Geschichte erzählt und sie, so schlicht wie bestimmt, "Herkunft" nennt. Natürlich muss man dann auch fragen, ob es ein autobiographisches Buch sei. Roehler hat die Frage längst auf seine Weise beantwortet: "Zu 28,75 Prozent", hat er dem "Kölner Stadtanzeiger" gesagt.
Auf dem Buchumschlag steht "Roman", und hinten findet sich die rituelle Formel: "Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden und realen Personen wäre rein zufällig." Das ist schon okay. Fiktion und Wirklichkeit sind ja längst verschmolzen. Wer, nur zum Beispiel, in einer Suchmaschine nach Bildern von Roehlers Mutter Gisela Elsner schaut, der wird zuerst Hannelore Elsner sehen, die in der "Unberührbaren" jene Schriftstellerin spielt, die Roehlers Mutter nachempfunden ist, mit Kleopatra-Perücke und mächtigen Kajal-Balken.
"Ich musste einiges abarbeiten", hat Roehler in einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" vor zwei Jahren gesagt. Er hat damit öffentlich schon vor mehr als elf Jahren angefangen, als er "Die Unberührbare" drehte, eine Fiktion, deren Rohstoff die letzten Tage im Leben seiner Mutter waren, die sich 1992 aus dem Fenster einer Psychiatrischen Klinik in München stürzte. Damals hieß diese Mutter Hanna und der Vater Bruno, jetzt heißen die Eltern Nora und Rolf, im Film hieß der Sohn Viktor, im Roman heißt er Robert, aber schon der Name Oskar ist ja einem Roman entliehen, der "Blechtrommel", weil Roehlers Vater zeitweise Lektor von Grass war.
Gewidmet hatte Roehler den Film seinem Vater, der 2000 verstarb. Der Roman ist niemandem gewidmet, und es mag sein, dass Roman wie Film auch eine spezielle Form von Psychotherapie sind, für die es keine Methode gibt und keine Erfolgskontrolle. Die entscheidende Frage ist, ob es ein gutes Buch ist. Und es ist nicht nur gut, es ist stark, es berührt, erschüttert, es klingt mal wie ein Aufschrei, mal wirkt es wie eine Vivisektion, es hat etwas Befreiendes, und es hat eine Sprache, die für all diese gefährlich schwankenden Gemütszustände den Ton und die Bilder findet.
"Herkunft" beginnt im Jahr 1949, in der pränatalen Welt des Erzählers. Ein Stück Familienarchäologie, eine Etappe in der Geschichte dieser Republik. Ein Blick voller Neugier und auch Empathie, auf den Großvater, den Kriegsheimkehrer, den Gartenzwergfabrikanten; auf den Vater, auf dessen Schriftstellerträume. Roehler hat die Orte der Vergangenheit noch mal bereist, die Briefe der Eltern gelesen, die 2001 unter dem Titel "Wespen im Schnee" erschienen sind. Er hat sich vorgestellt, was war - und was hätte sein können. In glühenden Sätzen und in eisigen Beobachtungen, mal von Melancholie durchzogen, mal von unbändiger Lebensgier.
Von Anfang an ist der Ich-Erzähler da, aber er tritt zur Seite, fast zweihundert Seiten lang, in denen es um Großeltern und Eltern geht; wie Nora und Rolf einander kennenlernten, nach Luft ringend in den erstickenden Mittfünfzigern, in Nürnberg und im fränkischen Stein, am Fuße eines Bergs, der Walberla heißt. Aber es ist eben auch eine Suche nach sich selbst, nach dem irreversiblen Moment, in dem die Verliebtheit umschlug in eine amour fou. "Hier hätte mein Vater Rolf Freytag noch einmal die Gelegenheit gehabt, seinem Leben eine Wendung zu geben. Er tat es nicht." Und so kommt der Erzähler zur Welt, das Kind, das die Mutter nicht wollte, das sie, im Roman, dem Vater unterschob, was sie dem Sohn später, an einem Abend im "Hofbräuhaus", als sie politisch, literarisch längst gescheitert war, erzählen musste, unbedingt. Und dagegen steht die Erinnerung des Dreijährigen, "wie meine Mutter vorher im Fahrstuhl geisterhaft verschwunden war, einfach so, ohne etwas zu sagen, ein dunkles Mysterium meiner Kindheit. Ich habe sie seither nie wieder als meine Mutter gesehen."
Das Kind Robert wird nach der Scheidung abgestellt bei den Großeltern väterlicherseits, aber auch gerettet, es geht für kurze Zeit auf in dem, was ihm später als fränkische Idylle erscheint: "Man pilgerte nach Hause und fraß, was nur ging. Viele Jahre später wird dem Erzähler dieses Leben ungeheuer dicht, ungeheuer gleißend und verheißungsvoll vorkommen. Näher wird er sich vielleicht nie mehr gekommen sein." Dann holt der Vater ihn zu sich, nach Berlin, Robert wird zum Schlüsselkind, das sich herumtreibt, verwahrlost, weil der Vater Frauen aufreißt, zecht, den Siebenjährigen durch den Friedenauer Literaturbetrieb der mittleren Sechziger schleift. Ein Kind, das immer mit dem Gespenst der Trennung lebt: "Schemenhaft wirkten nun die Beteuerungen, dass das, was geschah, nur das Beste für uns sei. In ein trügerisches Licht geriet allmählich jede vertrauenerweckende Geste von früher, jedes Lächeln, jedes sanfte Streicheln des Kopfes, jedes Abendbrot, jeder Spaziergang."
Die Eltern der Mutter holen ihn aus dem Berliner Sumpf, in die Nürnberger Villa mit dem nierenförmigen Pool, der scheiternden Schwester, der Migräne der Großmutter. Er wird ins Internat geschickt, das der Vater, längst zum "Phantom" geworden, nicht bezahlen will. Es ist ein einziges Hin- und Hergeschobenwerden, ein Umherirren, aus dem der Wunsch nach Symbiose, nach Zugehörigkeit erwächst, die er in den Nachbarsfamilien sucht. Und die er bei Laura findet, der Nachbarstochter in Stein: "Ich erwartete nichts von ihr, außer dass sie immer für mich da war."
Roehlers Blick ist so genau und scharf, dass er unbarmherzig erscheinen könnte, wenn er die Aufsteiger-Spießer-Hölle beschreibt, die Anfälle von Zerstörungswut schildert, die Rachewünsche grell ausleuchtet. Aber es ist eher ein Aushalten, die Entschlossenheit, sich nicht abzuwenden. Seine Augen, könnte man sagen, bleiben trocken, ohne die Tränen des Selbstmitleids, die den Blick verschleiern würden. So kommt das Monströse zum Vorschein, das Obszöne, das Abseitige, Peinliche, Schamvolle, das immer auch in Roehlers Filmen war - wie ein fernes Echo aus den Romanen der Mutter, deren Spießbürger-Satire "Die Riesenzwerge" (1964) sie zum frühen Fräuleinwunder des Literaturbetriebs machte. "Ich musste irgendwann aus mir hinaus und in der Welt einen Graben ausheben, tief genug, meine Eltern für immer verschwinden zu lassen, eine Schlucht."
"Herkunft" ist ein Logbuch des Entkommenseins: der Urszene, den endlosen Streitereien, den familiären Verwerfungen, der eigenen Ohnmacht, dem Umstand, dass Robert Mitte der siebziger Jahre in Berlin "vorübergehend der Drogendealer meiner Mutter (wurde). Ich schickte ihr billiges, polnisches Speed in Reclam-Heftchen, in die ich vorher mit der Rasierklinge Löcher geschnitten hatte." Selbst wenn nur diese 28,75 Prozent von alldem autobiographisch wären, kommt es einem beim Lesen wie ein mittleres Wunder vor, dass Oskar Roehler heute eine bürgerliche Existenz führt, dass er, durchs Kino und die Literatur, einen Weg gefunden hat, sich dem Strudel dieser "Herkunft" zu entziehen.
Gegen Ende von "Herkunft" klingen manche Sätze schon kathartisch: "Ich würde die Teile auflesen, ausgraben auf meiner langen Wanderung. Und eines Tages zusammensetzen." Und es ist dann eine so großartige wie großzügige Idee, wenn sich das Erzähler-Ich schließlich ganz leise aus seiner Geschichte davonstiehlt. Der Epilog gehört Lauras Mutter, und Laura, sie ist der wunde Punkt, die Kindheits- und Jugendliebe, die sich nicht in die Erwachsenenwelt hat retten lassen; sie ist so unvergessen wie unerreichbar in die Vergangenheit gefallen. "Doch dieses vor Glück strahlende Lächeln des jungen Mädchens, das voller Zuversicht und Hoffnung auf ihre große Liebe blickt, würde nie wieder auf das Gesicht ihres Kindes zurückkehren" - das ist der letzte Satz des Buches, und er trifft einen Ton, der sehr lange nachhallt.
Inzwischen heißt "Herkunft" auch "Die Quellen des Lebens", ist zum Drehbuch geworden, das zurzeit in Köln zum Film wird, mit Jürgen Vogel, Meret Becker, Moritz Bleibtreu und vielen anderen. Von einem solchen epischen Projekt, das mehr als drei Jahrzehnte Bundesrepublik umspannt, habe er schon lange geträumt, sagt Stefan Arndt, der das Neun-Millionen-Euro-Projekt für X-Filme produziert: als einen langen Kinofilm, aus dem anschließend ein Zweiteiler für ARD und Arte werden wird. Im Moment, sagt Arndt, 50, gebe es für seine Generation jeden Tag so peinigende wie erhellende Zusammenstöße mit der Vergangenheit, mit Schlaghosen und Plateausohlen, mit "Morning Has Broken" und "I'd Love You to Want Me", mit dem Klammerblues von damals, mit all den Dingen, an die nicht nur Arndt zuletzt Ende der siebziger Jahre gedacht hat.
Doch erst einmal ist da dieser Roman, der vielen deutschen Schriftstellern höllische Angst einjagen müsste - wenn Oskar Roehler nicht beschlossen hätte, weiter Filme zu machen, anstatt den Literaturbetrieb aufzumischen. In all seinen Unebenheiten hat dieser Roman eine ungeheure Wucht. Er schenkt einem das Vertrauen wieder, dass sich mit der Kraft der Sprache nicht nur ein Bild der eigenen Lebensgeschichte entwerfen lässt, in dem man sich mit Schrecken und mit Erleichterung wiedererkennt; sondern dass in diesem Bild auch wie von selbst das Porträt einer Generation durchschimmern kann.
Ein Buch, das die Welt zeigt, über die 1968 hereinbrach, und das zugleich die Karikatur, in die das Selbstverwirklichungsideal der 68er sich verwandelte, am Beispiel einer Jugend schmerzlich erfahrbar macht. Es ist ein Roman, der keinen faulen Frieden sucht mit den 68er-Eltern, der aber auch nicht dem selbstgerechten Furor verfällt, mit dem die 68er die Generation ihrer Eltern tribunalisierten. Er ist voller Schmerz, Leidenschaft und Trauer, voller Vitalität, pubertärer Todessehnsucht und trotzigem Überlebenswillen - weil er unbeirrbar dorthin geht, wo es weh tut. "Herkunft" ist ein Roman, den jeder gelesen haben muss, der wissen will, wie wir Kinder der späten fünfziger Jahre zu denen wurden, die wir heute sind.
PETER KÖRTE
Oskar Roehler: "Herkunft". Roman. Ullstein, 585 Seiten, 19,99 Euro. Erscheint am 14. September.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Gerechtigkeit ist der Tod aller Prosa, die aufs Ganze geht, in der einer etwas über sich selbst erfahren will, indem er eine, seine Geschichte erzählt und sie, so schlicht wie bestimmt, "Herkunft" nennt. Natürlich muss man dann auch fragen, ob es ein autobiographisches Buch sei. Roehler hat die Frage längst auf seine Weise beantwortet: "Zu 28,75 Prozent", hat er dem "Kölner Stadtanzeiger" gesagt.
Auf dem Buchumschlag steht "Roman", und hinten findet sich die rituelle Formel: "Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden und realen Personen wäre rein zufällig." Das ist schon okay. Fiktion und Wirklichkeit sind ja längst verschmolzen. Wer, nur zum Beispiel, in einer Suchmaschine nach Bildern von Roehlers Mutter Gisela Elsner schaut, der wird zuerst Hannelore Elsner sehen, die in der "Unberührbaren" jene Schriftstellerin spielt, die Roehlers Mutter nachempfunden ist, mit Kleopatra-Perücke und mächtigen Kajal-Balken.
"Ich musste einiges abarbeiten", hat Roehler in einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" vor zwei Jahren gesagt. Er hat damit öffentlich schon vor mehr als elf Jahren angefangen, als er "Die Unberührbare" drehte, eine Fiktion, deren Rohstoff die letzten Tage im Leben seiner Mutter waren, die sich 1992 aus dem Fenster einer Psychiatrischen Klinik in München stürzte. Damals hieß diese Mutter Hanna und der Vater Bruno, jetzt heißen die Eltern Nora und Rolf, im Film hieß der Sohn Viktor, im Roman heißt er Robert, aber schon der Name Oskar ist ja einem Roman entliehen, der "Blechtrommel", weil Roehlers Vater zeitweise Lektor von Grass war.
Gewidmet hatte Roehler den Film seinem Vater, der 2000 verstarb. Der Roman ist niemandem gewidmet, und es mag sein, dass Roman wie Film auch eine spezielle Form von Psychotherapie sind, für die es keine Methode gibt und keine Erfolgskontrolle. Die entscheidende Frage ist, ob es ein gutes Buch ist. Und es ist nicht nur gut, es ist stark, es berührt, erschüttert, es klingt mal wie ein Aufschrei, mal wirkt es wie eine Vivisektion, es hat etwas Befreiendes, und es hat eine Sprache, die für all diese gefährlich schwankenden Gemütszustände den Ton und die Bilder findet.
"Herkunft" beginnt im Jahr 1949, in der pränatalen Welt des Erzählers. Ein Stück Familienarchäologie, eine Etappe in der Geschichte dieser Republik. Ein Blick voller Neugier und auch Empathie, auf den Großvater, den Kriegsheimkehrer, den Gartenzwergfabrikanten; auf den Vater, auf dessen Schriftstellerträume. Roehler hat die Orte der Vergangenheit noch mal bereist, die Briefe der Eltern gelesen, die 2001 unter dem Titel "Wespen im Schnee" erschienen sind. Er hat sich vorgestellt, was war - und was hätte sein können. In glühenden Sätzen und in eisigen Beobachtungen, mal von Melancholie durchzogen, mal von unbändiger Lebensgier.
Von Anfang an ist der Ich-Erzähler da, aber er tritt zur Seite, fast zweihundert Seiten lang, in denen es um Großeltern und Eltern geht; wie Nora und Rolf einander kennenlernten, nach Luft ringend in den erstickenden Mittfünfzigern, in Nürnberg und im fränkischen Stein, am Fuße eines Bergs, der Walberla heißt. Aber es ist eben auch eine Suche nach sich selbst, nach dem irreversiblen Moment, in dem die Verliebtheit umschlug in eine amour fou. "Hier hätte mein Vater Rolf Freytag noch einmal die Gelegenheit gehabt, seinem Leben eine Wendung zu geben. Er tat es nicht." Und so kommt der Erzähler zur Welt, das Kind, das die Mutter nicht wollte, das sie, im Roman, dem Vater unterschob, was sie dem Sohn später, an einem Abend im "Hofbräuhaus", als sie politisch, literarisch längst gescheitert war, erzählen musste, unbedingt. Und dagegen steht die Erinnerung des Dreijährigen, "wie meine Mutter vorher im Fahrstuhl geisterhaft verschwunden war, einfach so, ohne etwas zu sagen, ein dunkles Mysterium meiner Kindheit. Ich habe sie seither nie wieder als meine Mutter gesehen."
Das Kind Robert wird nach der Scheidung abgestellt bei den Großeltern väterlicherseits, aber auch gerettet, es geht für kurze Zeit auf in dem, was ihm später als fränkische Idylle erscheint: "Man pilgerte nach Hause und fraß, was nur ging. Viele Jahre später wird dem Erzähler dieses Leben ungeheuer dicht, ungeheuer gleißend und verheißungsvoll vorkommen. Näher wird er sich vielleicht nie mehr gekommen sein." Dann holt der Vater ihn zu sich, nach Berlin, Robert wird zum Schlüsselkind, das sich herumtreibt, verwahrlost, weil der Vater Frauen aufreißt, zecht, den Siebenjährigen durch den Friedenauer Literaturbetrieb der mittleren Sechziger schleift. Ein Kind, das immer mit dem Gespenst der Trennung lebt: "Schemenhaft wirkten nun die Beteuerungen, dass das, was geschah, nur das Beste für uns sei. In ein trügerisches Licht geriet allmählich jede vertrauenerweckende Geste von früher, jedes Lächeln, jedes sanfte Streicheln des Kopfes, jedes Abendbrot, jeder Spaziergang."
Die Eltern der Mutter holen ihn aus dem Berliner Sumpf, in die Nürnberger Villa mit dem nierenförmigen Pool, der scheiternden Schwester, der Migräne der Großmutter. Er wird ins Internat geschickt, das der Vater, längst zum "Phantom" geworden, nicht bezahlen will. Es ist ein einziges Hin- und Hergeschobenwerden, ein Umherirren, aus dem der Wunsch nach Symbiose, nach Zugehörigkeit erwächst, die er in den Nachbarsfamilien sucht. Und die er bei Laura findet, der Nachbarstochter in Stein: "Ich erwartete nichts von ihr, außer dass sie immer für mich da war."
Roehlers Blick ist so genau und scharf, dass er unbarmherzig erscheinen könnte, wenn er die Aufsteiger-Spießer-Hölle beschreibt, die Anfälle von Zerstörungswut schildert, die Rachewünsche grell ausleuchtet. Aber es ist eher ein Aushalten, die Entschlossenheit, sich nicht abzuwenden. Seine Augen, könnte man sagen, bleiben trocken, ohne die Tränen des Selbstmitleids, die den Blick verschleiern würden. So kommt das Monströse zum Vorschein, das Obszöne, das Abseitige, Peinliche, Schamvolle, das immer auch in Roehlers Filmen war - wie ein fernes Echo aus den Romanen der Mutter, deren Spießbürger-Satire "Die Riesenzwerge" (1964) sie zum frühen Fräuleinwunder des Literaturbetriebs machte. "Ich musste irgendwann aus mir hinaus und in der Welt einen Graben ausheben, tief genug, meine Eltern für immer verschwinden zu lassen, eine Schlucht."
"Herkunft" ist ein Logbuch des Entkommenseins: der Urszene, den endlosen Streitereien, den familiären Verwerfungen, der eigenen Ohnmacht, dem Umstand, dass Robert Mitte der siebziger Jahre in Berlin "vorübergehend der Drogendealer meiner Mutter (wurde). Ich schickte ihr billiges, polnisches Speed in Reclam-Heftchen, in die ich vorher mit der Rasierklinge Löcher geschnitten hatte." Selbst wenn nur diese 28,75 Prozent von alldem autobiographisch wären, kommt es einem beim Lesen wie ein mittleres Wunder vor, dass Oskar Roehler heute eine bürgerliche Existenz führt, dass er, durchs Kino und die Literatur, einen Weg gefunden hat, sich dem Strudel dieser "Herkunft" zu entziehen.
Gegen Ende von "Herkunft" klingen manche Sätze schon kathartisch: "Ich würde die Teile auflesen, ausgraben auf meiner langen Wanderung. Und eines Tages zusammensetzen." Und es ist dann eine so großartige wie großzügige Idee, wenn sich das Erzähler-Ich schließlich ganz leise aus seiner Geschichte davonstiehlt. Der Epilog gehört Lauras Mutter, und Laura, sie ist der wunde Punkt, die Kindheits- und Jugendliebe, die sich nicht in die Erwachsenenwelt hat retten lassen; sie ist so unvergessen wie unerreichbar in die Vergangenheit gefallen. "Doch dieses vor Glück strahlende Lächeln des jungen Mädchens, das voller Zuversicht und Hoffnung auf ihre große Liebe blickt, würde nie wieder auf das Gesicht ihres Kindes zurückkehren" - das ist der letzte Satz des Buches, und er trifft einen Ton, der sehr lange nachhallt.
Inzwischen heißt "Herkunft" auch "Die Quellen des Lebens", ist zum Drehbuch geworden, das zurzeit in Köln zum Film wird, mit Jürgen Vogel, Meret Becker, Moritz Bleibtreu und vielen anderen. Von einem solchen epischen Projekt, das mehr als drei Jahrzehnte Bundesrepublik umspannt, habe er schon lange geträumt, sagt Stefan Arndt, der das Neun-Millionen-Euro-Projekt für X-Filme produziert: als einen langen Kinofilm, aus dem anschließend ein Zweiteiler für ARD und Arte werden wird. Im Moment, sagt Arndt, 50, gebe es für seine Generation jeden Tag so peinigende wie erhellende Zusammenstöße mit der Vergangenheit, mit Schlaghosen und Plateausohlen, mit "Morning Has Broken" und "I'd Love You to Want Me", mit dem Klammerblues von damals, mit all den Dingen, an die nicht nur Arndt zuletzt Ende der siebziger Jahre gedacht hat.
Doch erst einmal ist da dieser Roman, der vielen deutschen Schriftstellern höllische Angst einjagen müsste - wenn Oskar Roehler nicht beschlossen hätte, weiter Filme zu machen, anstatt den Literaturbetrieb aufzumischen. In all seinen Unebenheiten hat dieser Roman eine ungeheure Wucht. Er schenkt einem das Vertrauen wieder, dass sich mit der Kraft der Sprache nicht nur ein Bild der eigenen Lebensgeschichte entwerfen lässt, in dem man sich mit Schrecken und mit Erleichterung wiedererkennt; sondern dass in diesem Bild auch wie von selbst das Porträt einer Generation durchschimmern kann.
Ein Buch, das die Welt zeigt, über die 1968 hereinbrach, und das zugleich die Karikatur, in die das Selbstverwirklichungsideal der 68er sich verwandelte, am Beispiel einer Jugend schmerzlich erfahrbar macht. Es ist ein Roman, der keinen faulen Frieden sucht mit den 68er-Eltern, der aber auch nicht dem selbstgerechten Furor verfällt, mit dem die 68er die Generation ihrer Eltern tribunalisierten. Er ist voller Schmerz, Leidenschaft und Trauer, voller Vitalität, pubertärer Todessehnsucht und trotzigem Überlebenswillen - weil er unbeirrbar dorthin geht, wo es weh tut. "Herkunft" ist ein Roman, den jeder gelesen haben muss, der wissen will, wie wir Kinder der späten fünfziger Jahre zu denen wurden, die wir heute sind.
PETER KÖRTE
Oskar Roehler: "Herkunft". Roman. Ullstein, 585 Seiten, 19,99 Euro. Erscheint am 14. September.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
eBook, ePUB
Die Ereignisse dieses autobiografischen Romans erstrecken sich von der Heimkehr des Erich Freytag aus der russischen Kriegsgefangenschaft bis hin zur Gegenwart.
In drei Erzählsträngen, die jeweils eine Generation umfassen, erzählt Autor Oskar Roehler die Geschichte der Familie …
Mehr
Die Ereignisse dieses autobiografischen Romans erstrecken sich von der Heimkehr des Erich Freytag aus der russischen Kriegsgefangenschaft bis hin zur Gegenwart.
In drei Erzählsträngen, die jeweils eine Generation umfassen, erzählt Autor Oskar Roehler die Geschichte der Familie Freytag, die gleichsam die Geschichte Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs symbolisieren soll.
Der Handlungsstrang des Kriegsheimkehrers mit seiner Sprachlosigkeit und seinem Unvermögen auch nur einen Hauch Empathie für seine Frau, die sich in Marie, Erichs Schwester verliebt hat, ist bezeichnend für die Traumata der Kriegsgeneration. Erst als Erich seine Gartenzwerge-Fabrik aufbaut, scheint er ein wenig aus sich herauszugehen. Mit Sohn Rolf hat er ein, für die damalige Zeit, halbwegs normales Verhältnis. Allerdings ist er mit seiner Berufswahl, Rolf will Schriftsteller werden, nicht einverstanden. Auch Nora, die aus einer wohlhabenden Familie stammt, für die sie sich schämt, findet nicht die ungeteilte Zustimmung Erichs.
Die nächste Generation Nora und Rolf ist zwar ein Symbol für die Aufbruchsstimmung und den Wiederaufbau, aber auch gleichzeitig ein Symbol für Verdrängung. Der Selbstmord von Rolf und Nora, die am Leben scheitern, scheint hier vorprogrammiert. Übrig bleibt Sohn Robert, der bei den Großeltern aufwächst, und mit sich selbst und seiner Umwelt im Clinch liegt.
Meine Meinung:
Ich kannte den Autor Oskar Roehler bislang nicht und bin mit großer Neugier an diesen Roman herangegangen. Leider hat mich das Buch nicht wirklich gepackt. Manches ist chronologisch geordnet erzählt, manches nicht. Manches ist schlüssig dargestellt, manches nicht. Oftmals werde ich auf eine spätere Stelle im Text vertröstet.
Es scheint, als wäre dies eine ganz normale Geschichte einer ganz normalen Familie aus dem Deutschland der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Einige Szenen klingen sehr vertraut, andere, für mich als Österreicherin, ein wenig skurril oder zum mindest ungewöhnlich.
Der Schreibstil des Autors ist schnörkel- und schonungslos.
Fazit:
Ein biografischer Roman, dessen Verfasser man vielleicht näher kennenlernen muss. 3 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für