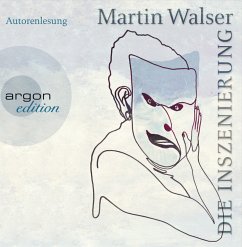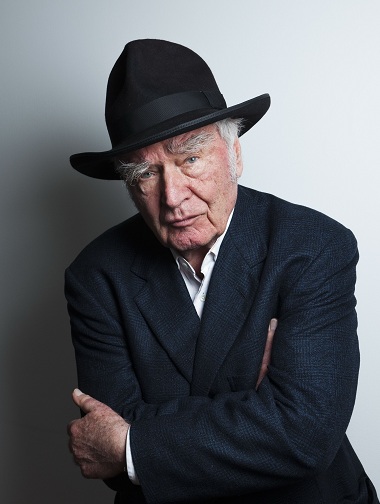Funkelnde Ironie, beklemmende Tragik, erzählerische WuchtAugustus Baum, ein berühmter Theaterregisseur, liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus. Herausgerissen aus der Inszenierung der »Möwe«,inszeniert er weiter, vom Krankenzimmer aus. Nicht nur das Stück, sondern auch sich selbst. Die Nachtschwester Ute-Marie, seine Frau Dr. Gerda und er sind die Personen, die er so handeln lässt,dass ein Roman daraus wird.Es ist ein Roman, der ohne Erzähler auskommt.Die Figuren stehen auf dem Spiel, darum müssen sie sprechen. "Die Inszenierung" ist der Roman der direkten Rede, und obwohl er von nichts als Liebe handelt, ist er eine Seltenheit, wenn nicht sogar Sensation: Dr. Gerda und Ute-Marie sind bei aller Lebensverschiedenheit gleich gut, gleich schön und auch gleich bedeutend.
| CD 1 | |||
| 1 | Die Inszenierung | 00:01:47 | |
| 2 | Die Inszenierung | 00:05:19 | |
| 3 | Die Inszenierung | 00:05:01 | |
| 4 | Die Inszenierung | 00:05:00 | |
| 5 | Die Inszenierung | 00:04:59 | |
| 6 | Die Inszenierung | 00:05:49 | |
| 7 | Die Inszenierung | 00:02:08 | |
| 8 | Die Inszenierung | 00:02:57 | |
| 9 | Die Inszenierung | 00:04:19 | |
| 10 | Die Inszenierung | 00:04:53 | |
| 11 | Die Inszenierung | 00:04:27 | |
| 12 | Die Inszenierung | 00:04:49 | |
| 13 | Die Inszenierung | 00:06:05 | |
| 14 | Die Inszenierung | 00:06:58 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Die Inszenierung | 00:07:39 | |
| 2 | Die Inszenierung | 00:06:54 | |
| 3 | Die Inszenierung | 00:03:55 | |
| 4 | Die Inszenierung | 00:04:15 | |
| 5 | Die Inszenierung | 00:05:20 | |
| 6 | Die Inszenierung | 00:04:36 | |
| 7 | Die Inszenierung | 00:04:27 | |
| 8 | Die Inszenierung | 00:05:27 | |
| 9 | Die Inszenierung | 00:04:43 | |
| 10 | Die Inszenierung | 00:04:49 | |
| 11 | Die Inszenierung | 00:05:23 | |
| 12 | Die Inszenierung | 00:04:59 | |
| 13 | Die Inszenierung | 00:04:12 | |
| CD 3 | |||
| 1 | Die Inszenierung | 00:03:19 | |
| 2 | Die Inszenierung | 00:03:02 | |
| 3 | Die Inszenierung | 00:03:37 | |
| 4 | Die Inszenierung | 00:03:01 | |
| 5 | Die Inszenierung | 00:05:39 | |
| 6 | Die Inszenierung | 00:04:00 | |
| 7 | Die Inszenierung | 00:03:35 | |
| 8 | Die Inszenierung | 00:04:47 | |
| 9 | Die Inszenierung | 00:04:32 | |
| 10 | Die Inszenierung | 00:05:52 | |
| 11 | Die Inszenierung | 00:02:26 | |
| 12 | Die Inszenierung | 00:08:00 | |
| CD 4 | |||
| 1 | Die Inszenierung | 00:06:57 | |
| 2 | Die Inszenierung | 00:04:05 | |
| 3 | Die Inszenierung | 00:05:08 | |
| 4 | Die Inszenierung | 00:05:32 | |
| 5 | Die Inszenierung | 00:05:01 | |
| 6 | Die Inszenierung | 00:04:26 | |
| 7 | Die Inszenierung | 00:04:31 | |
| 8 | Die Inszenierung | 00:04:16 | |
| 9 | Die Inszenierung | 00:06:08 | |
| 10 | Die Inszenierung | 00:05:29 | |
| 11 | Die Inszenierung | 00:05:55 | |
| 12 | Die Inszenierung | 00:04:40 | |

Alle Paare sind verloren: Martin Walser hat einen mit allen Wassern gewaschenen Theaterroman geschrieben. "Die Inszenierung" ist eine traurige Komödie über einen Mann, der zwei Frauen liebt.
Theologie ist jetzt nicht dran. Dafür Theater, Tschechow, antike Philosophie, Platon, direkte Rede, Dialog, Monolog, Briefe, Schein, Sein, Welt, Bühne. Martin Walsers heute erscheinender Roman "Die Inszenierung" steckt voller Überraschungen. Er ist ein mit allen Wassern gewaschener Theaterroman, ein wunderbar verzweigtes literarisches Spiegelkabinett - und ist doch vertraut: Im Zentrum steht ein Mann, der zwei Frauen liebt. Doch wie er das tut, ist von unerhörter sprachlicher Musikalität.
Die titelgebende Inszenierung findet statt in einem Krankenhaus, das Krankenzimmer ist die Bühne, der Drahtzieher des Stücks ist der Regisseur Augustus Baum, zusammengebrochen während der Proben zu Tschechows Komödie "Die Möwe". Aber schon singt und jubiliert er wieder. Denn er ist verliebt. In Ute, die er Marie nennt, seine Nachtschwester. Wer tauft, ist schon der Schöpfer eines Stücks. Und was Augustus Baum aufführt, ist kein Regie-, sondern ein Liebestheater mit den Mitteln der Literatur.
Schein, Sein, Kunst, Leben, bei Martin Walser geht eins ins andere über, wieder einmal ist nichts ohne sein Gegenteil wahr. Und klugerweise tut er gar nicht so, als sei diese Durchlässigkeit irgendwie neu. Walser liebt es, den Großen zu huldigen. Dieses Mal heißt sein Meister Anton Tschechow. Das Meisterstück "Die Möwe".
Schon dort schreibt Trigorin, der Dichter, wie jetzt Augustus, mal eben einen gerade gehörten Satz ins Notizbuch zur literarischen Verwendung. Da werden Zitate zur Verständigung benutzt, das Spielen von Szenen dient zur realen Annäherung und umgekehrt. "Die beiden sind ineinander verliebt, und heute werden ihre Seelen verschmelzen im gemeinsamen Kunstwerk", heißt es 1895 und passt auch für 2013. Die Welt sei eine Bühne, eine Inszenierung, sagt Augustus mit Shakespeare.
Aber wer zieht die Strippen? Der Regisseur, der selbst die Rolle des Regisseurs spielt? Steht er auf oder neben der Bühne? Im Roman gibt es zwei Wege, das zu klären: den romantischen und den vernünftigen, das sich überbietende Spiel oder die eindeutige Entscheidung. Dahinter steckt eine Machtfrage. Wie fast jeder Walser-Held ist Augustus verheiratet. Seine Ehefrau heißt Gerda und ist Psychologin. Sie kennt ihren Augustus, dessen Lieblingszahl die Drei ist. Sein Traum: Augustus, Ute-Marie UND Gerda. Offen, ohne Betrug. Die Trinität der Liebe. Aber Gerdas neues Buch heißt "Abhängigkeit, Wahn, Wirklichkeit", ein Kapitel: Schweigen und Verschweigen, ein anderes: Verheimlichung und Geheimhaltung.
In Walsers Roman sind die Männer die Romantiker, die Risikospieler. Sie besingen Frauen, trällern Liebesarien. Der Walser-Mann liebt nicht nur zwei Frauen zugleich, sondern glaubt, sie wären darüber entzückt. "Ich liebe mehr, als ich je lieben könnte. Ich liebe dich, und ich liebe die Nachtschwester. Das ist ein Gefühl ... der Umarmungsstärke." Frauen dagegen sorgen für Ordnung. Nur aus der Perspektive der Männer scheinen sie Heilige und Hure, fürs Frühstück sorgende Ehefrau und liebestolle Nachtschwester. In Wirklichkeit sind sie allesamt zurechnungsfähig. Niemals scheint der Graben zwischen Männern und Frauen bei Martin Walser tiefer als im neuen Buch.
In Tschechows "Möwe" gibt es eine ähnliche Konstellation. Die fragile Nachwuchsschauspielerin Nina verliebt sich in den erfolgreichen Dichter Trigorin, der mit dem alternden Bühnenstar Irina Arkadina verbandelt ist. Trigorin fordert von Arkadina sein Unabhängigkeit zurück, um für Nina frei zu sein. Doch vor der ganzen "Gestik der besitzergreifenden, machtausübenden Verzweiflung" der Verlassenen kapituliert er. Er unterwirft sich. Und daran wird auch die anschließende Affäre mit Nina nichts ändern. Arkadina hält die Fäden in der Hand. In einer unwiderstehlichen Analyse dieser Szene spannt Augustus Tschechow für seine Zwecke ein. Betrug verödet die Liebe. Arme Männer.
Und plötzlich kommt ein Brief aus Amerika, wie schon bei Tschechow. Walser liefert das theoretische Rüstzeug für den Roman gleich mit. Auch das ist typisch. Wieder geht es um eine Dreierkonstellation, wieder geht es um Betrug. Augustus heißt jetzt Hans Georg, Gerda Ursula und Ute-Marie Bertie. Wie Augustus war Hans Georg "bis zur Erschöpfung im Frauendienst tätig". Aber eben nicht nur. Der angebliche Schach-Club war ein Schwulentreff. Ursula ist entsetzt. Der Entlarvte flieht, verfolgt von der "Moral-Industrie" der betrogenen Ehefrauen nach Amerika und nimmt eine College-Stelle an. Sein Thema: Platon, der Philosoph der direkten Rede. Platon, das ist Philosophie auf der Bühne, Denken im Dialog, so eng hängen Philosophie und Theater zusammen.
Kurz winkt Martin Walser hier seinem letzten Roman "Das dreizehnte Kapitel" zu, der Theologe Karl Barth habe auch mit Paulus gesprochen, nicht über ihn. Aber ein fundamentaler Unterschied bleibt: Während sich Walser im "Dreizehnten Kapitel" die Sprache der Liebe von der Theologie leiht, von den literarisch talentiertesten Vertretern der Gottessuche, profitiert in der "Inszenierung" der liebesselige Augustus von der Literatur selbst. Das hat entscheidende Folgen. Hymnen, Gebet, Gotteslob - die Liebe zu Gott findet vollständig mit und in der Sprache statt, wenn zwei sich darüber verständigen, dann gibt es keinen Sex zwischen ihnen und darum im "Dreizehnten Kapitel" keine Affäre. Die Sprache der Literatur dagegen ist Verführung. Literatur will Liebe. Sie spricht mit Menschen, nicht zu Gott.
Währenddessen laufen dem Theaterregisseur Augustus die Schauspieler davon. Egal. Längst plant er "Die Möwe" als Zwei-Personen-Stück, er als Trigorin, Ute-Marie als Nina. Aber die hat ihre eigenen Pläne. Selbst die Geliebte reiht sich ein in die Phalanx der vernünftigen Frauen und entscheidet sich für ihren Mann Andreas, den sie Vinze nennt! Dass auch andere inszenieren, das war in Augustus' Inszenierungen nicht vorgesehen. Also allein Sein Monolog heißt: "Ich klage an vor dem Gerichtshof der Liebe. Erster und einziger Anklagepunkt: Herrschsucht. Ihr, Dr. Gerda und Ute-Marie, ihr seid, so verschieden ihr sein mögt, ein Herz und eine Seele. Wenn es um den Mann geht. Ihr verlangt seine Unterwerfung. (...) Unabhängigkeit. Das ist die letzte Utopie!"
Und noch einmal zieht Walser alle Register der Engführung. Bei Tschechow erschießt sich der unglückliche Konstantin, der es weder zum Schriftsteller noch zum Liebhaber gebracht hat, hinter der Szene. Der Regisseur Augustus wiederum überlegt, ihn auf der Bühne in die Luft schießen zu lassen mit den Worten: "Konstantin Gawrilowitsch hat sich erschossen." Daran hält sich der Schauspieler Augustus zum Höhepunkt seiner Anklage. "Augustus hat sich erschossen", lauten seine letzten Worte. Ein unmöglicher, paradoxer Sprechakt, der nur eines bedeutet: Das Leben geht weiter - irgendwie. Aus dem Tschechowschen Unglück wird die Kippfigur eines Walserschen Unglücksglücks.
"Dass du nur deinen Text hast, nur deinen Text sagen kannst und weißt: Es bringt überhaupt nichts", das macht nach Augustus die Komödie aus. Diese Definition passt auf den Roman. Handlung spielt keine Rolle oder ist vergangen. Kein Wort führt zu etwas. Das körperlich Entscheidende ist schon geschehen. Der GV, wie es im Text heißt, liegt vor dem Roman. Im Roman wird nur gesprochen. Der ist darum postkoital, wenn alle Tiere traurig sind. Also lesen wir: eine traurige Komödie.
"Das dreizehnte Kapitel" war eine Tragödie. Die Walsersche Trias, ein Mann liebt zwei Frauen, endete tödlich. Doch Komödien wie "Die Inszenierung" haben ebenfalls kein Happy End. Alle Paare sind verloren, die Ehen kaputt. So lässt Walser auch noch die Beziehung von Ute und Vinze scheitern. Alle sind einsam. Die Verschwörung der Vernünftigen macht keinen glücklich. Darum bleibt Augustus das letzte Wort: Badenweiler. Da, wo Tschechow gestorben ist.
FRANK HERTWECK
Martin Walser: "Die Inszenierung".
Rowohlt Verlag, Reinbek 2013. 176 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Urinente stört
Martin Walsers Theaterroman „Die Inszenierung“
erzählt eine burleske Krankenbettgeschichte
VON CHRISTOPHER SCHMIDT
Anton Tschechows Schauspiel „Die Möwe“ aus dem Jahr 1895 endet damit, dass der junge, unglücklich verliebte Dichter Konstantin Gawrilowitsch sich hinter den Kulissen erschießt. Trotz des tödlichen Ausgangs nannte Tschechow sein Theaterstück eine Komödie. Er wollte damit sagen: Ist es auch ernst, so ist es doch nur ein Spiel. Philip Roths Roman „Die Demütigung“ aus dem Jahr 2009 endet damit, dass der alternde, der Illusion, er könne gleich Pygmalion sich ein Lustgeschöpf nach seiner Phantasie erschaffen, beraubte Schauspieler Simon Axler im Geiste noch einmal in die Rolle des Konstantin aus Tschechows „Möwe“ schlüpft, die er in jungen Jahren so oft auf der Bühne gespielt hat, um sich dann jedoch ganz real zu erschießen. So machte Roth aus Tschechows Komödie eine bittere Farce. Er wollte damit sagen: Was man für ein Spiel hält, ist tödlicher Ernst.
Martin Walsers neuer Roman „Die Inszenierung“ schließlich endet damit, dass er diese Schlussszene seinerseits abwandelt, indem der Autor seine Hauptfigur, einen berühmten Theaterregisseur namens Augustus Baum nur in die Luft schießen lässt, worauf dieser sich auf den Fußboden legt, als sei er trotzdem tot. So überführt Walser Tschechow in ein anderes Genre, das der Burleske. Er will damit sagen: Dem Spieler ist alles unernst – außer dem Spiel.
Schließlich ist dieser Augustus Baum Theatermann durch und durch, untrennbar verflimmern für ihn Leben und Kunst, auch den Regisseur könne man nur spielen, sagt er. Im Moment spielt er jedoch eine andere Rolle: die des eingebildeten Kranken. Ein leichter Schlaganfall hat ihn aus den Proben zu Tschechows „Möwe“ gerissen. Vom Krankenbett aus diktiert er seiner Assistentin Lydia, die ihn vertritt, Regieanweisungen, wie es der jüdische Regisseur in François Truffauts Film „Die letzte Metro“ tut, der sich im Keller vor den Nazis versteckt und von dort aus heimlich die Proben leitet. Dass Baum mittlerweile die Schauspieler davonlaufen, ficht ihn nicht an. Das Stück dient ihm ohnehin nur noch als Folie des eigenen Lebens und umgekehrt. Deshalb wird auch das Krankenlager bald zur Besetzungscouch und das Patientenblatt zum Regiebuch.
Die Nachtschwester Ute-Marie, mit der Baum im Krankenhaus ein Verhältnis angefangen hat, soll seine neue Nina sein, er selbst will den Trigórin geben, der Nina im Stück verführt. Der alternde Künstler und das junge Ding – alle anderen Figuren sind gestrichen. Einstweilen simuliert Baum den Schwerkranken, um die Entlassung hinauszuzögern. Er selbst sieht das natürlich anders. Er habe sich das seriöseste Leiden überhaupt zugezogen, er sei liebeskrank. „Eine Immunschwäche der Seele“ nennt er das.
Seine Frau, die Ärztin Gerda, die dem Patienten auch im Krankenhaus regelmäßig das Vollwert-Frühstück ans Bett bringt, kennt ihren liebesdummen August. Denn Ute-Marie hat, mit Tschechow gesprochen, drei Schwestern, Britta, Carla, Lavinia, in die Baum vor ihr bereits sehr sterblich verliebt war. Seine Unfähigkeit zur Treue, die der alte Schwerenöter zum „Gottesdienst am Weib“ hochstilisiert, ist in ihren Augen nur durchsichtige Sexual-Mystifizierung. Ihrerseits hat sie im ehelichen Geschlechtergrabenkampf theoretisch nachgerüstet und ihrem Mann ein ganzes Buch mit dem passenden Titel „Abhängigkeit, Wahn und Wirklichkeit“ gewidmet.
Ohne Zweifel verkörpert dieser Augustus Baum das Klischee des monomanischen, überspannten Künstlers mit seinem vampirhaften Ego, ein nimmersatter Blaubart, der die Musen am liebsten gleich selber küsst. Seine Geliebten seien für ihn nur „Steckdosen“, aus denen er unbezahlten Strom zapfe, mutmaßt Gerda.
Der Angegriffene sucht sich Schützenhilfe für seine Apologetik der panerotischen Entgrenzung in der dramatischen Weltliteratur, namentlich bei Goethe, der in der Urfassung seiner „Stella“ die Ménage à trois propagierte, bevor er den Schwanz einzog und ins Moralmilieu überlief. Im Rededuell mit seiner Gerda schwärmt sich der Emphatiker Baum um Kopf und Kragen und gibt sich als eine Figur zu erkennen, in der die komödiantischen Archetypen des Theaters nachspuken: Er ist der komische Alte, der vom Krankenlager aus hingebungsvoll die Seinen traktiert und mit viel Theaterdonner und rhetorischem Viagra seine Promiskuität verteidigt. Und er ist der betrogene Betrüger, der ihr nicht gewachsen ist: der Freiheit, die er sich nimmt.
Leicht angeschrägt und denkbar unsexy ist ja bereits das Sujet dieser Krankenbettgeschichte. Walser lässt in der Nachtschwester die so unterschiedlichen Formen der sorgenden und der fleischlichen Liebe, Agape und Eros, sich gemeinsam über diesen Pflegefall beugen und bettet ihn mit gezielter Ranküne zwischen Patienten mit geschwollenen Hoden und künstlichem Darmausgang. Nebenan ist die Urinente die einzige Bettgenossin und der Infusionsständer das letzte, was sich noch erhebt. Und dass Baum sich die junge Schwester zum Ideal zurechtsäftelt, ohne sich ihren Namen merken zu können („Menschen vergess ich. Texte nie.“) – damit verrät er auch diese Liebe schon im Ansatz.
Aber Walser tändelt und tänzelt nicht nur ballettös mit Theateranalogien, er hat seinem Roman zudem eine rein dialogische Form gegeben, durchsetzt allein von knappen Regieanweisungen. Indem er auf eine übergeordnete Erzählerinstanz verzichtet, lässt er Rede und Gegenrede gleichberechtigt stehen, ohne die Widersprüche aufzulösen. Die Distanz zur Hauptfigur ist somit bereits formal eingepreist.
Man kann es auch so sagen: Walser zieht dem Phallokratismus einer Altmännerphantasie, der in der Gestalt der Kippfigur Baum noch einmal sein so ridiküles wie rostiges Zepter schwingt, ein Präservativ über. Nicht ohne Grund. Schließlich geht Walser hier weiter als in seinem vorherigen Buch „Das dreizehnte Kapitel“, das ebenfalls von einer verbotenen Liebe handelt. Allerdings bleibt durch die Form des Briefromans und dadurch, dass es darin niemals zu einer leibhaftigen Begegnung kommt, das Paarungsverhalten auf Lippenbekenntnisse beschränkt, sublimierter Oralsex sozusagen.
Auf die Metaphysik der Liebe folgt nun ihre Festkörper-Physik. Hier nämlich meldet Walser jenen Vollzug, den Gerda nüchtern GV nennt; da tut der Autor gut daran, einen gewissen Sicherheitsabstand zu halten und sein Alter Ego in das gebrochene Licht der Ironie zu stellen. Ging es seinerzeit um die Theologie der Liebe, so signalisiert der Wechsel ins Theatermilieu den Seitenschritt ins leichte Fach.
Das neue Buch verhält sich zum elegisch intonierten Vorgänger wie das Satyrspiel zur Tragödie, als Posse und erotische Travestie liest es sich wie ein frivoler Nachtrag, Thema und Variation. Und doch zwinkert Walser dem Vorgänger zu, durch eingeschaltete Briefe, die eine existenziellere Strömung in das leichte Parlando tragen – nicht nur weil Baums Freund Hans Georg sich ebenfalls auf den Theologen Karl Barth beruft wie die Theologin in „Das dreizehnte Kapitel“.
Dieser Hans Georg ist in die USA geflüchtet vor der „Moralindustrie“. Jahrelang hatte er ein Doppelleben geführt und sich nominell im Schachclub, realiter jedoch in der Schwulenbar vergnügt. Auch er träumt von einer Ehe zu dritt, allerdings einer bisexuellen, und liefert zugleich als Platon-Experte die Gebrauchsanweisung für das dialogische Verfahren des Romans. Wenn Walser allerdings diesem Hans Georg einen SS-Schwiegervater andichtet sowie eine Schwägerin, die als Touristenführerin in der Gedenkstätte Yad Vashem die Familienschuld abbüßt, ist man doch sehr erleichtert, dass er die hier angedeutete Parallelisierung von politischem und sexuellem Tugendterror nicht weiter verfolgt. Auch Hans Georgs Liebesleiden ist vergleichsweise profunderer Art und lässt sich mit den erotischen Kalamitäten und nonchalanten Purzelbäumen des Silberrückens Baum kaum engführen.
Am Schluss, wenn Ute-Marie sich gegen Baum und für die Vernunftehe entscheidet – Walser malt die Horroridylle der Energiesparhäuslebauer mit böser Formulierungsdelikatesse aus –, zitiert dieser die gesamte Weiblichkeit vor den „Gerichtshof der Liebe“. Einziger Anklagepunkt: Herrschsucht als Fälschung der promisken Natur der Liebe, die den Mann ins Joch der Treue zwinge. Die senkrechte Partie der weiblichen Scham Lippen zu nennen, sei das beste Beispiel für die Zivilisierung des Eros.
Baums Sehnsucht gilt der Auswilderung des Eros. Sein Problem aber besteht darin, dass er für seine Libertinage den Beifall genau desjenigen moralischen Milieus einstreichen will, gegen das er rebelliert. Dieses kleinbürgerliche Paradox qualifiziert ihn perfekt fürs deutsche Stadttheater. Sein persönliches Drama ist kein Stoff für einen Shakespeare oder Tschechow, sondern für die Charakterkomödien Molières. Martin Walser macht daraus freilich eine vergnügliche Selbstverspottung von federnder Doppelbödigkeit.
Aus gutem Grund hat Walser
seiner Liebesmetaphysik
ein Präservativ übergezogen
Immer bühnenwirksam:
Martin Walser. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA
Martin Walser:
Die Inszenierung.
Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek 2013. 176 Seiten, 18,95 Euro, E-Book 16,99.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de