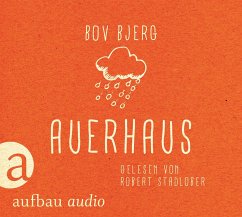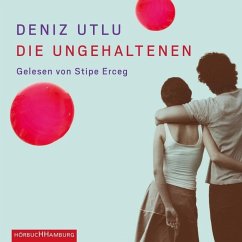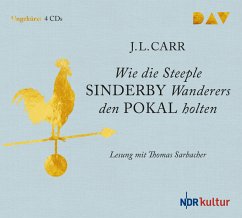Projekt protestieren; und Mona, die Ortsverrückte. Ein knappes halbes Jahr begleiten wir diese Figuren durch ihre Untergangsstimmung.
Dass man immer weiterliest, obwohl man das Ende kennt, Kapitel für Kapitel, die alle die Namen der einzelnen Ortsbewohner tragen, hat etwas mit dem Blickwinkel zu tun: mit dem fast vollkommenen Ausschluss der Außenwelt und der Stille, die dadurch entsteht. Annika Scheffels Roman setzt ein wie ein früher Film des Regisseurs Lars von Trier, von dem man lernen kann, wie strenge Blickführung funktioniert: In "Dogville" (2003) nähert sich die Kamera quälend langsam aus der Vogelperspektive einem Dorf. Die Geduldsübung hält den ganzen Film über an, wenn die Kamera wie im Sturzflug auf den Ort hinunterstößt, wo keine Häuser stehen, sondern nur weiße Kreidestriche auf einem schwarzen Theaterboden die Grenzen zwischen den einzelnen Behausungen markieren. Auch Annika Scheffels Ort ist ein solches Laboratorium. Und doch wird ihr Guckkasten nicht zur Kopfgeburt.
Das ist eine Leistung, weil die Gefahr durchaus groß ist bei dieser hautnahen Begleitung der Figuren, die dem ersten Panoramabild auf das geflutete Dorf folgt, bevor die Zeit zurückgespult wird: Nur das goldene Kreuz des Kirchturms ragt darauf aus dem Wasser heraus, ganz wie man es etwa schon auf der Fahrt gen Süden kurz vor dem Reschenpass gesehen hat oder in anderen gefluteten Tälern. Man stoppt an einem still im Sonnenlicht glänzenden See, liest die Informationstafel, macht ein Foto von dem aus dem Wasser ragenden Ende eines Turms und fährt weiter, mit einem mulmigen Gefühl. Annika Scheffel durchbricht dieses Postkartenmotiv und taucht in die Vergangenheit eines solchen Orts ab wie unter eine Glasglocke, die jederzeit unter dem Druck der Wassermassen zerbrechen kann.
Der Roman könnte in der Lausitz spielen: 136 Orte mussten dort seit 1924 dem Braunkohlebergbau ganz oder teilweise weichen, über 25 000 Menschen verloren ihre Heimat, so die offiziellen Zahlen. Hier, heißt es in der Danksagung, habe die Autorin im "Archiv Verschwundener Orte" recherchiert, und es ist schön zu hören, dass es ein solches Archiv für Verschwundenes wirklich gibt.
Annika Scheffel wurde 1983 in Hannover geboren und schreibt neben Prosa auch Drehbücher. Mit "Ben" hatte die in Berlin lebende Autorin vor drei Jahren einen ersten Erfolg. Für ihren neuen Roman greift sie auf die Erinnerungen ihrer Großeltern zurück. Die Menschen in Annika Scheffels kleiner Ameisenwelt sehen die Abrissbagger anrücken, aber sie weichen nicht vom Fleck. Über Nacht sind die Häuser mit roten Strichen versehen, welche den künftigen Wasserpegel anzeigen. Die Dorfbewohner kommen in der einzigen Gaststätte zusammen. Sie versuchen, die Striche wegzuwischen. Und irgendwann steht auf dem Hauptplatz ein Glassarg mit dem Modell eines neuen Ortes, der woanders gebaut werden soll, mit einem Hallenbad, einer Seilbahn und einem Teich mit Mandarinenten, viel schöner als der alte Ort, durch den nur die Traufe fließt. Der Fluss ist urig, bevor er zum See anschwillt, mit Laubbäumen und altem Gehölz zum Klettern. Und glaubt man Marie, einem aufgeweckten Kindergartenkind mit viel Phantasie, wohnt dort auch ein blauer Fuchs.
Dass ein Hauch magischer Realismus durch die deutschsprachige Gegenwartsliteratur weht, ist erstaunlich genug. Gerade jüngeren Autorinnen, wie etwa auch Sabrina Janesch, scheint das besonders bei der Begegnung mit der Großelterngeneration zu passieren, vielleicht, weil deren Leben unfassbar entrückt wirkt. In Annika Scheffels Roman haben solche dezent eingesetzten wundersamen Elemente eine wichtige Funktion für das große Geschehen: Sie spannen um diese untergehende Ortschaft ein Netz, von dem man gar nicht recht sagen mag, ob es bedrohlich oder vertrauenerweckend ist. Und je tiefer man eindringt in die verschiedenen Lebensverhältnisse dieser Menschen, desto klarer wird, dass hier Sehnsuchtswesen Gestalt annehmen, manchmal erschaffen von rührender Naivität: Der blaue Fuchs, an den nicht nur Marie, sondern das ganze Dorf wie selbstverständlich glaubt, beißt mit Vorliebe die anrückenden Gelbhelme; und Milo, ein zerlotterter, schlaksiger Junge, der über Nacht da ist, wieder verschwindet und im Wald wohnt, erfüllt Davids Wunsch nach Zuneigung.
David lebt, seitdem die Mutter wegging, mit seinem Vater, dem Bürgermeister, allein. Diese vom Vater tyrannisch und hilflos geführte Wohngemeinschaft - David ist bereits 27 und wird hin und wieder eingesperrt - ist nur eines der vielen kleinen Dramen, die sich im Laufe dieses Romans entfalten und die man mit zunehmendem Interesse verfolgt; Dramen, in denen es immer um die Schwierigkeit geht loszulassen. Nicht nur wohnen viel zu alte Kinder noch immer bei den Eltern. Auch Witwen können vom Verstorbenen nicht Abschied nehmen. Die Toten und Flüchtigen bestimmen seit langem den Alltag der Lebenden über jedes Maß an Trauerzeit hinweg. Das Dorf scheint überreif für den Untergang. Von gesunder Aufbruchstimmung ist aber kaum etwas zu spüren: "Der Ort schläft, während an den Mauern gekratzt wird."
Annika Scheffel erzählt von der nahenden Vernichtung in einfachen, klaren, unpathetischen Sätzen. Sie begibt sich mit Ruhe und Würde in die verschiedenen Köpfe dieser Menschen. Mitunter sehen wir dann eine Frau in blindem Aktionismus das Kreuz der Kapelle ein letztes Mal putzen oder beobachten David bei seinen merkwürdig schlafwandlerischen Spaziergängen im gerodeten Wald, während der Mond fahl scheint. Und würde man nicht immer wieder darin erinnert, könnte man die Flutung des Orts, diese unvorstellbare Verwandlung eines Stücks Land, fast vergessen. "Hier wächst nichts mehr, über diesen Boden werden bald Algen schweben." Und tatsächlich überwältigt einen dann der Schutt des ersten zerstörten Hauses mit überraschender Wucht.
Wie kleine Felsbrocken stemmen sich in dieser Prosa Familienschicksale gegen ein großes Gebirgsmassiv. Dass dies beim Lesen einen immer stärker werdenden Sog entfaltet, liegt auch an der Farb- und Lichtdramaturgie, mit der Annika Scheffel arbeitet. Noch vor dem Eintreffen der Wassermassen ist alles Licht aus dem Ort gewichen. "Bevor alles verschwindet" ist märchenhaft und zugleich ein sehr gegenwärtiges Buch.
ANJA HIRSCH
Annika Scheffel: "Bevor alles verschwindet". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 412 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
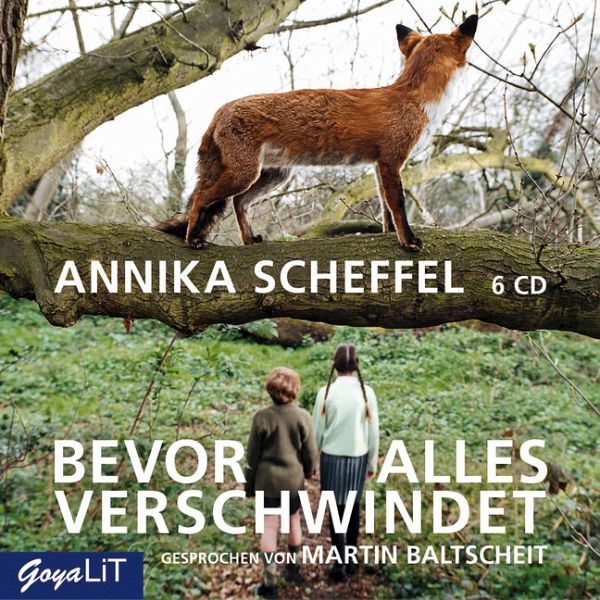






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.05.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.05.2013