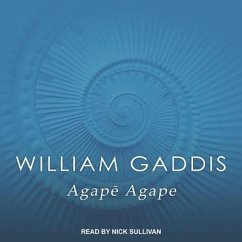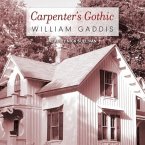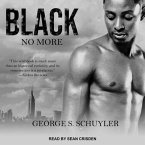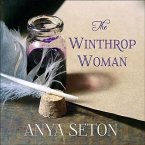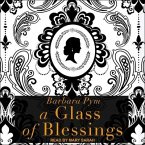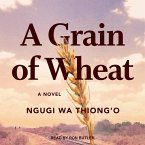Produktdetails
- Verlag: Tantor
- Gesamtlaufzeit: 195 Min.
- Altersempfehlung: ab 18 Jahre
- Erscheinungstermin: 30. Oktober 2018
- Sprache: Englisch
- ISBN-13: 9781665247306
- Artikelnr.: 61499503

William Gaddis’ nachgelassenes Manuskript „Agapé Agape” als „Das mechanische Klavier” in deutscher Übertragung
Es ist ein rechtes Wunder des Lesens, dass wir den Prosa- Monolog glauben. Kein Mensch denkt oder spricht auch nur annähernd so, wie die moderne Literatur ihre Figuren vor uns zu Wort kommen lässt. Ein Satzstrom, wie er sich in den fiktiven Ansprachen und Inneren Monologen großer Romane Bahn bricht, ließe sich nirgends in freier Wildbahn aufschnappen, und die raffiniertesten Lauschapparate der Zukunft werden wohl auch in unserem Hirn nichts Derartiges aufzeichnen. Gewiss sind das Kind, das sein einsames Spiel laut kommentiert, und der kauzige Alte, der mit sich selbst spricht, entfernte Verwandte der Ich-Erzähler, die in der Literatur alleine reden. Aber nie würde ein Mitschnitt eines realen Selbstgesprächs die überwältigende Wirklichkeitsillusion hervorrufen, die der Kunstmonolog literarischer Gestalten zu schaffen vermag.
Der letzte Text des amerikanischen Romanciers William Gaddis (1922- 1998) ist ein hundert Seiten langer Monolog. Der Leser bekommt beiläufig die Umrisse einer Szene: Ein alter todkranker Schriftsteller liegt im Schlafzimmer seines Hauses. Der pflegebedürftige Greis hat sein Bett, weil ihm das Aufstehen wegen eines frisch operierten Beines unmöglich ist, dicht mit Bücher- und Manuskriptstapeln umgeben. Knapp wird eine Vorgeschichte angedeutet: Es spricht ein bekannter, sogar preisgekrönter Autor, der es nicht zu Reichtum, aber immerhin zu einem Anwesen auf dem Lande gebracht hat. Es gibt drei erwachsene Töchter, an die er seinen Besitz zu vererben gedenkt.
Dieser Alte hebt mit dem Wort „No” zu reden an. Das dritte Wort bereits ist „you”, davon muss sich der Leser angesprochen fühlen, denn ein anderes Gegenüber bietet der Text nicht an. Und zwei Zeilen weiter wissen wir, wozu der Kranke sich, trotz schwindender Kraft, trotz Schmerzen, teils aufgeputscht, teils gehemmt von psychoaktiven Medikamenten, aufzuschwingen hofft: Es geht ihm um eine unvollendete schriftstellerische Arbeit. Vor unseren Augen – auf der Bühne des Prosamonologs – will er ein lang gehegtes, aber nie zusammenhängend verfasstes Werk zumindest rudimentäre Kontur annehmen lassen.
Ohne Bogenschwung
Dieses Projekt sollte eine Episode der jüngeren Technikgeschichte erzählen: die Entwicklung und den Siegeszug des mechanischen Klaviers, der ersten digital gesteuerten Maschine, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber mindestens genau so wichtig wie die technologische und ökonomische Darstellung sind dem Schriftsteller die medien- und kunsttheoretischen Reflexionen, die er damit verbinden wollte. Um das Wesen der künstlerischen Kreativität, um die Authentizität von Kunsterfahrung, um die ganze ästhetische Krise der Moderne sollte es in seinem nie zu Ende geschriebenen Opus magnum gehen.
Auch im Leben des Schriftstellers William Gaddis hat es eine entsprechende Sisyphus-Arbeit gegeben. Über fünf Jahrzehnte war Gaddis parallel zu seinen Romanprojekten mit eben jener Geschichte des mechanischen Klaviers beschäftigt. Bereits 1951 veröffentlicht er hierzu einen Artikel im Atlantic Magazine, in den großen Romanen „The Recognitions” und vor allem in „JR” hat sich diese Obsession niedergeschlagen, im Nachlass von Gaddis finden sich darüber hinaus tausende Seiten Material und Notizen.
Den Lesern, die zu „Das mechanische Klavier” greifen, bleibt dergleichen Fron erspart. Das Buch, das sich in der deutschen Ausgabe Roman nennen muss, ist nicht nur dem Umfang nach schlank. An keiner Stelle tendiert der Monolog zur Breite. Wo es um Technik- und Mediengeschichte geht, wird blitzlichtartig beleuchtet, weder chronologisch erzählt noch explizit analysiert. Ähnlich verhält es sich mit den Beispielen aus Musik und Literatur, denen kein essayistischer Bogenschwung vergönnt wird. Als Erfahrungssplitter des Sprechenden, genossen, erlitten und bedacht, glühen sie kurz auf, um oft schon nach einem Satz der nächsten Erinnerung, dem nächsten Gedanken Platz machen zu müssen.
Dies ist von radikaler Rücksichtslosigkeit gegen alle Leser, die in Darstellung wie Reflexion nach säuberlich ausgepinselten Vorder- und Hintergründen verlangen. Nein, für eine solche Mit- und Nachwelt fehlt es dem Erzähler nicht nur an Zeit und Kraft, sondern auch an gutem Willen. Längst ist er überzeugt, dass man den allermeisten die Wahrheit eh umsonst predigt, dass man niemandem etwas eintrichtern könnte, was er nicht von selbst begriffe. Dieser todkranke Denker macht keinen Hehl aus seinem elitären Selbstbewusstsein: Er spricht für Eingeweihte. Die wenigen, die überhaupt verstehen können, was in Welt und Kunst gespielt wird, bringen aus der eigenen leid- und lustvollen Erfahrung schon das Nötige mit, um das enggefügte Stückwerk seiner Rede in den rechten Zusammenhang zu setzen.
So mag man in einem ersten Zugriff an die monologisierenden Nörgler deutschsprachiger Prosa denken, und tatsächlich taucht Thomas Bernhard, dessen Werk für den späten Gaddis eine wichtige Leseerfahrung war, im Text als einer auf, der den Sprechenden vorauseilend plagiiert habe. Aber der Ton macht die Musik: Genau gehört, ist der helle und stets auf Knappheit bedachte Grimm, der Gaddis’ Erzähler vorantreibt, doch etwas anderes als das ausufernde Selbstmitleid, das die misanthropen Helden unserer neueren Literatur am Räsonieren hält. Das Amerikanisch dieses Monologs wirkt muskulös. Selbst wo es im Satz abbricht, sprüht seine Bruchkante noch vor Energie. Es ist eine Sprache, die Mumm hat. Mit einer Beherztheit, um die wir sie als Deutsche herzlich beneiden dürfen, wirbt sie, auch, wo sie nicht ,you‘ sagt, um ihr Du, um das Ohr des Lesers.
Glücklich wer „Agapé Agape” im amerikanischen Original lesen kann. Denn anderenfalls begibt er sich auf Gedeih und Verderb in die Hand des Übersetzers. Marcus Ingendaay hat sich die Sache nicht leicht gemacht. Ambitioniert versucht er im gegenwärtigen Deutschen einen Ton für Gaddis’ vitalen Schwanengesang zu finden. Zurecht wagt er es, das, was im Text einmal „just to get the sequence right” genannt wird, die rechte Reihung eben, auch durch mutige Umstellungen, durch Weglassen und Hinzufügen neu zu erringen. Und dies wäre ihm vielleicht gelungen, wenn er den beiden Potenzen des Leseakts, der Kraft der Textvorlage und der Phantasie der Lesenden, vertraut hätte.
Sigi, mein Gold
Uns, die deutschsprachigen Leser, hält Ingendaay jedoch eher für Hilfe suchende Geister, denn Gaddis Text wird ihm regelmäßig der Erklärung bedürftig. Das beginnt bei zahlreichen kleinen rhetorischen Hilfestellungen, und nimmt nicht selten den Charakter aufdringlicher Bescheidwisserei an. Wenn der Erzähler im Zusammenhang mit seinem verletzten Bein in einem Gedankensprung plötzlich von „Jenseits des Lustprinzips” und von einem spricht, den seine Mutter „Sigi ,mein Gold” genannt hat, vertraut das amerikanische Original darauf, dass wir auch ohne Nennung des Namens wissen, wer im folgenden gemeint ist. Ingendaay muss uns jedoch sogleich eilfertig ein „laut Freud” soufflieren.
Noch kundiger gebärdet sich der Übersetzer, als zum ersten Mal ein Buch Thomas Bernhards ins Spiel kommt. Der Leser des Originaltexts muss sich die ganze Passage, immerhin eine Seite lang, mit einem kryptischem ‚he‘ begnügen. Die deutsche Übersetzung fällt sofort mit einem „schreibt Thomas Bernhard” ins Haus und fügt, als gelte es, die Fleißarbeit der Recherche zu beweisen, auch den Namen der Bernhardschen Romanfigur, deren Worte zitiert werden, hinzu.
Unangenehm wird Ingendaays Erklärungswut, wo sie weniger den Leser als den Autor zu bemuttern beginnt. „Jacquard’s loom hits you square in the belly”, heißt es über die verhängnisvolle Erfindung des halbautomatischen Webstuhls, dessen Warenbaum dem Weber bei jedem Webgang in den Magen trifft. „Die Jacquardmaschine war der erste echte Tiefschlag in die Magengrube der Menschheit. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes ...” macht Ingendaay daraus. Die drastische Allerweltswendung „voll in den Magen” muss mit dem falschen Bild des boxerischen Tiefschlags, der ja eben nicht in den Magen, sondern unter die Gürtellinie geht, überboten werden, und dann soll es, um den Kelch der Stilblüte ganz aufzuzwingen, auch noch der Magen der Menschheit sein.
Zum Teil scheint der rhetorische Übereifer der Übersetzung dem Bestreben geschuldet, den Charakter der Mündlichkeit zu verstärken. Weit mehr als im Original wird das Anredepronomen ‚Du‘ strapaziert. Ein bündiges ‚See‘ muss im Deutschen zu einem „Aber fällt Dir was auf? Genau!” ausufern. Und ein abrupt eingeschobenes und hart gefügtes „wait wait wait” zerläuft zu einem flauen „Moment mal, ich muss das mal kurz ...”
Der Erzähler des Originals ist aber alles andere als ein Schwätzer. „. .. and finally the audience instructing eachother” heißt es lakonisch bei Gaddis. In der Übersetzung aber lesen wir: „... und wohin das führt, ist hinlänglich bekannt. Am Ende will das Publikum sogar Meister sein und sich in einer Art Selbsthilfegruppe wechselseitig alles Nötige beibringen . ..” Wessen Deutsch ist das? Der Jargon gegenwärtiger Selbsthilfegruppen? Gewiss, das Deutsche kann die eigentümliche Bündigkeit des modernen Amerikanisch nicht vollends nachbilden, aber statt immer wieder in flapsiges Gequatsche zu verfallen, hätte es sich gelohnt zu bedenken, dass es auch in der deutschen Literatur eine Tradition der schlagend knappen Wendungen gibt.
Bemüht um geläufige Mündlichkeit und modische Gegenwärtigkeit, bemerkt Ingendaay nicht, dass er das erzählerische Pathos der Figur in Gefahr bringt, wenn er ihr den dämlichen neudeutschen Spruch „Schluss mit lustig” in den Mund legt. Der alte sterbenskranke Mann, der zugleich sensibler Feingeist und knallharter Realist ist, fordert von sich selbst: „... organize what’s essential and throw out the rest of it”. Auf Deutsch muss es dann aber leider heißen: „Bring Ordnung ins Wesentliche, hau weg den Scheiß.”
Drei Musen, drei Töchter
Gaddis ist seit Dezember 1998 tot. Er hat im Gegensatz zu seinem letzten Helden seine Arbeit zu Ende gebracht, und seit „Agapé Agape” leben die mysteriösen drei Töchter unter uns. Die Hauptwerke von Gaddis, seine drei großen Romane, könnten sich hinter diesen namenlosen Figuren verbergen. Aber vielleicht sind auch drei der antiken Musen gemeint. Im Schlussstück seines Monologs halluziniert Gaddis’ Erzähler in einer bewegenden Mischung aus Hilflosigkeit und Hybris um die Gestalt des wahren Künstlers, dem unter göttlicher Eingebung mehr gelingt, als menschenmöglich ist. Gottähnlich und zum Scheitern verdammt ist diese Gestalt. Und der Stift, nach dem der todesnahe Schriftsteller in seinen schweißnassen Laken immer wieder kramen muss, könnte jener Griffel sein, den Kalliope ihm über Jahrzehnte stets aufs neue gereicht hat, jenes schlichte Werkzeug, das diese Muse auch weiterhin – selbst im Zeitalter des reproduktiven Irrsinns – für die Hand des Genies bereithält.
GEORG KLEIN
WILLIAM GADDIS: Das mechanische Klavier. Roman. Aus dem Amerikanischen von Marcus Ingendaay. Manhattan, München 2003. 120 Seiten, 16 Euro.
Monologartisten auf der Suche nach dem Ohr des Lesers Foto: Regina Schmeken
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de