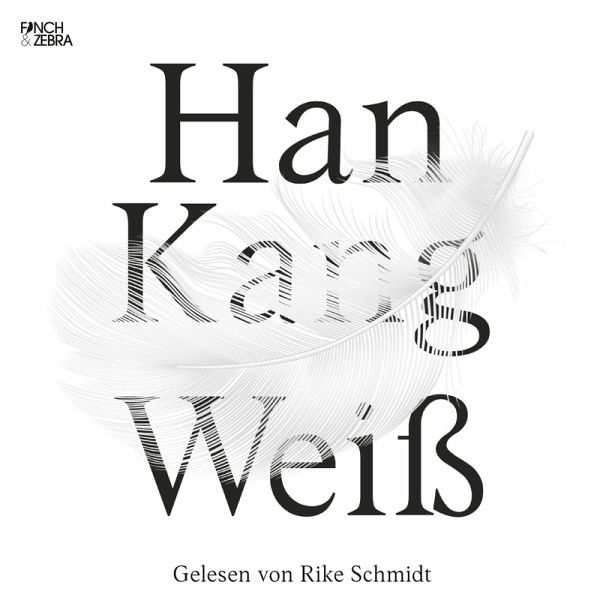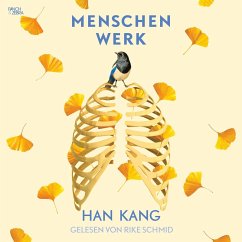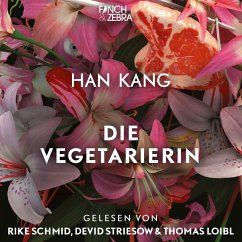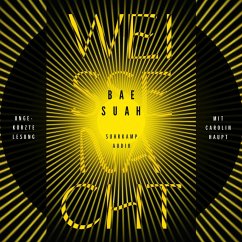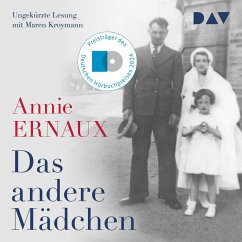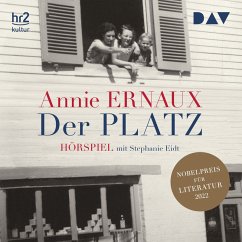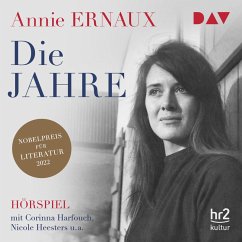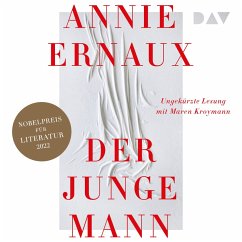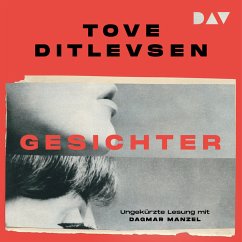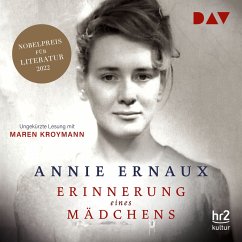PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!





"Ich glaube, dass dies die besten Worte für einen Abschied sind. Bitte stirb nicht. Lebe." Während eines Aufenthalts in einer europäischen Stadt, die im weißen Winterschlaf liegt, überfällt die Erzählerin plötzlich die Erinnerung an ihre Schwester, die als Neugeborenes in den Armen der Mutter starb. Sie ringt mit dieser Tragödie, die das Leben ihrer Familie bestimmt hat, ein Ereignis, das in Bildern von Weiß wieder und wieder aufscheint: das Weiß der Muttermilch, der Windel, der reiskuchenweißen Haut des kleinen Mädchens. Nur eine Autorin wie Han Kang vermag es, aus einer so zutie...
"Ich glaube, dass dies die besten Worte für einen Abschied sind. Bitte stirb nicht. Lebe." Während eines Aufenthalts in einer europäischen Stadt, die im weißen Winterschlaf liegt, überfällt die Erzählerin plötzlich die Erinnerung an ihre Schwester, die als Neugeborenes in den Armen der Mutter starb. Sie ringt mit dieser Tragödie, die das Leben ihrer Familie bestimmt hat, ein Ereignis, das in Bildern von Weiß wieder und wieder aufscheint: das Weiß der Muttermilch, der Windel, der reiskuchenweißen Haut des kleinen Mädchens. Nur eine Autorin wie Han Kang vermag es, aus einer so zutiefst persönlichen Erinnerung eine große literarische Erzählung zu erschaffen: "Weiß" ist ein Buch über Trauer und die Widerstandskraft des menschlichen Daseins - Han Kangs persönlichstes Buch und zugleich ihr literarisches Meisterstück.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Han Kang wurde 1970 in Gwangju, Südkorea, geboren und ist die wichtigste literarische Stimme Koreas. 1993 debütierte sie als Dichterin, ihr erster Roman erschien 1994. Für 'Die Vegetarierin' erhielt sie gemeinsam mit ihrer Übersetzerin 2016 den Man Booker International Prize, 'Menschenwerk' erhielt den renommierten italienischen Malaparte-Preis. 'Weiß' war ebenfalls für den Booker Prize nominiert. 2024 erhielt Han Kang den Nobelpreis für Literatur. Sie lebt in Seoul. Im Aufbau Verlag sind 'Die Vegetarierin', 'Menschenwerk', 'Deine kalten Hände', 'Weiß', 'Griechischstunden' und 'Unmöglicher Abschied' lieferbar. Mehr zur Autorin unter han-kang.net. Ki-Hyang Lee, geboren 1967 in Seoul, studierte Germanistik in Seoul, Würzburg und München. Sie lebt in München und arbeitet als Lektorin, Übersetzerin und Verlegerin. Für ihre Übersetzungen wurde sie 2024 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet.
Produktdetails
- Verlag: Buß und Thielen GbR
- Gesamtlaufzeit: 97 Min.
- Erscheinungstermin: 18. August 2020
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 4251703557711
- Artikelnr.: 59823723
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Rezensentin Eva Biringer findet Han Kangs neuesten Roman "wunderbar verstörend": Eine traumatisierte Frau hat sich in einer namenlosen, wegen der frühen Dunkelheit und unerbittlichen Kälte vermutlich sehr nördlichen Stadt eingemietet und schreibt dort an einer Liste weißer Dinge, um sich selbst zu therapieren, fasst die Kritikerin zusammen. Biringer hat sich nicht gewundert, dass der Tod hier allgegenwärtig ist, denn sie weiß, dass er in fernöstlichen Kulturen mit der Farbe Weiß assoziiert wird - die Liste weißer Dinge wird zur Bewältigungsstrategie für ein Leben, zu dem auch der Tod gehört, erklärt sie. Zwar will die Kritikerin nicht leugnen, dass sie das Buch bedrückend fand, aber sie ist überzeugt, dass kaum jemand so schön über den Weltschmerz schreiben kann wie Kang.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.08.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.08.2020Die Toten kleiden sich in den aufziehenden Rauch
Bitte stirb nicht: Der Prosa-Bildband "Weiß" der koreanischen Erfolgsautorin Han Kang ist eine poetische Meditation über den Verlust einer Schwester, ein Text von kristalliner Klarheit und Offenheit.
Übel zugerichtete Körper und seelischer Schmerz sind die Themen der südkoreanischen Schriftstellerin Han Kang. Im Roman "Menschenwerk" (deutsch 2017) verleiht sie den Opfern des Massakers von Gwangju eine Stimme - 1980 wurden in dieser Stadt im Südwesten Koreas Studenten, die für Bürgerrechte demonstrierten, vom Militär ermordet, mit ihnen Teile der Bevölkerung, die sich solidarisierten.
Vor allem aber schaut Han Kang auf versehrte weibliche Körper. So in ihrem
Bitte stirb nicht: Der Prosa-Bildband "Weiß" der koreanischen Erfolgsautorin Han Kang ist eine poetische Meditation über den Verlust einer Schwester, ein Text von kristalliner Klarheit und Offenheit.
Übel zugerichtete Körper und seelischer Schmerz sind die Themen der südkoreanischen Schriftstellerin Han Kang. Im Roman "Menschenwerk" (deutsch 2017) verleiht sie den Opfern des Massakers von Gwangju eine Stimme - 1980 wurden in dieser Stadt im Südwesten Koreas Studenten, die für Bürgerrechte demonstrierten, vom Militär ermordet, mit ihnen Teile der Bevölkerung, die sich solidarisierten.
Vor allem aber schaut Han Kang auf versehrte weibliche Körper. So in ihrem
Mehr anzeigen
bekanntesten, 2016 mit dem Man Booker International Prize ausgezeichneten Roman "Die Vegetarierin", in dem eine Frau sich der strukturellen Gewalt einer patriarchal dominierten Gesellschaft zu entziehen versucht. Auch in "Deine kalten Hände", im Original bereits 2002, in deutscher Übersetzung erst 2019 erschienen, erzählt Han Kang davon, wie soziale Normierungen physische und psychische Deformationen verschulden. Und nicht zuletzt davon, wie künstlerische Auseinandersetzung ebendamit erfolgen kann.
"Weiß" lautet der schlichte Titel von Han Kangs jüngst übersetztem Buch, das sich einer eindeutigen Gattungsbezeichnung entzieht - kurze Prosastücke, versetzt mit wenigen Fotos und Screenshots einer Performance. Eine Hand mit Salz ist darauf zu sehen oder eine Ansammlung weißer Federn. Der Schmerz und die Versehrtheit, die hier zur Sprache kommen, sind weniger sozial, sondern wohl autobiographisch grundiert - und vielleicht meint man gerade deshalb, diesen schmalen Band als eine Art Nukleus von Han Kangs Werk zu lesen, als dessen Kraftzentrum. "Weiß" ist eine Meditation über Trauer, eine poetische Installation über Verlust.
Am Anfang steht der beinahe lapidar formulierte Entschluss, über weiße Gegenstände zu schreiben, es folgt eine Liste: "Wickeltuch, Babyhemdchen, Salz, Schnee", die, endend mit dem "Totenhemd", einen Lebenszyklus zu umreißen scheint, ohne dass die namenlose Erzählerin bereits benennen kann, welche Bedeutung das Betrachten dieser Wörter haben könnte. "Sie würden in mir gedreht und gewendet werden und schließlich in Form von Sätzen herausvibrieren wie fremde, klagende oder schrille Töne, die der Geigenbogen einer Metallsaite entlockt."
In einer Hinsicht irrt die Erzählstimme: Schrill ist nichts an diesem Buch, vielmehr liegt über den großzügig gesetzten Seiten eine konzentrierte Stille, die längst nicht nur von den schneebedeckten Landschaften ausgeht, die Han Kang schildert. Auch die selbstgestellte Frage, ob es ihr gutes Recht sei, sich zwischen den Sätzen zu verstecken, erweist sich mit jedem neuen Prosastück mehr als gegenstandslos.
Das Konzept des Bandes mag experimentell anmuten und Weiß als Farbe der Avantgarde gelten - wie Friederike Mayröcker sie in ihrem jüngsten Proem "da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete" verschiedentlich aufruft. Weiß sind aber auch die Gipsabdrücke, die der Künstler in Han Kangs Roman "Deine kalten Hände" von Frauenkörpern anfertigt, und die leere Formen bleiben. "Weiß" als Buch hingegen ist von kristalliner Klarheit und Offenheit und dabei so zurückgenommen und zart wie der Ausdruck "weißes Lächeln", den es, so schreibt Han Kang, wohl nur in ihrer Muttersprache gebe. Der Ausdruck beschreibe ein Gesicht, "das ein Lächeln - einsam und versonnen - nur andeutet, verbunden mit zerbrechlicher Reinheit". Und weiter: "Wenn es überhaupt auf jemanden angewendet werden kann, dann auf dich, die du darum kämpfst, zu lachen, während du geduldig erträgst."
"Weiß" erzählt über die verstorbene Schwester der Erzählerin, die selbst gestaltlos bleibt, in diesem Fall aber offenkundig mit der Autorin in eins genommen werden kann. Es handelt von der Trauer über einen Verlust, der selbst nicht erfahren wurde, aber das eigene Dasein bestimmt. Und mehr noch: der die eigene Existenz vielleicht allererst ermöglicht hat. Wie vermisst man, was man nicht kannte?
Die Schwester war das erste Kind der Eltern und verstarb kurz nach der unerwarteten verfrühten Geburt - die Mutter war allein in einem abgelegenen Haus ohne erreichbare Hilfe, als die Fruchtblase platzte. "Meine Mutter hat mir erzählt, dass ihr erstes Kind zwei Stunden nach der Geburt gestorben ist. Es war ein Mädchen, mit einem Gesicht wie ein weißer, mondförmiger Reiskuchen." Wiederholt werden die Geburt und das kurze Augenaufschlagen des Neugeborenen aufgerufen, wie auch die flehenden Worte der Mutter: "Stirb nicht, bitte stirb nicht!" Eine Erzählung, die sich in die Kindheit der Erzählerin einschreiben wird. Ein Jahr darauf stirbt, wiederum nach einer Frühgeburt, ein weiteres Kind, diesmal ein Junge. "Hätten diese beiden Leben die kritische Zeit sicher überstanden, würde es mich, die drei Jahre danach geboren wurde, nicht geben."
Als der Vater nach der dramatischen Geburt des ersten Mädchens nach Hause kommt, bleibt ihm nur, das Neugeborene zu begraben. Das Babyhemdchen - man sieht ein solches auch auf den Fotos im Band als Teil der Performance - wird zum Totenhemd, die Wickeltücher werden zu Leichentüchern.
Han Kangs Prosaminiaturen kreisen genau um diese Ambivalenz des Weißen als Symbol der Reinheit und zugleich als Ausdruck der Trauer und des Todes. Nicht nur zu Beerdigungen trägt man in Korea neben Schwarz auch Weiß. Han Kang beschreibt die Tradition, weiße Kleidung zu verbrennen im Glauben, die Verstorbenen würden sich in den dann aufziehenden Rauch kleiden. Vielleicht sollte man es also nicht Ambivalenz nennen, sondern das Vermögen zum Verschmelzen von Tod und Leben als Ineinandergreifen von Zerstörung und Neubeginn, das dem Weißen inhärent ist.
Eindrücklich in diesem Sinne wirkt auch der räumliche Rahmen, den Han Kang ihrem Schreiben gibt. "Weiße Stadt" nennt sie dessen Ort, der eigentliche Name der Stadt fällt nicht, aber augenscheinlich handelt es sich um Warschau - wo sich die Schriftstellerin dank eines Stipendiums aufgehalten hat. Am Anfang steht eine Art Initiationsritual: Die neu bezogene Wohnung wird komplett weiß gestrichen, bis hin zum Waschbecken und zu den auf der Wohnungstür eingravierten Zahlen. Tabula rasa.
In einer Gedenkstätte sieht die Erzählerin Luftbilder der von Hitler angeordneten Bombardierung Warschaus. Zu Beginn des Films, heißt es, wirke die Stadt weiß, wie verborgen unter einer mit Rußpartikeln gesprenkelten Schneedecke. Als das Flugzeug, das die Aufnahmen macht, an Höhe verliert, werden Einzelheiten sichtbar: "Die Stadt lag weder unter einer Schneedecke, noch gab es Verschmutzungen durch Ruß. Alle Gebäude waren im wahrsten Sinne des Wortes pulverisiert worden. Wohin das Auge auch blickte, überall waren weiß schimmernde Trümmerhaufen zu sehen, nur gelegentlich unterbrochen von den schwarzen Spuren des Brandes."
Diese zerstörte und wieder aufgebaute Stadt, in deren Getto die Menschen gegen die Repressionen des nationalsozialistischen Regimes aufbegehrten, eröffnet zudem eine weitere Ebene in Han Kangs poetischen Mediationen: die Frage nach den Ritualen und Praktiken der Trauer, individueller wie historischer. In Warschau manifestiert sich an den verbliebenen Fragmenten der Gettomauern das Gedenken der Nachgeborenen im öffentlichen Raum. Eine solche Manifestation ist auch dieses Buch, das seine Schönheit aus dem Zusammenspiel von Intimität, Verletzlichkeit und Universalität gewinnt.
WIEBKE POROMBKA
Han Kang: "Weiß".
Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee. Aufbau Verlag, Berlin 2020. 151 S., Abb., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Weiß" lautet der schlichte Titel von Han Kangs jüngst übersetztem Buch, das sich einer eindeutigen Gattungsbezeichnung entzieht - kurze Prosastücke, versetzt mit wenigen Fotos und Screenshots einer Performance. Eine Hand mit Salz ist darauf zu sehen oder eine Ansammlung weißer Federn. Der Schmerz und die Versehrtheit, die hier zur Sprache kommen, sind weniger sozial, sondern wohl autobiographisch grundiert - und vielleicht meint man gerade deshalb, diesen schmalen Band als eine Art Nukleus von Han Kangs Werk zu lesen, als dessen Kraftzentrum. "Weiß" ist eine Meditation über Trauer, eine poetische Installation über Verlust.
Am Anfang steht der beinahe lapidar formulierte Entschluss, über weiße Gegenstände zu schreiben, es folgt eine Liste: "Wickeltuch, Babyhemdchen, Salz, Schnee", die, endend mit dem "Totenhemd", einen Lebenszyklus zu umreißen scheint, ohne dass die namenlose Erzählerin bereits benennen kann, welche Bedeutung das Betrachten dieser Wörter haben könnte. "Sie würden in mir gedreht und gewendet werden und schließlich in Form von Sätzen herausvibrieren wie fremde, klagende oder schrille Töne, die der Geigenbogen einer Metallsaite entlockt."
In einer Hinsicht irrt die Erzählstimme: Schrill ist nichts an diesem Buch, vielmehr liegt über den großzügig gesetzten Seiten eine konzentrierte Stille, die längst nicht nur von den schneebedeckten Landschaften ausgeht, die Han Kang schildert. Auch die selbstgestellte Frage, ob es ihr gutes Recht sei, sich zwischen den Sätzen zu verstecken, erweist sich mit jedem neuen Prosastück mehr als gegenstandslos.
Das Konzept des Bandes mag experimentell anmuten und Weiß als Farbe der Avantgarde gelten - wie Friederike Mayröcker sie in ihrem jüngsten Proem "da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete" verschiedentlich aufruft. Weiß sind aber auch die Gipsabdrücke, die der Künstler in Han Kangs Roman "Deine kalten Hände" von Frauenkörpern anfertigt, und die leere Formen bleiben. "Weiß" als Buch hingegen ist von kristalliner Klarheit und Offenheit und dabei so zurückgenommen und zart wie der Ausdruck "weißes Lächeln", den es, so schreibt Han Kang, wohl nur in ihrer Muttersprache gebe. Der Ausdruck beschreibe ein Gesicht, "das ein Lächeln - einsam und versonnen - nur andeutet, verbunden mit zerbrechlicher Reinheit". Und weiter: "Wenn es überhaupt auf jemanden angewendet werden kann, dann auf dich, die du darum kämpfst, zu lachen, während du geduldig erträgst."
"Weiß" erzählt über die verstorbene Schwester der Erzählerin, die selbst gestaltlos bleibt, in diesem Fall aber offenkundig mit der Autorin in eins genommen werden kann. Es handelt von der Trauer über einen Verlust, der selbst nicht erfahren wurde, aber das eigene Dasein bestimmt. Und mehr noch: der die eigene Existenz vielleicht allererst ermöglicht hat. Wie vermisst man, was man nicht kannte?
Die Schwester war das erste Kind der Eltern und verstarb kurz nach der unerwarteten verfrühten Geburt - die Mutter war allein in einem abgelegenen Haus ohne erreichbare Hilfe, als die Fruchtblase platzte. "Meine Mutter hat mir erzählt, dass ihr erstes Kind zwei Stunden nach der Geburt gestorben ist. Es war ein Mädchen, mit einem Gesicht wie ein weißer, mondförmiger Reiskuchen." Wiederholt werden die Geburt und das kurze Augenaufschlagen des Neugeborenen aufgerufen, wie auch die flehenden Worte der Mutter: "Stirb nicht, bitte stirb nicht!" Eine Erzählung, die sich in die Kindheit der Erzählerin einschreiben wird. Ein Jahr darauf stirbt, wiederum nach einer Frühgeburt, ein weiteres Kind, diesmal ein Junge. "Hätten diese beiden Leben die kritische Zeit sicher überstanden, würde es mich, die drei Jahre danach geboren wurde, nicht geben."
Als der Vater nach der dramatischen Geburt des ersten Mädchens nach Hause kommt, bleibt ihm nur, das Neugeborene zu begraben. Das Babyhemdchen - man sieht ein solches auch auf den Fotos im Band als Teil der Performance - wird zum Totenhemd, die Wickeltücher werden zu Leichentüchern.
Han Kangs Prosaminiaturen kreisen genau um diese Ambivalenz des Weißen als Symbol der Reinheit und zugleich als Ausdruck der Trauer und des Todes. Nicht nur zu Beerdigungen trägt man in Korea neben Schwarz auch Weiß. Han Kang beschreibt die Tradition, weiße Kleidung zu verbrennen im Glauben, die Verstorbenen würden sich in den dann aufziehenden Rauch kleiden. Vielleicht sollte man es also nicht Ambivalenz nennen, sondern das Vermögen zum Verschmelzen von Tod und Leben als Ineinandergreifen von Zerstörung und Neubeginn, das dem Weißen inhärent ist.
Eindrücklich in diesem Sinne wirkt auch der räumliche Rahmen, den Han Kang ihrem Schreiben gibt. "Weiße Stadt" nennt sie dessen Ort, der eigentliche Name der Stadt fällt nicht, aber augenscheinlich handelt es sich um Warschau - wo sich die Schriftstellerin dank eines Stipendiums aufgehalten hat. Am Anfang steht eine Art Initiationsritual: Die neu bezogene Wohnung wird komplett weiß gestrichen, bis hin zum Waschbecken und zu den auf der Wohnungstür eingravierten Zahlen. Tabula rasa.
In einer Gedenkstätte sieht die Erzählerin Luftbilder der von Hitler angeordneten Bombardierung Warschaus. Zu Beginn des Films, heißt es, wirke die Stadt weiß, wie verborgen unter einer mit Rußpartikeln gesprenkelten Schneedecke. Als das Flugzeug, das die Aufnahmen macht, an Höhe verliert, werden Einzelheiten sichtbar: "Die Stadt lag weder unter einer Schneedecke, noch gab es Verschmutzungen durch Ruß. Alle Gebäude waren im wahrsten Sinne des Wortes pulverisiert worden. Wohin das Auge auch blickte, überall waren weiß schimmernde Trümmerhaufen zu sehen, nur gelegentlich unterbrochen von den schwarzen Spuren des Brandes."
Diese zerstörte und wieder aufgebaute Stadt, in deren Getto die Menschen gegen die Repressionen des nationalsozialistischen Regimes aufbegehrten, eröffnet zudem eine weitere Ebene in Han Kangs poetischen Mediationen: die Frage nach den Ritualen und Praktiken der Trauer, individueller wie historischer. In Warschau manifestiert sich an den verbliebenen Fragmenten der Gettomauern das Gedenken der Nachgeborenen im öffentlichen Raum. Eine solche Manifestation ist auch dieses Buch, das seine Schönheit aus dem Zusammenspiel von Intimität, Verletzlichkeit und Universalität gewinnt.
WIEBKE POROMBKA
Han Kang: "Weiß".
Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee. Aufbau Verlag, Berlin 2020. 151 S., Abb., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Ähnlich wie in einer Kunstausstellung präsentiert sie anschauliche Impressionen, die häufig als Metaphern verstanden werden können.« MDR 20201001
Gebundenes Buch
Eine zweiundzwandzigjährige junge Frau bringt in einer europäischen Hauptstadt ein Mädchen zur Welt. Das Kind kommt zwei Monate zu früh. Die junge Mutter durchtrennt die Nabelschnur selbst und das Kind lebt nur zwei Stunden, es stirbt in den Armen seiner Mutter.
Han Kang …
Mehr
Eine zweiundzwandzigjährige junge Frau bringt in einer europäischen Hauptstadt ein Mädchen zur Welt. Das Kind kommt zwei Monate zu früh. Die junge Mutter durchtrennt die Nabelschnur selbst und das Kind lebt nur zwei Stunden, es stirbt in den Armen seiner Mutter.
Han Kang schreibt über den frühen Tod ihrer Schwester. Es ist ein Buch voller Trauer, Abschied und Sehnsucht und mit jedem Satz spürt man ihren großen Verlust, der sich natürlich auch auf die ganze Familie auswirkte.
Der Schreibstil ist einfach großartig, tiefgründig, melancholisch, poetisch. Ein sehr persönliches Werk. Es gibt besondere Überschriften, die Han Kang mit Sicherheit sehr bewusst ausgewählt hat.
Dieser Roman ist eine Verarbeitung der Tragödie der Autorin, die bei einem Aufenthalt in dieser europäischen Hauptstadt von Erinnerungen an das Geschehene überwältigt wird.
Die Farbe weiß ist in Korea mit Trauer verbunden, so wie bei uns die Farbe schwarz. Daher heißt nicht nur der Roman "Wei?", sondern auch das Cover ist weiß und schlicht gehalten, mit einer weißen Feder behaftet. Einfach schlicht und wunderschön.
Dieser Roman hat mich sehr berührt, man spürt immer noch die tiefe Trauer und man leidet einfach mit. Man muss nicht mehr viel sagen, man muss dieses Buch einfach nur lesen, genießen und mitfühlen.
Fazit:
Ein sehr tiefgründiges, melancholisches Buch, das mich sehr berührt und mir sehr gut gefallen hat.
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die südkoreanische Schriftstellerin, die in koreanischer Literatur promoviert hat und am Kulturinstitut Seoul doziert, teilt diesen schmalen Roman in drei Kapitel auf: Ich, Sie und Alles weiß. Jedes Unterkapitel hat zusätzlich eine eigene kurze Bezeichnung erhalten, überwiegend …
Mehr
Die südkoreanische Schriftstellerin, die in koreanischer Literatur promoviert hat und am Kulturinstitut Seoul doziert, teilt diesen schmalen Roman in drei Kapitel auf: Ich, Sie und Alles weiß. Jedes Unterkapitel hat zusätzlich eine eigene kurze Bezeichnung erhalten, überwiegend besteht der Titel aus Dingen, die weiß sind oder etwas mit der Farbe weiß zu tun haben, wie zum Beispiel Mond und Schneeflocken. Die Unterkapitel wirken deswegen und wegen ihrer Kürze wie lange Gedichte, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Schließlich veröffentlicht die Autorin seit 1993 auch Gedichte. Auf diese Weise können einige Unterkapitel auch für sich, aus dem Kontext herausgenommen, gelesen und verstanden werden.
In der Geschichte verarbeitet die Protagonistin zwei Totgeburten ihrer Mutter, die vor ihrer eigenen Geburt geschahen. Dazu verlässt die Erzählerin im zweiten Kapitel die Ich-Perspektive und wechselt in die personale Erzählperspektive. Insbesondere der Tod des ersten Kindes ihrer Mutter beschäftigt die Erzählerin, hätte sie doch dann eine ältere Schwester gehabt und wäre nicht selbst die ältere Schwester für ihren jüngeren Bruder gewesen. Anlass für diesen Anflug von Melancholie und für das Nachdenken über die Gefühlswelt ihrer damals sehr jungen Mutter, die für sich und ihr Erstgeborenes keine Hilfe holen konnte, ist der Aufenthalt in einem verschneiten Ort weit entfernt von der Heimat Südkorea. Immer wieder zieht die Erzählerin Parallelen von diesem Ort zu ihrer eigenen Gefühlswelt.
Die weiße Gedankensammlung der Autorin liest sich sprachlich sehr gut. Der Satzbau ist weder zu kompliziert noch zu einfach, was sicherlich auch an der guten Übersetzung liegt. Die Geschichte kommt fast gänzlich ohne wörtliche Rede aus. Ab und an findet sich eine Frage an den Leser. Fehl- und Totgeburten sind noch immer Themen, über welche die Menschen nicht gerne sprechen. Dabei kommen sie noch heute vor und häufiger als wir denken. Die gewählte Sicht des Geschwisterkindes, das einen weiteren Bruder oder eine weitere Schwester haben könnte, eignet sich dafür, dass sich nicht nur Frauen, sondern sehr gut auch Männer in die besondere Situation hineinversetzen können. Die Autorin bleibt jedoch nicht bei der Darstellung nur von Gefühlen stehen, sondern hat ihre Erzählung mit kleineren weiteren Geschichten rund um die Erzählerin angereichert. Dadurch vermeidet sie, dass das Buch ins Philosophische abdriftet oder kitschig wird.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für