In vier Handlungssträngen widmet sich Griffith der Intoleranz von Menschen und den daraus resultierenden Konsequenzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Geschichte. Ob in Babel 539 v. Chr., in Jerusalem um 30 n. Chr., zur Zeit der Renaissance oder in den USA um 1910 - immer bestimmen Vorurteile das menschliche Handeln.
Bonusmaterial
Beil.: Booklet
David Wark Griffith und der Geist der Intoleranz
D. W. Griffith: "The Birth of a Nation", "Intolerance".
absolut Medien. 187 bzw. 181 Minuten. Englische Zwischen- und deutsche Untertitel. Booklet.
In den letzten Tagen ist verschiedentlich bemerkt worden, dass mit der Wahl von Barack Obama die Wirklichkeit zur populären Kultur aufgeschlossen habe - in Romanen und Filmen, bei Chester Himes und in "24" war ein schwarzer Präsident schon vorgedacht gewesen. Dabei fällt häufig unter den Tisch, dass es auch eine lange Film- und Fiktionsgeschichte der Angst vor afroamerikanischer Partizipation gibt. Passenderweise ist in Deutschland just dieser Tage eine der anstößigsten rassistischen Urkunden des Kinos auf DVD erschienen: "The Birth of a Nation" (1915) von D. W. Griffith ist tatsächlich so etwas wie eine Legitimationserzählung für die fortdauernde Herrschaft der weißen Patrizier in einem Land, das im neunzehnten Jahrhundert einen grausamen Krieg für die Abschaffung der Sklaverei geführt hatte.
Der Film, ein dreistündiges Epos, wurde lange Zeit als eine Pioniertat des Kinos gesehen, der Regisseur als epochemachender Entwickler der Filmsprache, bis im Lauf der Zeit formale Ideen wie die Parallelmontage wieder hinter dem prekären Inhalt zurückstehen mussten. Denn Griffith erzählte in "The Birth of a Nation" - ausgehend von dem Roman "The Clansman" (1905) von Thomas Dixon - nicht so sehr von der Geburt der amerikanischen Nation aus dem Geist der Versöhnung nach dem Bürgerkrieg, sondern vornehmlich von der Wiedergeburt des amerikanischen Südens nach dem Chaos, das die Sklavenbefreiung angerichtet hat. Er diskreditierte radikale Abolitionisten und feierte den Ku-Klux-Klan als eine Bewegung neuer Kreuzritter.
Dabei verband er, wie schon Thomas Dixon, so geschickt die Ebenen der großen Politik mit den individuellen Liebesgeschichten zwischen zwei Familien, dass die Nation selbst gewissermaßen einen (weiblichen) Körper bekam, dessen Unschuld und Ehre auf dem Spiel stehen. "The Birth of a Nation" besteht aus zwei Teilen, von denen der erste eine relativ konventionelle Nacherzählung des Bürgerkriegs bis zum Attentat auf Präsident Lincoln ist, während der zweite Teil viel stärker auf das Feld der Kolportage und der Mythologie ausholt. Griffith machte an wichtigen Stellen immer wieder deutlich, dass er seinen Film als eine "historical presentation" verstand, als ein "facsimile", das sich auf Vorlagen aus der Literatur, der Malerei und der Fotografie bezog. Vor allem wichtige Szenen mit Abraham Lincoln sind ikonisch gestaltet, das Kino reihte sich in eine schon etablierte Bildtradition und stellte Momente nach, deren Überlieferung schon keine Alternativen mehr zuließ.
Damit aber schaffte Griffith erst die Grundlage, auf der die wilde Imagination des zweiten Teils so skandalös werden musste. Denn hier wird die "reconstruction" der amerikanischen Nation nach dem Krieg de facto zu einer "deconstruction", zu einer "verkehrten Welt", in der die ehemaligen Sklaven auf den Bänken des Parlaments von South Carolina sitzen (die nackten Füße flegelhaft auf dem Tisch!), während die Weißen vom Besucherbalkon aus zusehen müssen, wie nun Politik gemacht wird. Es sind nicht zuletzt diese wie nebenbei hingeworfenen rassistischen Charakterisierungen der Afroamerikaner als unzivilisiert und impulsiv, mit denen Griffith sein Talent als Erzähler im neuen Medium des Films erwies, mit denen er sich aber auch vollständig unmöglich machte.
Bis heute streiten die Forscher darüber, was ihn dazu bewogen haben mag, sich dieses Stoffs anzunehmen. Kommerzielle Erwägungen standen sicher im Vordergrund. 1915 stand der fünfzigjährige Jahrestag der Kapitulation von General Lee und des Friedensschlusses im Bürgerkrieg an. Eine Vielzahl von historischen Paraden und Feierlichkeiten war zu erwarten, der Film sollte davon unmittelbar profitieren können. Als Sohn eines Offiziers der Konföderierten hatte der 1875 in Kentucky geborene David Wark Griffith auch einen starken persönlichen Bezug zur Sache des Südens. Vor allem aber scheinen künstlerische Überlegungen und Größenphantasien eine Rolle gespielt zu haben: "Hier sah ich eine Chance, eine Rettung in letzter Sekunde in ganz großem Stil zu inszenieren. Für dieses Mal würde der Ritt nicht einer kleinen, ländlichen Nell gelten, sondern der Rettung einer ganzen Nation."
Griffith bezog sich bei dieser Aussage auf ein erzählerisches Mittel, das er gewissermaßen für das Kino patentiert hatte: Gegen Ende der Handlung spitzt sich die Lage zu, gewöhnlich ist eine Gruppe in eine Hütte eingeschlossen oder sitzt in einer Feuersbrunst, die Flammen schlagen schon über den Opfern zusammen, während in Parallelmontage die Retter zu sehen sind, die ihren Pferden die Sporen geben oder in rasender Kutschenfahrt zum Ort der Gefahr eilen. In "The Birth of a Nation" ist es der Ku-Klux-Klan, der Elsie Stoneman (Lillian Gish), die Tochter eines einflussreichen Liberalen, aus einer besonders bedrohlichen Lage befreien muss: Sie hat von dem schwarzen Anführer Silas Lynch einen Heiratsantrag erhalten und steht kurz davor, zu einem Jawort gezwungen zu werden. Lynch, der, wie es damals üblich war, von dem schwarz geschminkten weißen Schauspieler George Siegmann verkörpert wurde, möchte ein "black empire" errichten - mit einer weißen Königin!
Dieser Radikalisierung der abolitionistischen Ideen begegnet die Mobilisierung von 400 000 Clansmen, denen die weißen Frauen des Südens in konspirativer Eintracht die Uniformen und Gesichtsmasken schneiderten, die den Ku-Klux-Klan in der kollektiven Phantasie und in der späteren Filmgeschichte so wirkmächtig werden ließen. Der "Little Colonel" Ben Cameron (Henry B. Walthall), eine der Heldenfiguren des Films, tränkt eine Südstaatenflagge mit dem Blut seiner Schwester, die sich vor den Nachstellungen eines streunenden ehemaligen Soldaten der Union namens Gus ("I'm a Captain now, I can marry you, Missie!") durch einen Sprung in den Tod gerettet hat.
Dieses starke Bild steht unmittelbar in einer Tradition der romantischen "chivalry", die nicht zuletzt in den Romanen von Walter Scott und in der schottischen nationalen Sache eine wichtige Inspirationsquelle gewann. In Wolfgang Schivelbuschs Buch "Die Kultur der Niederlage" kann man nachlesen, wie sich hier die Mythologien verschiedener "lost causes" überlagern - das Flammenkreuz der Highlanders wurde nach 1865 zum Symbol des Ku-Klux-Klans, und der schottische Rebell "Bonnie Prince Charlie" gewann in diesem Zusammenhang eine analoge Funktion wie die Legende von Kaiser Barbarossa im Kyffhäuser für die deutsche nationale Sache.
"The Birth of a Nation" hatte am 3. März 1915 in New York Premiere. Die Orchesterbegleitung bezog sich auf Lieder aus der Zeit, vor allem aber auf europäische Musik, in erster Linie prominente Opernmelodien. Den vollständigen Triumph bringt ein überliefertes Zitat von Präsident Woodrow Wilson auf den Punkt: "Es ist, als hätte man Geschichte mit Licht geschrieben. Und mein einziges Bedauern ist, dass alles so schrecklich wahr ist." Griffith selbst hatte im Film Wilsons "Geschichte des amerikanischen Volks" zitiert. Der Ku-Klux-Klan, so der passende Satz, diente der "self preservation" des weißen Mannes. Nichts weniger als ein Überlebenskampf der Weißen war also um 1870 im amerikanischen Süden im Gange, am Ende war die "defence of their Aryan birthright" auch erfolgreich, und es begann die Geschichte der Segregation, deren Folgen vergangene Woche in der Wahlnacht allenthalben noch zu verspüren waren.
David Wark Griffith brachte ein Jahr später mit weitgehend den gleichen Schauspielern das Epos "Intolerance" heraus, in dem er in vier Episoden - aus dem alten Babylon, aus der Zeit Jesu, aus der Epoche der Konfessionskriege in der frühen Neuzeit und aus der Gegenwart des frühen zwanzigsten Jahrhunderts - die Botschaft der Toleranz vertrat. "Der Kampf der Liebe im Lauf der Zeiten" war das Motto über einem Film, der vor allem als Ausstattungskunstwerk in Erinnerung geblieben ist. "Intolerance" - wie "Birth of a Nation" gerade auf DVD erschienen und mit einem instruktiven Booklet versehen - war kein vollständiger Flop, ließ sich aber mit den Vorführideen von Griffith kaum in Einklang bringen: Er liebte es, mit seinen Filmen (plus Orchester) auf Tournee zu gehen, und sie als große Spektakel zu präsentieren. In einer Zeit, in der die Filmindustrie schon die wesentlichen Grundlagen für die Rationalisierung des ganzen Geschäfts begriffen hatte, war dies ein Anachronismus. Und so kam es, dass einer der großen Pioniere des Kinos sich sehr schnell als überholt erwies. Griffith starb 1948 in Los Angeles, nachdem er zum Beispiel noch einen biographischen Tonfilm über Präsident Lincoln gedreht hatte.
Wenn Barack Obama vergangene Woche dann doch von einer großen Mehrheit vorbehaltlos gewählt werden konnte, dann auch deswegen, weil Angstphantasien wie die von einem "black empire", wie auch Griffith sie pflegte, inzwischen nur noch von radikalen Minderheiten vertreten werden. 1915 war dieser Standpunkt noch vollkommen mehrheitsfähig. Selbst der Präsident empfand ihn als wahrheitsgetreu.
BERT REBHANDL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

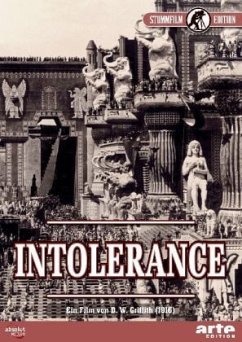
 FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG