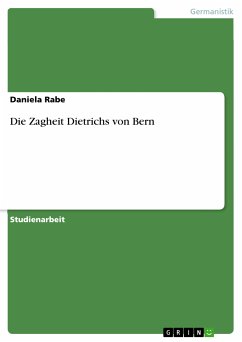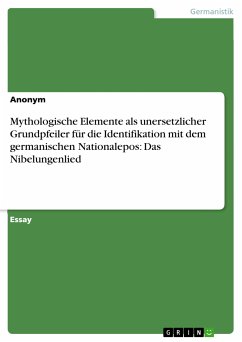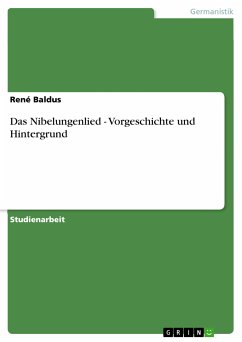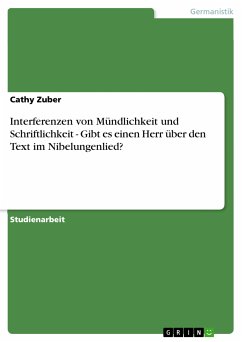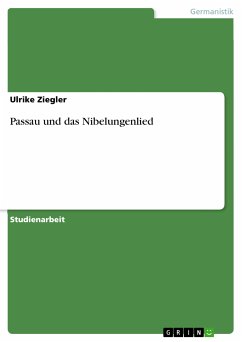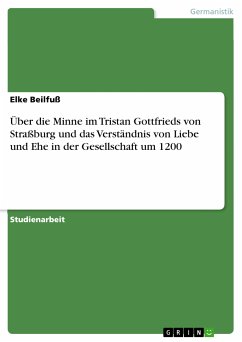Magisterarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 2,0, Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Mediävistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Schon während meiner Gymnasialzeit fand ich Gefallen an der großartig angelegten Geschichte des Nibelungenliedes über minne, êre, triuwe und Tod. Die Faszination, der ich damals erlegen bin, hat mich während meiner gesamten Studienzeit begleitet, so dass für mich klar war, dass ich mich auch in meiner Magisterarbeit mit dem Nibelungenlied auseinandersetzen wollte. Die Wahl des zweiten Werks fiel schnell auf den ´Laurin`, da einerseits das zweite zu untersuchende Werk in irgendeiner Weise mit dem Nibelungenlied in Verbindung stehen sollte und mit der Figur Dietrichs von Bern das Bindeglied zwischen den beiden Werken gegeben war. Andererseits reizte mich die Tatsache, zwei Werke zu untersuchen, die, was den Forschungsstand anbelangt, nicht unterschiedlicher sein könnten, denn während zum Nibelungenlied eine kaum mehr zu überblickende Fülle an Forschungsliteratur besteht, hält sich das Interesse am ´Laurin` deutlich in Grenzen. Sowohl im Nibelungenlied als auch im Zwerg Laurin stößt man auf Naturdarstellungen (unbewohnte Gebiete, dunkle Wälder), mythische Wesen (Zwerge, Drachen, Riesen) und sagenumwobene Gaben (Tarnkappe, Ring, Schwert, Hort), die alle eindeutig dem Bereich des Wilden, Unzivilisierten, Unhöfischen zuzuordnen sind. Beiden Werken ist ebenfalls gemein, dass sich Wildnis und Wildheit nicht nur in diesem außerhöfischen Bereich festmachen lassen, sondern auch Einlass in die höfischen Sphären finden: während sich wilde Gestalten wie der Zwerg Laurin in höfischer Vollendung präsentieren, legen höfisch anmutende Helden und Damen (z.B. Siegfried, Dietrich, Kriemhild) wildes, unhöfisches Verhalten an den Tag; während sich im wilden Wald Plätze verbergen (z.B. Rosengarten), die selbst am Hofe nicht gepflegter sein könnten, offenbaren sich höfische Feste, die als Inbegriff des höfischen Daseins gelten, lediglich als Kulisse für hinterlistige Intrigen und Mordanschläge oder verwandeln sich gar in allgemeine wilde, blutrünstige Schlachten. Wildnis bzw. Wildheit kennt also viele verschiedene Ausprägungen, die sich nicht alle eindeutig dem außerhöfischen Bereich zuordnen lassen. Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, in den beiden oben genannten Werken die unterschiedlichen Wildnisbzw. Wildheitsdarstellungen aufzuzeigen. [...]