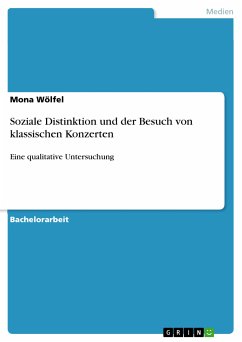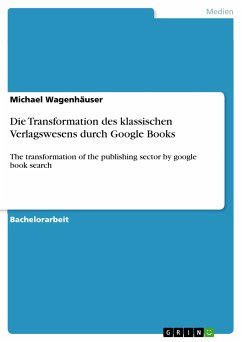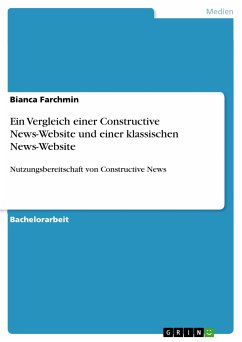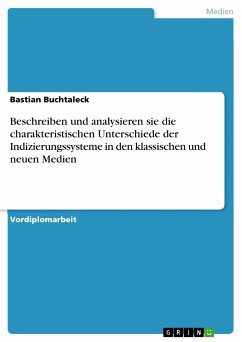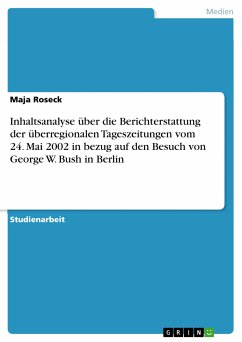Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Medienökonomie, -management, Note: 1,7, Hochschule für Musik und Theater Hannover (Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit soll sich mit den musikfremden Motiven eines Konzertbesuchs beschäftigen. Wer sind die Personen, die sich in Konzerthäusern zu einer Gesellschaft zusammenfinden, welche Rituale gehen mit einem Konzertabend einher und welche Rolle spielen der Prestigegewinn, das ‚sehen und gesehen werden’ und der Wunsch, einer auserlesenen Musikhörerschaft anzugehören für Besucher? Inwiefern dient das klassische Konzert der gesellschaftlichen Abgrenzung, der Distinktion? Das klassische Konzert, wie wir es heute kennen, besteht seit dem Ende des 19. Jahrhunderts beinahe unverändert. Konventionen und Rituale, die mit einem Konzertbesuch einhergehen wie elegante Kleidung, gepflegte Konversation im Foyer bei einem Glas Wein und vollkommen konzentrierte Musikrezeption, die allenfalls vom Husten des Sitznachbarn unterbrochen wird, all jene Aspekte lassen das musikalische Ereignis veraltet, angestaubt und wenig zeitgemäß wirken. Trotz alledem hat die klassische Musik nach wie vor viele Liebhaber, die gerne regelmäßig ins Konzert gehen. Würdevoll anmutende Konzerthäuser sind heutzutage genau wie vor 150 Jahren Treffpunkt bestimmter gesellschaftlicher Schichten, die sich zwar auch, aber nicht nur durch ihren gemeinsamen Musikgeschmack auszeichnen. Einer elitären Hörerschaft anzugehören, ‚sehen und gesehen werden’ und Prestigegewinn können ebenso Motive für den Konzertbesuch sein wie der Wunsch nach zwei Stunden exquisitem Musikgenuss. Doch warum eignet sich die Praxis des öffentlichen Musikgenusses so gut zur sozialen Abgrenzung? Wie kommt es, dass der Besuch eines klassischen Konzerts eine solch stark distinguierende Wirkung mit sich bringen kann? Diese Fragen werden mit Bezug auf Bourdieus Konzept des Habitus und der Distinktion theoretisch hergeleitet. Mithilfe einer qualitativen Studie wird ein Versuch unternommen, Dimensionen der Abgrenzung in Bezug auf das Klassikkonzert herzuleiten. Aus zehn durchgeführten Leitfadeninterviews werden unter anderem Informationen darüber gewonnen, welchen Konzertritualen die fragliche Klientel folgt, um sich abzugrenzen, welche Rolle dabei ein bestimmter Verhaltenskodex spielt, inwiefern der Klassikgenuss mit Bildung einhergeht und welche Hürden zu überwinden sind, bevor eine Person Teil der geschlossenen Konzertgesellschaft werden kann.