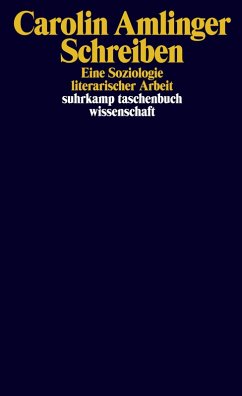Das Ende der Buchkultur ist nicht zu befürchten - wie Bücher gemacht werden, wandelt sich indessen. Mit dem Augenmerk auf die jüngere Geschichte des Buchmarktes leistet Carolin Amlinger eine umfassende Bestandsaufnahme ästhetischer Ökonomien, die auch einen Blick in die Zukunft des Buchgeschäfts erlaubt. Gleichzeitig verdichtet die Studie die vielfältigen Arbeits- und Lebenswelten von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren zu einer fesselnden soziologischen Analyse, die nahezu alle Facetten der Arbeit mit dem geschriebenen Wort beleuchtet. Ein Buch, das uns die Welt des Büchermachens erschließt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Berufung, nicht Beruf: Carolin Amlinger leistet soziologische Aufklärung in Form einer dichten Beschreibung des Literaturbetriebs.
Von Niels Werber
Auf den Visitenkarten von Romanciers finden sich Bezeichnungen wie "Ernst Jünger cand. zool., Ltn. a. D." oder "Dr. phil. Robert Musil". Die Angabe "Berufsschriftsteller" oder heute "Diplom-Schriftsteller:in" scheint unüblich zu sein, obschon Studiengänge entsprechende Zertifikate verleihen. Auch die "18 Autor:innen aus Deutschland zwischen 32 und 62 Jahren", mit denen Carolin Amlinger Interviews geführt hat, um zu verstehen, wie sie arbeiten und "welchen Sinn sie ihrer Arbeit zuschreiben", erleben ihre Tätigkeit weniger als einen "durch zweckrationale Kalküle bestimmten Beruf", mit dem Geld verdient würde, "sondern als innere Berufung", der sie "um ihrer selbst willen" folgen. Ein Diplom macht niemanden zum Autor. Ein festes Einkommen auch nicht.
Warum eigentlich nicht? Ist denn das literarische Werk etwa keine Ware, die in Heimarbeit hergestellt und als Halbfabrikat an einen Verlag verkauft wird, der es druckt, vertreibt und bewirbt? Es gehört zum Kernbestand der Erwartungen, die unsere Gesellschaft ihren Mitgliedern ermöglicht, aus einem Angebot von Waren wählen zu können, zu dem auch Bücher gehören. Aber Literatur will mehr als eine Ware sein, nämlich Kunst, die um ihrer selbst willen geschaffen und um ihrer selbst willen rezipiert wird. Diese soziale Disposition des literarischen Feldes, die Amlinger beschreibt, ist alt, aber wirkungsmächtig. Personen, die "Heftromane" oder "Genreliteratur" gegen festes Entgelt nach "Produktionsrichtlinien" fabrizieren, gelten nicht als Schöpfer eines Werks, obschon sie Texte schreiben, die gedruckt und gelesen werden, und dies sogar in großer Zahl. Dass Autoren diese Brotarbeit unter Pseudonym verrichten, um ihren guten Namen zu schützen, legt ein Problem moderner Autorschaft offen, das Amlinger in ihrer Feldforschung herausarbeitet: Das Schreiben literarischer Texte prekarisiert.
Die Ansprüche, die die Schriftsteller an sich selber stellen, stehen einer Professionalisierung ihres Berufs genauso im Weg wie die Überzeugung des "Literaturbetriebs", die Produktion von Werken sei das im Einzelfall zufällige, insgesamt aber doch erwartbare Ergebnis individueller Kreativitätsschübe. Auf die Idee, Autoren fest einzustellen, zu versichern, im Krankheitsfall und Urlaub ein Gehalt zu zahlen, ist noch kein Literaturverlag gekommen, jene "Fabriken" ausgenommen, in denen "Massenware" produziert wird.
Die Urheber, die so glücklich sind, in ihrer vollkommenen Freiheit von allen Zwängen moderner Berufsausübung ein Werk vollendet und an einen Verlag verkauft zu haben, dürfen sich stattdessen über ein "Honorar" freuen, eine Ehrengabe also, die der Wertschätzung für ihre Berufung geschuldet ist und nicht der Arbeit, die die Autoren in ihr Schreiben investiert haben. Wer will schon von Stundenlöhnen sprechen, wenn ein Werk entsteht? Die Illusionen von Zweckfreiheit und Autonomie haben die Produktionsbedingungen so erfolgreich invisibilisiert, dass die interviewten Autoren viel auf sich nehmen und ihrem Umfeld viel zumuten, um im Schreiben das zu tun, was sie als Mensch ganz und gar definiert, und das heißt: trotz allem ihr nächstes Werk zu schaffen. Kein Wunder, dass sich die meisten Schriftsteller wie vor hundert Jahren von Job zu Job, von Honorar zu Honorar, von Preis zu Preis hangeln, wenn sie ihr Tun als existenziellen Vorgang fassen, in dessen "Vollzugsgeschehen" sie zugleich aufgehen und sich selbst erst hervorbringen. "Ich muss schreiben", gibt eine Autorin zu Protokoll, sie hätte auch "ich muss leben" sagen können.
Wie die Konzeption des Buches als Ware und Werk ist auch die Konzeption des Schriftstellers voller "metaphysischer Spitzfindigkeiten und theologischer Mucken" (Karl Marx). Das "Gebrauchswertversprechen", das dem Käufer suggeriert, er erwerbe ein "ästhetisches Werk mit besonderen Qualitäten", wird von der Fiktion des begabten, berufenen oder doch besonderen Autors gedeckt, der dieses Werk nicht als Ware für den Markt hergestellt habe, sondern gerade im selbstbezüglichen, quälenden wie befreienden Schreiben ein "Kulturgut" schafft, ja schaffen musste, das genauso einzigartig ist wie der Prozess, aus dem es hervorgeht. Aus Sicht der Soziologin lässt sich dies nüchtern als "Distinktionsstrategie" fassen, an deren Erfolg die Verlage und Agenten, Kritiker und Literaturwissenschaftler kräftig mitwirken, um die Antinomien dieser ästhetischen Ökonomie zu bewirtschaften.
Zur soziologischen Aufklärung, die Amlinger betreibt, gehört es, das Milieu und die Medien, die Organisationen und Rechtsformen in den Blick zu nehmen, ohne die weder dieses Verständnis von Autorschaft noch diese Konzeption des Werkes denkbar wären. Ihre Soziologie des Schreibens nimmt all die Praktiken ins Visier, die mit diesen Möglichkeitsbedingungen zurechtkommen müssen, um die Regale mit 'wertvollen Werken' zu füllen, deren Ladenpreis nichts bedeuten darf für ihren kulturellen Rang und deren Urheber statt auf festes Gehalt auf Reputationsgewinne setzen, vom Stipendium zum Buchpreis, von der großartigen Rezension bis zur gefeierten Lesereise.
Zwar ist der Markterfolg einiger Bestsellerautoren so überwältigend, dass der Hinweis auf die schiere Zahl der Rezipienten jede Diskussion über den ästhetischen Wert des Werks erstickt, aber solange die Unterscheidung von Beruf und Berufung so fest etabliert ist, wie die dichten Beschreibungen der Interviews und Hintergrundgespräche mit wichtigen Akteuren des Literaturbetriebs zeigen, wird sich daran nichts ändern. Schreiben wird weiter beglücken und frustrieren, und zwar die Schreibenden wie die Lesenden, unabhängig vom später erzielten Honorar und losgelöst vom für den Erwerb des Buches bezahlten Preis.
1934 hat Walter Benjamin die Sonderbarkeit von "Produzenten" beschrieben, die irrigerweise darauf bestehen, keine Ware anzufertigen, sondern eine Schöpfung hervorzubringen, keine Zwecke zu verfolgen, sondern die "Autonomie des Dichters" auszuleben, zu "dichten, was er eben wolle". Dies sei falsch, es gelte, die "isolierten Dinge: Werk, Roman, Buch" in "die lebendigen gesellschaftlichen Zusammenhänge" zu stellen. Dieser Devise ist Amlinger gefolgt: "Literarisches Arbeiten wird hier als eine soziale Tätigkeit interpretiert, die sich nicht losgelöst von den gesellschaftlichen Beziehungen und Strukturen, in die sie eingebettet ist, erschließen lässt." Was Schreiben, dieses Arbeiten ohne Arbeitszeiten, diese Produktion, die ihre Produktionsbedingungen verleugnet, indem sie ihre Produkte als Schöpfungen sakralisiert, heute ausmacht, lässt sich bei ihr nachlesen. Und dies wird nicht nur aus der Sicht der einen oder anderen soziologischen Theorie deduziert und an ein paar Beispielen illustriert, sondern aus der Feldforschung kondensiert. Dies ist keine armchair sociology, deren Realitätskontakt in Zeitungslektüren aufgeht, sondern qualitative Soziologie. Wenn Bücher als Visitenkarten ihrer Autoren fungieren, dann darf die Dissertationsschrift der Literatursoziologin Carolin Amlinger als Empfehlung gelten.
Carolin Amlinger: "Schreiben". Eine Soziologie literarischer Arbeit.
Suhrkamp Verlag Berlin 2021. 800 S., br., 32,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Rezensent Jörg Plath zeigt sich beeindruckt von der "Fülle der Befunde" und der klugen Methodik, mit der Carolin Amlinger sie gewinnt und der leicht verständlichen Art, mit der diese Befunde präsentiert werden. Amlingers umfangreiche soziologische Studie, so Plath, besteht aus drei Teilen, in denen verschiedene Dimensionen des Schreibens beleuchtet werden. Dabei arbeitet sie präzise und anschaulich das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum in Bezug auf die Schreibpraxis heraus, welches sich vor allem im Widerspruch zeigt zwischen der Vorstellung von der Autonomie künstlerischen Schaffens auf der einen und der Warenform des Buches auf der anderen Seite, so Plath. Dass Amlinger andere als kulturelle Einflussfaktoren eher vernachlässigt, kann der Rezensent ihr leicht verzeihen angesichts der 800 Seiten, die Amlinger schon ohnedies zu füllen weiß.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Carolin Amlinger schlüsselt eindrucksvoll die Widersprüchlichkeiten des modernen Literaturbetriebs und Schriftstellerlebens auf
2018 sorgte eine Studie des Börsenvereins des deutschen Buchhandels für Aufregung. Dem Markt waren rund sechs Millionen Buchkäufer abhanden gekommen. In der Berichterstattung wurde aus der Krise des Buchverkaufs sehr schnell die Krise des Lesens. Zum Untergang des Abendlandes war es nicht mehr weit. Sogar Bundespräsident Steinmeier warnte, „wenn wir aufhören zu lesen, und damit meine ich, richtige Bücher zu lesen, und wenn die Schriftsteller aufhören zu schreiben, dann würde für unsere Suche danach, wer wir sind und wer wir sein wollen, etwas ganz Entscheidendes fehlen“. Ein guter Leser zu sein, bedeutet aus dieser Perspektive, in „richtigen Büchern“ zu lesen, und nur wer „richtige Bücher“ schreibt, ist ein wahrer Schriftsteller.
Genau das aber können Autoren von sich aus nicht leisten. Sie schreiben Texte. Wenn daraus das Kultobjekt „Buch“ werden soll, müssen sie an einem hochkomplexen sozialen Spiel teilnehmen. Carolin Amlinger hat nun aus literatursoziologischer Perspektive entschlüsselt, wie sich die Taktiken und Strategien dieses Spiels in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben. Es erinnert ein wenig an den Fußball: Im Vergleich einer Partie der 1970er-Jahre mit aktuellen Austragungen erkennt man das Spiel mühelos wieder. Die Akteure sind seitdem jedoch so viel schneller geworden, der Bewegungsablauf hat so an Dynamik gewonnen und der Saisonbetrieb geht so an die Substanz, dass heutzutage selbst die Stars von damals mit ihrer Spielweise in jeder Hinsicht alt aussähen. Der ganze Betrieb steht unter enormem Druck, der Abstand zwischen den konkurrenzfähigen Akteuren und dem Rest hat im globalen Wettbewerb gewaltig zugenommen. Und obwohl es sich offenkundig um ein großes Geschäft handelt, tun die Fans so, als ginge es um etwas ganz anderes: um echte, authentische Erlebnisse, die man benötigt wie die Luft zum Atmen.
In den 1990er-Jahren konzentrierte sich das Verlagswesen in internationalen Konzernen, für die kurzfristige Renditeerwartung zum Alltag zählten, egal um welche Güter auch immer es sich handelte. Die Umschlagzeiten für Bücher wurden kürzer, die Fokussierung auf Spitzentitel größer. Bei den Autoren setzte sich der Trend zur Professionalisierung fort. Studiengänge in Leipzig und Hildesheim machten Ausbildungsangebote. Agenturen versprachen, wie es auf der Homepage von „Graf & Graf“ heißt, „die Kreativität von Autor*innen mit den sich verändernden und wachsenden Anforderungen des Buchmarktes erfolgreich in Einklang zu bringen“.
Betrachtet man rückblickend die Geschichte der Literaturdebatten in den 1990er-Jahren, dann frappiert der ikarische Absturz des hohen Tons: Zu Beginn wurde im „deutsch-deutschen Literaturstreit“ um Christa Wolf die gesamtgesellschaftliche Verantwortung des Schriftstellers und das Verhältnis von Ästhetik und Politik debattiert. Am Ende des Jahrzehnts bekannte man sich im gehobenen Feuilleton offen zum erfolgreichen, unterhaltsamen und konsumentenfreundlichen Bestseller und plauderte munter über hohe Vorschüsse und Verkaufszahlen ab 30 000 Exemplaren, als handle es sich dabei um ein valides Zeichen für den guten Zustand der deutschen Gegenwartsliteratur.
Dann aber erschütterte die Digitalisierung den literarischen Markt und die Öffentlichkeit. Neue Medien und Mediengebrauchsformen, Produktions- und Vertriebsmöglichkeiten machten dem buchzentrierten Literaturbetrieb zu schaffen. Diese geläufige Diagnostik ist gewiss richtig. Man muss aber auch sehen, dass das Buch nicht zufällig das erste Objekt war, an dem der digitale Kapitalismus seine Möglichkeiten ausprobierte. Nachdem Jeff Bezos 1994 bei einem der aufregendsten Hedgefonds der Wall Street gekündigt hatte, um Amazon zu gründen, übervorteilte er seine Konkurrenten im Buchhandel einerseits durch seine unvorstellbare Bereitschaft dazu, sein Unternehmen zu verschulden, um vom Marktteilnehmer zum Marktbesitzer zu werden. Andererseits erkannte er in den zwei Seiten des Buchs genau die Eigenschaften, die aus der Konsumkrise der industriellen Moderne führen sollten: Beim Buch handelte es sich um ein hochgradig standardisiertes Objekt, dass sich massenhaft herstellen, gut lagern und leicht verschicken ließ. Zugleich versprach das Buch Singularität und individuelle Erlebnisbefriedigung.
Im Hintergrund entstand so in den Amazon-Lagerhallen und im Lieferverkehr ein Ausbeutungsbetrieb, der sich perfekt in prekäre Arbeitsverhältnisse einnistete und alle Chancen des Neoliberalismus nutzte. Auf der Schauseite stellte Bezos dagegen Kundenzufriedenheit an oberste Stelle, und seine Lieblingsabteilung „Personalization and Community“ erzeugte eine Aura des Miteinanders für alle. Auch hier gilt: Das eine funktionierte nicht ohne das andere. Diese Zweiseitigkeit des Sozialen ist im Übrigen aufschlussreich für die aktuellen Debatten um die Frage, ob der kultursoziologische Ansatz von Andreas Reckwitz milieuspezifische Befunde zu schnell zur „Gesellschaft der Singularitäten“ hochrechnet und dabei stabile hierarchische Gesellschaftsstrukturen unterschätzt. Blickt man auf Amazon als Paradebeispiel des digitalen Kapitalismus, dürfte sich erst aus der Zusammenschau der konkurrierenden Perspektiven ein angemessenes Bild des Sozialen ergeben.
Es zählt zu den Vorzügen von Carolin Amlingers Studie, dass sie solche Vexierblicke provoziert. Sie analysiert sehr viel mehr als die „verschlungenen sozialen Wege“, auf denen „Autor:innen“ werden, „was sie sind“. Die Dissertation umfasst eigentlich gleich mehrere Bücher in einem: Es handelt sich auf den ersten 300 Seiten um eine Geschichte des Buchhandels in drei Längsschnitten vom 19. Jahrhundert bis in die unmittelbare Gegenwart der Corona-Phase; dann um eine Feldstudie zum aktuellen Literaturbetrieb; und schließlich um eine grundlegende Erkundung der ebenso unauflöslichen wie spannungsvollen Verschlingung von Ästhetik und Ökonomie im Konzept moderner Autorschaft. Dass sich diese drei Mammutprojekte selbst auf rund 800 Seiten nicht ohne verkürzende Aussagen über „die“ Literatur und „den“ Autor realisieren lassen, liegt auf der Hand. Entscheidend ist aber, dass nur die longue durée, verbunden mit dem Blick auf konkrete Praktiken und einer Analyse der Feldstrukturen, verständlich macht, was „literarisches Schreiben“ eigentlich bedeutet.
Zu den erstaunlichsten Befunden zählt dabei, wie sehr die interviewten Autorinnen und Autoren ihr Selbstbild noch immer an einem ganz traditionellen Konzept literarischer Kreativität orientieren: Schreiben bedeutet für sie eine Berufung, der sie nachgehen müssen, um ganz „sie selbst“ zu sein und sich entfalten zu können. Dieses Stereotyp kollidiert offenkundig an allen Ecken und Enden mit den tatsächlichen Zwängen, unter denen Schreibende stehen, mit der Unsicherheit der Arbeitsverhältnisse und der Gemachtheit und Geschäftigkeit des Literaturbetriebs. Autorschaft kommt eben nicht naturgemäß von innen heraus, sondern benötigt Gelegenheiten und Vorbilder. Im Austausch mit Gleichgesinnten, also mit potenziellen Konkurrenten, verstehen Verfasser in Schreibkursen, -werkstätten und Literaturinstituten allmählich, was sie wollen könnten und sollten. Und wenn es gut läuft, findet sich dann ein Verlag, der ihnen sagt, worauf es tatsächlich ankommt. In einem wiederum spannungsvollen Aushandlungsprozess zwischen Autor, Lektorat, Herstellung, Marketing und Vertrieb werden dabei ästhetische und ökonomische sowie – in jüngerer Zeit verstärkt – politische Ansprüche vermittelt.
Auch dem Produktionsensemble der Verlagsarbeit gelingt die aufwendige Erzeugung von „Literatur“ jedoch nur im Rahmen eines noch größeren Kollektivs: Durch den gesamten Literaturbetrieb wird das Buch normativ vorbelastet. Bildungseinrichtungen, Buchhandlungen, Feuilletonredaktionen, Buchblogs, Bibliotheken, Literaturhäuser, Festivals oder – wie gerade eben – Buchmessen und Literaturpreisjurys erinnern permanent daran, dass es sich um ein besonderes und wertvolles Gut handelt, um das man sich zu kümmern hat.
Diese Erinnerung verblasst jedoch immer mehr, und dies könnte Amlinger zufolge nun gerade daran liegen, dass sich literarische Arbeitsverhältnisse in vielen Hinsichten als prototypisch erwiesen haben. Prekäre Entlohnung verbunden mit der Erwartung hoher Einsatzbereitschaft, die Vermengung von Privat- und Berufsleben mit entgrenzten Arbeitszeiten, projektförmige Engagements mit dem Versprechen kreativer Selbstverwirklichung – all das ist inzwischen so normal geworden, „dass das normative Fundament, der Schriftstellerberuf sei eine Erwerbstätigkeit besonderer Art, erodiert“. So endet Amlingers Studie mit einer Warnung: „Die mühsam errungene Autonomie der Literatur“ ist „keine unumstößliche Tatsache“. Wenn wir sie erhalten wollten, müssten wir etwas dafür tun.
STEFFEN MARTUS
Das Buch war nicht zufällig das
erste Objekt, an dem der digitale
Kapitalismus rumprobierte
Die mühsam errungende
Autonomie der Literatur ist
nicht unumstößlich
Carolin Amlinger:
Schreiben. Eine
Soziologie literarischer Arbeit. Suhrkamp,
Berlin 2021,
787 Seiten, 32 Euro.
Das Wort als Ware: Buchhandlung in Shaoyang, China.
Foto: imago images/VCG
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»[Das Interview-Vorgehen] macht Amlingers Schreiben zu einem ... gut lesbaren Buch. ... Dabei beeindruckt die Umfasstheit von Amlingers Schreiben ...« Gerrit Bartels Der Tagesspiegel 20211221