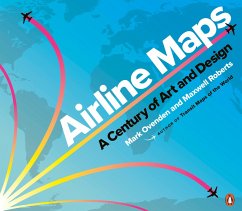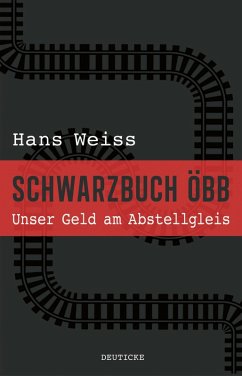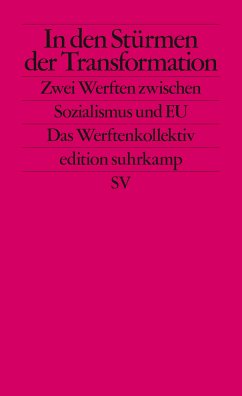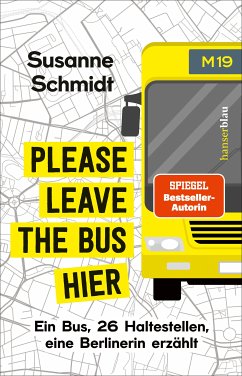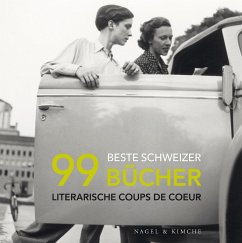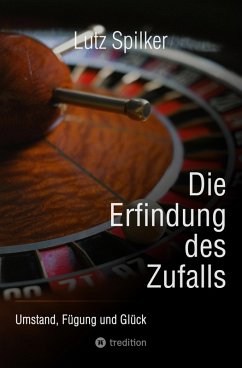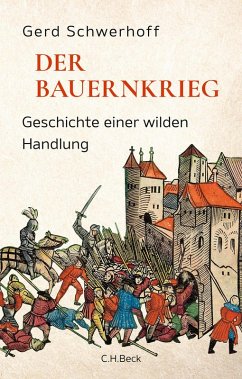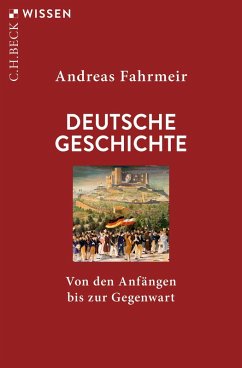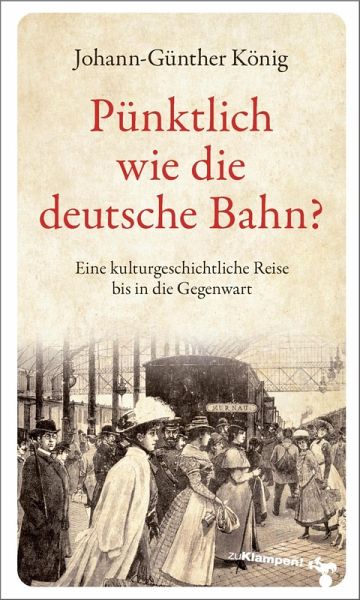
Johann-Günther König
eBook, ePUB
Pünktlich wie die deutsche Bahn? (eBook, ePUB)
Eine kulturgeschichtliche Reise bis in die Gegenwart

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Ab 1835 entwickelte sich die Eisenbahn in Deutschland zu einem unverzichtbaren Verkehrsmittel. Sie blieb es bis zu Beginn der 1960er Jahre, als die Massenmotorisierung die »gute alte Zeit« der Eisenbahn beendete. Ihr Anteil im Personenverkehr ist seitdem auf nicht einmal ein Zehntel geschrumpft. Inzwischen konkurriert sie zudem mehr schlecht als recht mit Billigfliegern und Fernbussen und kann mangels politischer Weichenstellungen ihre System- und Umweltvorteile nicht ausspielen. Johann-Günther König erzählt die Geschichte der zunehmend krisenhaften Beziehung von Mensch, Politik und Eisen...
Ab 1835 entwickelte sich die Eisenbahn in Deutschland zu einem unverzichtbaren Verkehrsmittel. Sie blieb es bis zu Beginn der 1960er Jahre, als die Massenmotorisierung die »gute alte Zeit« der Eisenbahn beendete. Ihr Anteil im Personenverkehr ist seitdem auf nicht einmal ein Zehntel geschrumpft. Inzwischen konkurriert sie zudem mehr schlecht als recht mit Billigfliegern und Fernbussen und kann mangels politischer Weichenstellungen ihre System- und Umweltvorteile nicht ausspielen. Johann-Günther König erzählt die Geschichte der zunehmend krisenhaften Beziehung von Mensch, Politik und Eisenbahn. Dabei ist Kritik an der Bahn nicht erst ein heutiges Phänomen. Bereits 1836 hieß es etwa: »Der Tritt zum Wagen ist zu hoch, um auf und ab zu gehen.« Gegenwärtig sind es nicht nur Verspätungen, Zugausfälle und Betriebsstörungen aller Art, die den den Ruf des Marktführers Deutsche Bahn schädigen. König zeigt die Probleme und Möglichkeiten des immer komplexeren Eisenbahngeschehens auf und fragt, wie und inwieweit überhaupt noch die Weichen für einen Neuanfang gestellt werden können.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Johann-Günther König, Jahrgang 1952, verfasst als freier Autor überwiegend Werke zu kulturhistorischen, politökonomischen und Themen rund um seine Heimatstadt Bremen. Bei zu Klampen sind von ihm »Die Autokrise« (2009) und »Das große Geschäft. Eine kleine Geschichte der menschlichen Notdurft« (2015) erschienen.
Produktdetails
- Verlag: zu Klampen Verlag
- Seitenzahl: 224
- Erscheinungstermin: 30. August 2018
- Deutsch
- ISBN-13: 9783866747128
- Artikelnr.: 53198968
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.07.2018
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.07.2018Höchste Eisenbahn
Heute in geänderter Wagenreihung: Die Deutsche Bahn ist auch deshalb so marode, weil sie von der Politik seit Jahrzehnten systematisch im Stich gelassen wird. Wie das kam und wohin das führt, zeigt Johann-Günther König überzeugend.
Sind wir nicht ein Volk von Bahnfahrern? Wenn's so wäre, hätte dieses Buch nicht geschrieben werden müssen, das sich in zweifach irreführender Weise als "kulturgeschichtliche Reise" im Untertitel und mit einem historischen Foto vom Münchner Hauptbahnhof in einem mittlerweile in die Jahre gekommenen Genre verortet. Eine Kulturgeschichte des Bahnfahrens, das ist "Pünktlich wie die deutsche Bahn?" auch. Mit allem, was dazugehört an Nostalgie, Wirtschaftsgeschichte,
Heute in geänderter Wagenreihung: Die Deutsche Bahn ist auch deshalb so marode, weil sie von der Politik seit Jahrzehnten systematisch im Stich gelassen wird. Wie das kam und wohin das führt, zeigt Johann-Günther König überzeugend.
Sind wir nicht ein Volk von Bahnfahrern? Wenn's so wäre, hätte dieses Buch nicht geschrieben werden müssen, das sich in zweifach irreführender Weise als "kulturgeschichtliche Reise" im Untertitel und mit einem historischen Foto vom Münchner Hauptbahnhof in einem mittlerweile in die Jahre gekommenen Genre verortet. Eine Kulturgeschichte des Bahnfahrens, das ist "Pünktlich wie die deutsche Bahn?" auch. Mit allem, was dazugehört an Nostalgie, Wirtschaftsgeschichte,
Mehr anzeigen
Rückblicken auf die Anfänge einer der bislang größten Erfindungen der Menschheit, mit vielen langen und teilweise putzigen Zitaten von Autoren wie Hermann Hesse, Thomas Mann, Joseph Roth, Walter Benjamin, Fritz Mauthner bis hin zu Ronja von Rönne. Mit Abstechern auch in die deutsche Kleinstaaterei, in die Geschichte von Holzklasse und Schlafwagen, in den Kampf um Tarife und die Schicksale von Gleisbauern.
Das alles hat Johann-Günther König, Jahrgang 1952, zusammengetragen und solide nacherzählt, mit knapp dreihundert Fußnoten untermauert und mit einem rund sechzig Titel umfassenden Literaturverzeichnis ergänzt. Aber eigentlich geht es ihm um etwas anders, und das kann er auf Seite 84 nicht mehr zurückhalten: Er will die Bahn retten, weil die Politik es nicht tut: "In Deutschland haben die Regierungen im vergangenen Jahrhundert den Staatsbahnbetrieb missbraucht, verraten und, mit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft am 1. Januar 1994, im Prinzip verkauft."
Die Bundesrepublik habe in der Nachkriegszeit "mit Vollgas", die DDR "mit Halbgas" auf Massenmotorisierung gesetzt und den Straßenbau forciert. Nach Angaben des Autors flossen zwischen 1950 und 1990 allein in der Bundesrepublik 450 Milliarden Mark in den Fernstraßenbau, aber nur 56 Milliarden in den Schienenverkehr. Was dazu geführt hat, dass der motorisierte Individualverkehr überproportional zunahm, wie Zahlen aus dem Jahr 2016 zeigen. Demnach wurden zehnmal so viel Kilometer auf Straßen als auf Schienen zurückgelegt. Und anstatt die Bahn zu stärken, konkurrieren mit ihr rund dreihundertfünfzig privatwirtschaftliche Eisenbahnverkehrsunternehmen - ein Spitzenplatz im internationalen Vergleich. Im gleichen Jahr 2016 investierte der Bund pro Einwohner 64 Euro in die Schieneninfrastruktur. Zum Vergleich: Schweden gab 170, die Schweiz 378 Euro aus.
Eigentümer der Deutschen Bahn ist der Bund, der - wie unlängst beschlossen - jetzt noch mehr Politiker in den Aufsichtsrat entsenden will. So macht man den Bock zum Bahner, die Hoffnung, dass sich das Unternehmen an den Wünschen seiner Kunden orientieren wird, schwindet. Denn König macht deutlich, wie sehr die Bahn daran vorbeiplant und wie marode viele Bahnhöfe, Züge und Gleise sind. Von knapp fünfeinhalbtausend Personenbahnhöfen betreibt die zuständige Tochtergesellschaft Deutsche Bahn Station & Service AG noch achthundert selbst, Schrumpfung und Rückbau auch bei den Reisezentren, Dauerärger mit Fahrkartenautomaten, verdreckten oder fehlenden Toiletten. Vom aktuellen Negativrekord bei den Verspätungen nicht zu reden.
In der Schweiz fährt die Bahn sogar dann pünktlich, wenn es schneit. Immer wieder rekurriert König deshalb auf das Nachbarland, das Traumland aller Bahnfahrer. Dass es ein solches wurde, hängt mit der weitsichtigen Entscheidung zusammen, auf Strom zu setzen. Schon 1929 waren knapp sechzig Prozent der Strecken elektrifiziert, bei der von Reparationszahlungen ausgelaugten Reichsbahn waren es drei Prozent. Die zu Recht gerühmte Pünktlichkeit der Schweizer verdankt sich auch einem intelligent getakteten Fahrplan, den jeder Bahnfahrer dort verinnerlicht hat. Als im vergangenen Jahr die Rheintaltrasse wegen eines eingestürzten Tunnelneubaus über Monate gesperrt war, musste sich Deutschland attestieren lassen, eisenbahntechnisch ein "Drittweltland" zu sein. Ein Sprecher der Schweizer Bahn spottete, in Deutschland hätten "die Züge keine Verspätung, sondern eine voraussichtliche Ankunftszeit".
Natürlich kann man den Flächenstaat Deutschland nicht mit der kleinen Schweiz vergleichen, und an eine kommende Zeit ohne Verspätungen glaubt weder der Autor noch irgendein Kunde des Unternehmens, das derzeit 7900 Stunden Verspätung einfährt - am Tag. Wie es um den Rang des Bahnverkehrs steht, könne man, schreibt König, auch daran festmachen, dass im Verkehrsfunk "ellenlange" Staumeldungen verlesen werden, während die Bahn nur dann vorkomme, wenn eine ganze Region lahmgelegt sei.
Die Priorisierung des schnellen Fernverkehrs, die Konzentration auf Tempo allein - man denke an die berühmten zehn Minuten Zeitgewinn auf der künftigen Strecke Stuttgart-Ulm - geht nach Ansicht des Autors am Kunden vorbei, da sich der Löwenanteil des Schienenverkehrs im Nahverkehr von bis zu 50 Kilometern abspielt. Dort zuallererst erhoffen sich die Bahnkunden Pünktlichkeit und gute Anschlüsse.
Die Autolobby macht offenkundig einen ausgezeichneten Job. Energiesteuerbefreiter Diesel, Dienstwagenprivileg, mautbefreite Fernbusse, mehrwertsteuerbefreite Flüge - König ist überzeugt, dass Deutschlands Klimaziele ohne massiven Ausbau des Bahnverkehrs Wunschdenken bleiben werden. Er plädiert für eine Deutschland-Karte "für alle öffentlichen Verkehrsmittel auf Grundlage eines einheitlichen Tarifsystems, das die Preise von Variablen wie etwa Länge der Reisestrecke und Wahl der Klasse abhängig macht und bei Fahren zu verkehrsschwachen Zeiten einen Rabatt gewährt".
Viel Bekanntes und vielfach Beschriebenes hat König zusammengetragen. Wenn sein Einwurf am Ende doch überzeugt, liegt das an der Haltung des Autors. Er macht weder billige Bahn-Witze, noch gibt er den Dauernörgler. Stattdessen erzählt er die Geschichte einer Preisgabe - und deutet an, dass er der (Wieder-)Belebung der Bahn nach heutigem Stand keine großen Erfolgsaussichten einräumt. Pünktlichkeit erscheint in diesem ernüchternden Panorama eher als nachrangige Kategorie. Die Frage, die hier an die Politik gestellt wird, lautet: Hat sie mit der Bahn künftig überhaupt noch etwas im Sinn?
HANNES HINTERMEIER
Johann-Günther König: "Pünktlich wie die deutsche Bahn?" Eine kulturgeschichtliche Reise bis in die Gegenwart.
Verlag zu Klampen, Springe 2018. 219 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Das alles hat Johann-Günther König, Jahrgang 1952, zusammengetragen und solide nacherzählt, mit knapp dreihundert Fußnoten untermauert und mit einem rund sechzig Titel umfassenden Literaturverzeichnis ergänzt. Aber eigentlich geht es ihm um etwas anders, und das kann er auf Seite 84 nicht mehr zurückhalten: Er will die Bahn retten, weil die Politik es nicht tut: "In Deutschland haben die Regierungen im vergangenen Jahrhundert den Staatsbahnbetrieb missbraucht, verraten und, mit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft am 1. Januar 1994, im Prinzip verkauft."
Die Bundesrepublik habe in der Nachkriegszeit "mit Vollgas", die DDR "mit Halbgas" auf Massenmotorisierung gesetzt und den Straßenbau forciert. Nach Angaben des Autors flossen zwischen 1950 und 1990 allein in der Bundesrepublik 450 Milliarden Mark in den Fernstraßenbau, aber nur 56 Milliarden in den Schienenverkehr. Was dazu geführt hat, dass der motorisierte Individualverkehr überproportional zunahm, wie Zahlen aus dem Jahr 2016 zeigen. Demnach wurden zehnmal so viel Kilometer auf Straßen als auf Schienen zurückgelegt. Und anstatt die Bahn zu stärken, konkurrieren mit ihr rund dreihundertfünfzig privatwirtschaftliche Eisenbahnverkehrsunternehmen - ein Spitzenplatz im internationalen Vergleich. Im gleichen Jahr 2016 investierte der Bund pro Einwohner 64 Euro in die Schieneninfrastruktur. Zum Vergleich: Schweden gab 170, die Schweiz 378 Euro aus.
Eigentümer der Deutschen Bahn ist der Bund, der - wie unlängst beschlossen - jetzt noch mehr Politiker in den Aufsichtsrat entsenden will. So macht man den Bock zum Bahner, die Hoffnung, dass sich das Unternehmen an den Wünschen seiner Kunden orientieren wird, schwindet. Denn König macht deutlich, wie sehr die Bahn daran vorbeiplant und wie marode viele Bahnhöfe, Züge und Gleise sind. Von knapp fünfeinhalbtausend Personenbahnhöfen betreibt die zuständige Tochtergesellschaft Deutsche Bahn Station & Service AG noch achthundert selbst, Schrumpfung und Rückbau auch bei den Reisezentren, Dauerärger mit Fahrkartenautomaten, verdreckten oder fehlenden Toiletten. Vom aktuellen Negativrekord bei den Verspätungen nicht zu reden.
In der Schweiz fährt die Bahn sogar dann pünktlich, wenn es schneit. Immer wieder rekurriert König deshalb auf das Nachbarland, das Traumland aller Bahnfahrer. Dass es ein solches wurde, hängt mit der weitsichtigen Entscheidung zusammen, auf Strom zu setzen. Schon 1929 waren knapp sechzig Prozent der Strecken elektrifiziert, bei der von Reparationszahlungen ausgelaugten Reichsbahn waren es drei Prozent. Die zu Recht gerühmte Pünktlichkeit der Schweizer verdankt sich auch einem intelligent getakteten Fahrplan, den jeder Bahnfahrer dort verinnerlicht hat. Als im vergangenen Jahr die Rheintaltrasse wegen eines eingestürzten Tunnelneubaus über Monate gesperrt war, musste sich Deutschland attestieren lassen, eisenbahntechnisch ein "Drittweltland" zu sein. Ein Sprecher der Schweizer Bahn spottete, in Deutschland hätten "die Züge keine Verspätung, sondern eine voraussichtliche Ankunftszeit".
Natürlich kann man den Flächenstaat Deutschland nicht mit der kleinen Schweiz vergleichen, und an eine kommende Zeit ohne Verspätungen glaubt weder der Autor noch irgendein Kunde des Unternehmens, das derzeit 7900 Stunden Verspätung einfährt - am Tag. Wie es um den Rang des Bahnverkehrs steht, könne man, schreibt König, auch daran festmachen, dass im Verkehrsfunk "ellenlange" Staumeldungen verlesen werden, während die Bahn nur dann vorkomme, wenn eine ganze Region lahmgelegt sei.
Die Priorisierung des schnellen Fernverkehrs, die Konzentration auf Tempo allein - man denke an die berühmten zehn Minuten Zeitgewinn auf der künftigen Strecke Stuttgart-Ulm - geht nach Ansicht des Autors am Kunden vorbei, da sich der Löwenanteil des Schienenverkehrs im Nahverkehr von bis zu 50 Kilometern abspielt. Dort zuallererst erhoffen sich die Bahnkunden Pünktlichkeit und gute Anschlüsse.
Die Autolobby macht offenkundig einen ausgezeichneten Job. Energiesteuerbefreiter Diesel, Dienstwagenprivileg, mautbefreite Fernbusse, mehrwertsteuerbefreite Flüge - König ist überzeugt, dass Deutschlands Klimaziele ohne massiven Ausbau des Bahnverkehrs Wunschdenken bleiben werden. Er plädiert für eine Deutschland-Karte "für alle öffentlichen Verkehrsmittel auf Grundlage eines einheitlichen Tarifsystems, das die Preise von Variablen wie etwa Länge der Reisestrecke und Wahl der Klasse abhängig macht und bei Fahren zu verkehrsschwachen Zeiten einen Rabatt gewährt".
Viel Bekanntes und vielfach Beschriebenes hat König zusammengetragen. Wenn sein Einwurf am Ende doch überzeugt, liegt das an der Haltung des Autors. Er macht weder billige Bahn-Witze, noch gibt er den Dauernörgler. Stattdessen erzählt er die Geschichte einer Preisgabe - und deutet an, dass er der (Wieder-)Belebung der Bahn nach heutigem Stand keine großen Erfolgsaussichten einräumt. Pünktlichkeit erscheint in diesem ernüchternden Panorama eher als nachrangige Kategorie. Die Frage, die hier an die Politik gestellt wird, lautet: Hat sie mit der Bahn künftig überhaupt noch etwas im Sinn?
HANNES HINTERMEIER
Johann-Günther König: "Pünktlich wie die deutsche Bahn?" Eine kulturgeschichtliche Reise bis in die Gegenwart.
Verlag zu Klampen, Springe 2018. 219 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Das deutsche Bahnsystem ist marode und wird von der Politik seit Jahrzehnten vernachlässigt. "Wie das kam und wohin das führt, zeigt Johann-Günther König überzeugend.« Hannes Hintermeier in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. Juli 2018
Gebundenes Buch
Johann-Günther König gelingt mit diesem Buch ein spannender, weit verzweigter Wurf, um Interesse für eine Fortbewegungsart zu entwicklen, die in naher Zukunft eher noch an Bedeutung gewinnen wird. Ich selbst bin in der Nähe eines Dampflokschuppens aufgewachsen und kann die …
Mehr
Johann-Günther König gelingt mit diesem Buch ein spannender, weit verzweigter Wurf, um Interesse für eine Fortbewegungsart zu entwicklen, die in naher Zukunft eher noch an Bedeutung gewinnen wird. Ich selbst bin in der Nähe eines Dampflokschuppens aufgewachsen und kann die morgendlichen Anheiz-Geräusche noch gut (fast romantisch) erinnern.
Die Geschichte der Eisenbahn in Deutschland startete in Nürnberg, die Bahn oder der Fahrweg nach Fürth wurde 1835 mit Eisenschwellen & Schienen belegt und konnte so den Wagons eine feste Spur geben. 1798 hatte bereits in England ein Erfinder die Hochdruckdampfmaschine entwickelt, mit der Autos fuhren, aber stärker wurde zunächst die Dampflokomotive nachgefragt, die zum ersten Mal 1804 auf einer Hüttenwerksbahn in Südwales fuhr und fünf Waggons mit einer Last von zehn Tonnen über eine Strecke von rund 15 km zog.
Im Jahr 1830 eröffnete dann die erste öffentliche Bahn zwischen Manchester und Liverpool – von den 30 Kutschen, die bis dahin diese Strecke befuhren, stellten 29 unmittelbar danach ihren Betrieb ein. Früher reisten täglich 500 Personen auf dieser Strecke, kurz danach waren es per Bahn schon 1600 Menschen täglich.
Friedrich List, ein deutscher Wirtschaftstheoretiker, der nach USA ausgewandert war, kam zurück und gilt als einer der Begründer der deutschen Eisenbahnen. Sein Traum von einer Trasse zwischen Leipzig und Dresden ging 1839 in Erfüllung. 150 km Eisenbahnschienen verkürzten die Reisezeit von 21 auf damals unglaubliche 3 Stunden. Es folgte die Strecke Potsdam-Berlin, die Spurweite richtete sich nach englischen Vorgaben und ist uns mit 1,435 m bis heute erhalten geblieben.
Die Vision von Friedrich List über die Segnungen des neuen Verkehrsmittels liest sich wie eine Menschheits-Verbrüderung in Toleranz und gegenseitigem Respekt. Wie wollte man noch Kriege anzetteln, wenn sich alle kennen? Eisenbahnen sah er als eigentliche Volkswohlstands- und Bildungsmaschinen.
Mit der parallel einsetzenden Dampfkraft-Schifffahrt wurde der Industrialisierung und auch dem Tourismus der Turbo zugeschaltet, Johann-Günther König lässt den Leser unmittelbar teilhaben und nachempfinden, wie eine beschleunigte Gesellschaft Fahrt aufnahm. Die Geschwindigkeit multiplizierte sich um das Zehnfache. Pferde und Kutschen bzw. die Post wurden aber im 19. Jahrhundert weiterhin, sogar vermehrt benötigt, vor allem in jenen Gebieten, wo es noch keine Bahnstrecke gab. Alle profitierten also von den Neuerungen.
Zu Beginn gab es in Deutschland nur private Bahnen und Länderbahnen, eine verwirrende Vielfalt von Tarifen und Regelungen entwickelte sich, insgesamt 4 Klassen inkl. einem nach oben offenen Wagon konnte man buchen.
In der Schweiz wurde die Bahn schon 1898 nach einer Volksabstimmung verstaatlicht, das Deutsche Reich brauchte einen verlorenen Weltkrieg, um hier nachzuziehen. Aber sowohl die Weimarer Republik, das Dritte Reich und auch die BRD gewährten dem Autoverkehr die Vorfahrt. Die Eisenbahn diente in den Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts vor allem dazu, die gigantischen Reparationszahlungen der Siegermächte zu bedienen. In der DDR fuhr man auf Verschleiß und ließ die Infrastruktur verkommen.
Dass die neue DB AG es nicht leicht hat, ist klar. Wir lesen in diesem Buch von den Schwierigkeiten und fahren in der Zeit zurück und mit einem besseren Verständnis für die Schiene in die Zukunft. Ich mag dieses Buch als eine geschickte Verquickung zwischen Wissen, Geschichte und Geschichten, dabei kommen auch die Bahnhofsbuchhandlungen zu Wort, ein Bereich, den ich in allen Bahnhöfen immer als erstes ansteuere. Leider dominieren heute auch hier die Ketten, in den 80ern gab es noch individuelle, ganz persönliche Anbieter. So einen besuchte ich in Frankfurt am Main oft und nahm mir kurz vor der Abfahrt irgendein Buch und kaufte es. So z.B. „Unfug des Lebens und des Sterbens“ von Prentice Mulford.
2008 druckte die Deutsche Bahn AG das letzte Kursbuch, das mit 2800 dünnen Seiten fast zwei Kilo wog. Wann immer ich heute nach einem Kursbuch von Enzensberger suche, taucht auch eines der Bahn auf, als Rarität. Wie werden heute die elektronischen Fahrpläne entwickelt? „6,2 Mio Fahrgäste fahren täglich auf 75.000 Verkehrswegen, in einem 33.300 km langen Streckennetz mit 24.220 Zügen (2018). Hinzu kommen noch 4000 Güterzüge auf den gleichen Schienen. Ein Fahrplan für die Deutsche Bahn und 400 Bus- und Eisenbahnunternehmen ist eine hochkomplexe Sache.“
Tatsächlich gab es früher Züge, bei denen Verspätungen hoch erwünscht waren, z.B. beim Orient Express. Heute blendet das gleichmäßige Rattern auf den Schienen die Sorgen der Welt ebenso aus und wer es schafft, die vorbeifliegende Landschaft zu genießen, gönnt sich Meditation pur, ganz wie zu Beginn des Bahnfahrens.
Den umfangreichen Literaturhinweisen habe ich dieses Buch entnommen und lese es demnächst: „Der Teufel steckt im ICE. Die abgefahrensten Erlebnisse einer Zugbegleiterin, von Juliane Zimmermann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für