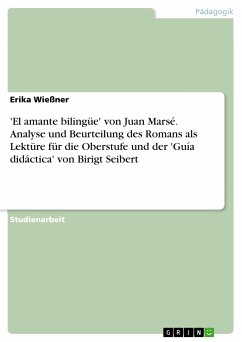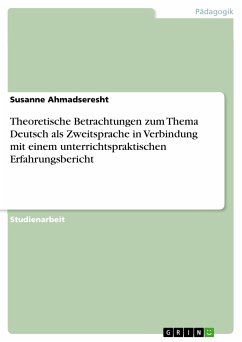Referat (Handout) aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Didaktik - Englisch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,0, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Didaktik für englische Sprache und Literatur), Veranstaltung: Repetitorium, Sprache: Deutsch, Abstract: Lektüre: längerer, zusammenhängender Text, der zusätzlich zum oder im Anschluss an das Lehrbuch gelesen wird. · 19. Jahrhundert: - literarische Texte spielen bereits große Rolle im EU, aber weitestgehend nur Behandlung großer Werke der engl. Literaturgeschichte in gymnasialer Oberstufe - primär allgemeinbildende statt sprachdidaktische Ziele: Bsp.: Shakespeare im Original lesen, aber auf Deutsch besprechen - Auffassung bis in die 70er-Jahre (20.Jh.): Das Lesen geistiger Tradition stellt so hohe Anforderungen, dass die Besprechung nur in der Muttersprache möglich ist. Eine funktionale Verbindung zwischen Literatur- und Sprachunterricht ist nicht möglich. ( ® vgl. Gutschow (1979): „Literaturunterricht ist nicht Sprachunterricht“) - G-Ü-Methode; kein Zusammenspiel zwischen Leser und Text, d.h. ausschließlich textimmanente Aspekte spielen eine Rolle · 20. Jahrhundert: - 50er-/60er-Jahre: fester Lektürekanon - ab Ende 60er-Jahre: auch systematische Einbeziehung von Sachtexten als Quellen des authentischen (und aktuellen) Sprachgebrauchs; Themen- und Textvorschläge zu literarischen Texten traten an die Stelle eines Literaturkanons - seit Beginn der 70er-Jahre: Paradigmawechsel (NISSEN = theoretischer Begründer einer modernen Text- und Gesprächsdidaktik für den EU in Deutschland): auch funktionale (sprachdidaktische) Rolle von Literatur im EU; Doppelfunktion von Texten: 1. Inhalt als Artikulationsanlass, 2. Vokabular und Ausdrucksmittel als Artikulationsmodell. Auch „dynamischer“ Textbegriff: Texte als Zwischenstationen zur Schaffung weiterer Texte und andererseits als Ausgangspunkt für die rezeptive Verarbeitung textuell basierten Wissens. - ab 80er-Jahre: Miteinander von literarischen Texten und Sachtexten; Hören und Lesen als Interaktion zwischen Lernendem und Text [...]