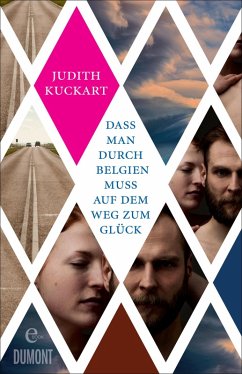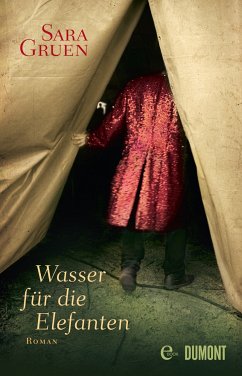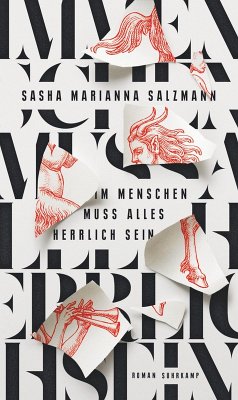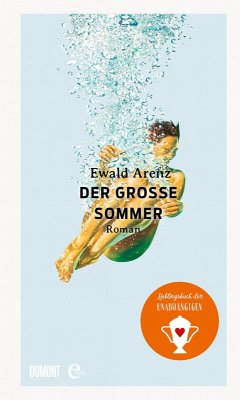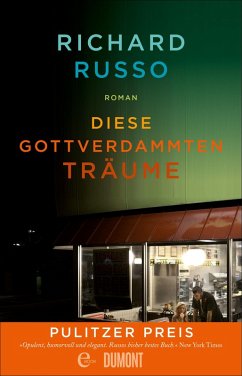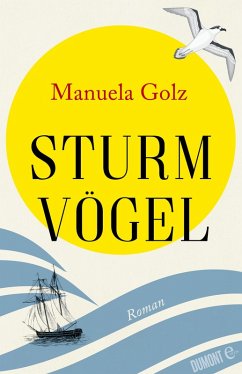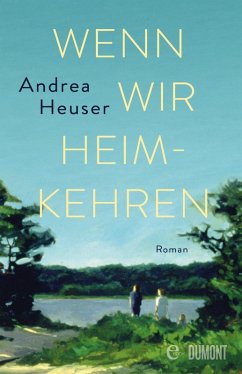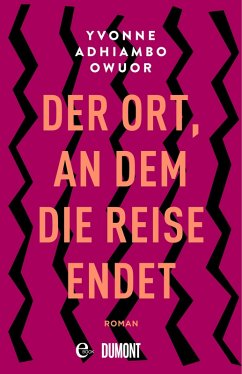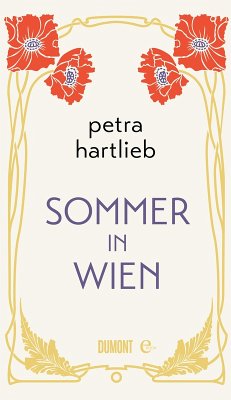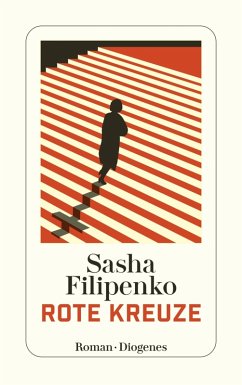Berliner Flughafen Tegel macht.
Einen Namen hat die Erzählerin selbst bezeichnenderweise nicht, vierundfünfzig Jahre ist sie alt - eine wichtige Angabe, denn sie wiederum hat ein Faible ("Spleen" träfe es auch) für Zahlen, insbesondere für die Achtzehner-Reihe. Als sie achtzehn Jahre alt war, verliebte sie sich in einen Sechsunddreißigjährigen, Viktor. Mit 36 hatte sie einen gleichaltrigen Freund, Johann. Nun, alleinstehend mittlerweile, soll ihre Sehnsucht wiederum einem Mann gelten, der 36 Jahre zählt. Ganz zufällig ist die Begegnung mit Robert Sturm nicht: Gezielt fährt die namenlose Frau abends zum Flughafen, um zwischen den Ankommenden und Abfliegenden jemanden zu finden, der ihr gefallen könnte und der im passenden Alter ist.
Ein gemeinsames Getränk, dann fliegt Robert Sturm für eine Woche nach Sibirien, um Ölraffinerien mit Kompressoren auszustatten. Die Erzählerin aber hat, was sie braucht: eine Visitenkarte, heimlich aus seinem Portemonnaie gezogen, um in der Manier einer Verliebten in den folgenden Tagen durch Sturms Kiez zu schlendern, gar nachts von einer benachbarten Telefonzelle aus in dessen Wohnung anzurufen und den Umriss einer unbekannten Frau zu beobachten, der sich hinter dem Fenster abzeichnet, während diese zu ergründen versucht, wer am anderen Ende der Leitung ist.
Vor allem aber braucht die Erzählerin diesen Robert Sturm für etwas anderes: als Adressaten der Erzählung über ihr Leben, als denjenigen, der ihre Erinnerung nicht nur in Gang setzt, sondern dem sie ein Bild von sich entwerfen kann. Dass Sturm die Erzählerin nicht hört, dass er ihr Gesicht schon vergessen haben mag, bald nachdem er ins Flugzeug gestiegen ist, spielt keine Rolle. "Dass Sturm nicht da ist und sie nicht dort", denkt sie am Mittwoch der Woche, die den zeitlichen Rahmen des Romans bildet, "ergibt einen dritten Ort, so wie minus mal minus ein Plus wird. Sie hat ihn soeben neben sich gespürt. Und was man gefühlt hat, ist, was man erlebt hat. Auch das weiß sie. Aus dem Leben und aus der Wissenschaft. Deswegen ist sie Neurobiologin geworden."
In jenem vermeintlichen Paradox offenbart sich nur einer der Horizonte, die Judith Kuckart in ihrem Roman aufreißt und auf unangestrengte Weise mit neurobiologischem Wissen unterfüttert: Kann Vorstellung das Erleben, kann eine erdachte Erinnerung das Nichterfahrene ersetzen? Und umgekehrt: Wie formt uns das, was wir vergessen zu haben scheinen? Wie viel sehen wir von einem Menschen, den wir zu lieben und zu kennen meinen - vielleicht nur ein paar Details, und das Übrige erfindet und ergänzt unser Gehirn und blendet anderes aus? Aber wie? Automatisch? Willkürlich? Nach unseren Vorlieben oder doch zumindest so, dass es uns erträglich scheint?
Wenn Kuckarts Erzählerin sich etwa an den achtzehn Jahre älteren Viktor erinnert - auch ihn hat sie einst an einem anonymen Durchgangsort getroffen, am Bahnhof Zoo -, dann hat es den Anschein, als ob in der Beziehung zu diesem Mann nicht das Ergänzen, sondern das Vermögen zum Ausblenden eine wenn nicht Überlebens-, so doch Liebesstrategie sein musste. Nur ganz zu Anfang ihrer Zweisamkeit versucht die Erzählerin Viktor zu ergründen. Mit einem Kleiderbügel öffnet sie einen Rollschrank, in dem sich die Zeugnisse seines heimlichen Begehrens finden. Viktor ertappt sie, unbemerkt ist er in die Wohnung zurückkehrt. Das Lachen, das er ausstößt, klingt wie der Schrei eines Pfaus, ängstlich, verletzt und angriffslustig gleichermaßen. Der Schrank wird bleiben während der gemeinsamen fünfzehn Jahre, öffnen wird die Erzählerin ihn nicht mehr.
Ebenso leichtfüßig und musikalisch wie Judith Kuckart in "Kein Sturm, nur Wetter" zwischen der Gegenwart und dem Erinnern abzuwechseln versteht, so selbstverständlich und unsentimental vermag sie existentielle Fragen zu stellen, ohne Antworten mitzuliefern, darauf etwa, ob die Erzählerin bis dato ein glückliches Leben geführt oder sich selbst darum betrogen hat. Oder darauf, ob sie die Männer braucht, um sich selbst entwerfen zu können - oder ob ihre Stärke gerade in der scheinbaren Zurückgenommenheit liegt. Denn eine weitere Erzählebene, im Schriftbild des Romans abgesetzt durch Schreibmaschinenlettern, eröffnet eine Art Einblick in die Werkstatt: zeigt den Plan derjenigen, die da erzählt, ihre Verfügungsgewalt über das Material, ihre Möglichkeit, den Stoff zu variieren und zu arrangieren.
Die Ungewissheit, die Schwebe - hier vielmehr: das Schwebende - aber muss bei alledem ausgehalten werden, genauso wie die Einsicht in eine universelle Einsamkeit, die vielleicht noch schwerer wiegt in dieser merkwürdigen Konstellation, die sich Paar nennt. Kuckart verleiht ihr eine herbe Grazie.
Weniger offen - und hier wird "Kein Sturm, nur Wetter" auf subtile, kluge Weise auch zu einem politischen Roman - bleibt es hingegen, wo Kuckart auf die Bedingungen der Herkunft schaut. Vor diesen, das wird verschiedentlich deutlich, gibt es kaum ein Entkommen. Auch die Erzählerin bewegt sich im Korsett ihrer sozial prekären Kindheit und wird, anders als ihre aus privilegierten Verhältnissen stammende Freundin, trotz ihrem Studium keine Karriere machen, sondern sich als Sekretärin und Lektorin verdingen. Es gibt, so kann man Kuckart lesen, ohne dass sie es explizit aussprechen müsste, diejenigen, die mit aller Selbstverständlichkeit in die Chefetagen aufsteigen, und jene, die dazu befähigt wären, die es sich aber nicht zugestehen und so zeitlebens Dienende bleiben. Vielleicht handelt es sich nur um das Unvermögen, sich selbst anders zu denken?
Eine Woche nachdem er abgeflogen ist, wird Robert Sturm von seiner Reise nach Sibirien zurückkehren. Die Erzählerin fährt nach Tegel. Treffen wird sie Sturm nicht. Aber während der sieben Tage, an denen sie ihm ihr Leben erzählt hat - und das so, wie sie es erzählen will -, hat sie sich zweifelsohne einmal durchwehen lassen und zumindest ein wenig neu und anders wieder zusammengesetzt.
WIEBKE POROMBKA
Judith Kuckart: "Kein Sturm, nur Wetter". Roman.
DuMont Buchverlag, Köln 2019. 224 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
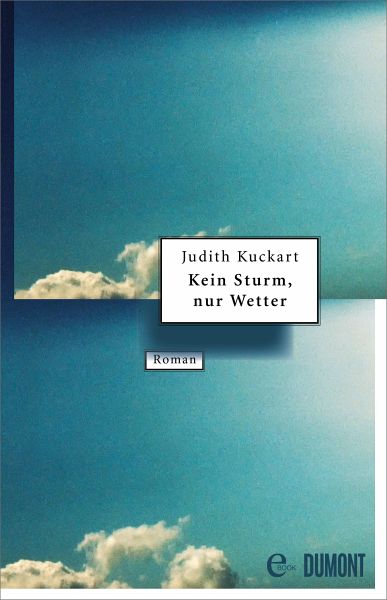





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.11.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.11.2019