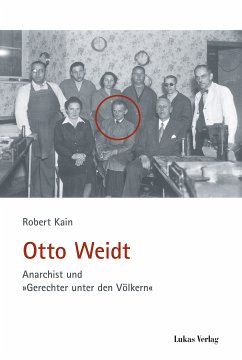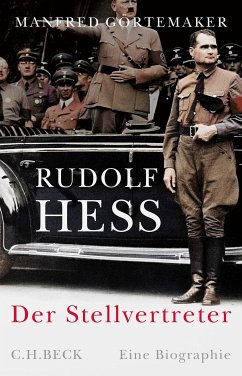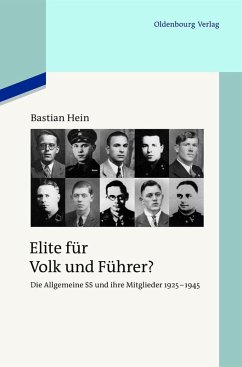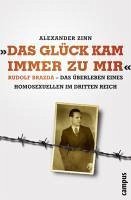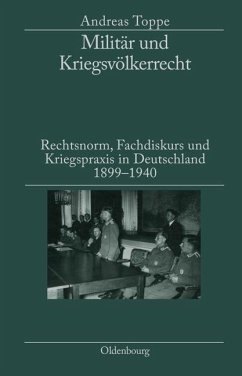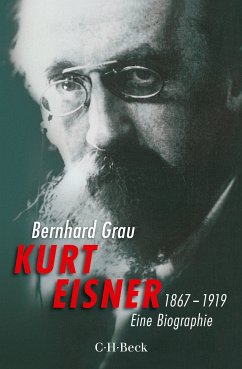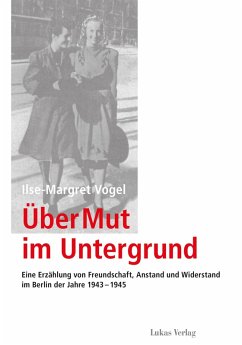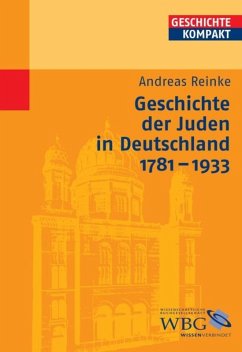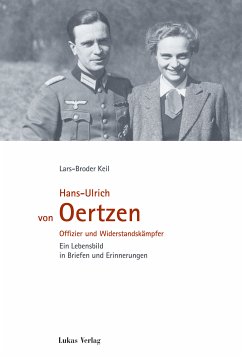sollte mit dem Diktum Stimmung gegen einen zunehmend lästigen Anwalt gemacht werden. Gleichviel, ob "schlimmes Wort" oder "unbestreitbare Ehrenerklärung" - Max Hirschberg hat mit der vorliegenden Edition sein verdientes Denkmal erhalten.
Aus einer der vielen jüdischen Aufsteigerfamilien stammend - der Vater hatte es vom Inhaber eines kleinen Modegeschäfts zum königlichen Kommerzienrat mit zweihundert Angestellten gebracht -, führte ein glänzendes juristisches Studium Hirschberg direkt in die Advokatur; die Aufnahme in den bayerischen Staatsdienst hatte man ihm seiner jüdischen Herkunft wegen erst gar nicht angeboten. Von Begeisterung konnte bei dem selbst ernannten "Durchschnittsanwalt" indes zunächst keine Rede sein. Erst der Weltkrieg mit seinen "mit heraushängenden Gedärmen im Stacheldraht verendeten" Kameraden und die brutale Liquidierung der Münchener Räterepublik lieferten dem musisch begabten Sonderling die "Wendung des Lebens vom Ästhetischen, in dem es nur Möglichkeiten gibt, zum Ethischen, in dem man Aufgaben erkennt".
Nimmermüder Einsatz.
Einen ersten Höhepunkt von Hirschbergs Tätigkeit bildete der Landesverratsprozess gegen Felix Fechenbach, einen engen Mitarbeiter Kurt Eisners, im Jahre 1922. Fechenbach hatte Dokumente über den Ausbruch des 1. Weltkrieges und die exzessiven deutschen Kriegsziele an ausländische Journalisten gegeben. Die von einem bayerischen Volksgericht unter Verstoß gegen alle rechtsstaatlichen Grundsätze verhängte Bestrafung erregte republikweites Aufsehen. Nur Hirschbergs nimmermüder Einsatz führte schließlich zu Fechenbachs Begnadigung und Freilassung; das Urteil selbst hat bis heute Bestand.
Von der Öffentlichkeit noch stärker wahrgenommen wurde der Dolchstoßprozess (1925). Hirschberg verteidigte die "Münchner Post", die eine Darstellung des "Dolchstoßes" als "Geschichtsfälschung" bezeichnet hatte, gegen den Vorwurf der "Pressebeleidigung". Der Prozess entwickelte sich zu einer spektakulären Geschichtswerkstatt, zu der Männer wie Noske, Groener und Scheidemann ihren Beitrag leisteten. Trotz einer geradezu erdrückenden Beweislage feierte Hirschberg am Ende nicht mehr als einen Achtungserfolg. Was nützte es da, dass Hirschberg sagen durfte, er habe sich "im Rahmen der damaligen Reife einer Anschauungen zu einer bedeutenden forensischen und rhetorischen Leistung erhoben"? Sie bescherte ihm nur einen prominenten Platz auf den Abschusslisten der Rechten.
Am Ende von Hirschbergs Tätigkeit stehen die sofortige Verhaftung durch die Nazis und die anschließende Flucht nach Italien und später in die Vereinigten Staaten. Bewundernswerterweise gelingt Hirschberg nebst dem vergötterten "Söhnchen" und seiner über alles geliebten Frau in jedem dieser Lebensabschnitte der Aufbau einer neuen respektablen Existenz. Sein Vaterland freilich hat er er nie wieder gesehen: Hoch angesehen stirbt Hirschberg 1964 im Alter von achtzig Jahren in New York.
Schnörkellos.
Hirschbergs Erinnerungen sind schnörkellos geschrieben und unterhaltsam zu lesen. Ein kritisches Selbstbewusstsein bestimmt ihren Ton. Seine Urteile - wenn etwa die Appeaser Chamberlain und Briand als "Esel" und Kaiser Wilhelm II. als "ungewöhnlich dummer Psychopath" bezeichnet werden - lassen an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Andererseits steht die Unabhängigkeit des vermeintlichen Linken zu keiner Zeit in Frage: So zieht er etwa als Lehre der wirtschaftlichen Schwierigkeiten seines Vaters zum Ende des Kaiserreiches: "Auch den Unternehmern und nicht bloß den Arbeitern" kann "das kapitalistische System schwere Qualen bereiten". Die Kommunisten kommen bei Hirschberg besonders schlecht weg: Sie "hetzen nur anständige Proletarier ins Verderben, ohne für die Arbeiterschaft etwas damit zu erreichen".
Begleitet werden Hirschbergs Ausführungen von den kundigen Anmerkungen Reinhard Webers. Der Einleitung hätte an den Stellen, an denen nur mehr Hirschbergs eigene Ausführungen zusammengefasst werden, eine straffere Fassung gut getan. Andererseits könnten die Kommentierungen im Text zuweilen ausführlicher sein. Napoleon I. hätte man als "Kaiser der Franzosen" ebenso wenig vorstellen müssen wie Goethe als Dichter des "Faust". Wirklich schwerwiegend ist all das aber nicht; wo die Anmerkungen helfen sollen, helfen sie.
Max Hirschberg, der mit Thomas Mann, Albert Einstein, Thomas Dehler und anderen Größen seiner Zeit verkehrte, ist wie viele seiner jüdischen Zeitgenossen heute praktisch vergessen. Dies ist in jedem Einzelfall mehr als nur ein "Kollateralschaden" der Hitler-Diktatur. Es ist ein Verlust, den Bücher wie das vorliegende nicht wieder gutmachen, sondern nur umso brutaler in Erinnerung rufen. Wer mehr über diesen gebildeten, weitsichtigen Mann und die bayerischen Verhältnisse der Zwischenkriegszeit erfahren will, kommt an seiner Lektüre nicht vorbei.
CORNELIUS SIMONS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.04.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.04.2000