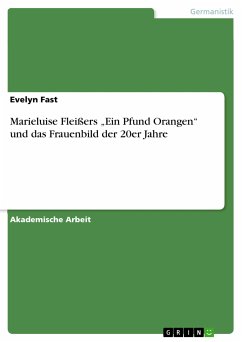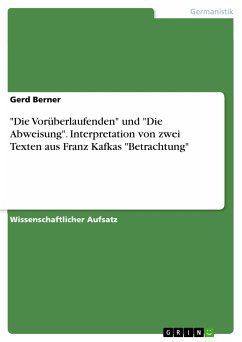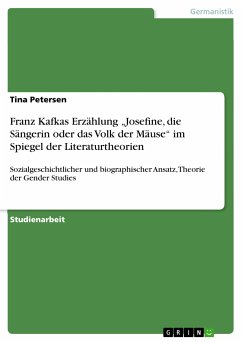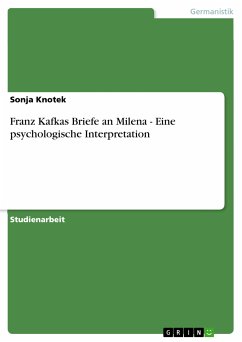Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Technische Universität Dresden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Entstehung der Erzählung Ein Landarzt von Franz Kafka wird auf Januar und Februar des Jahres 1917 datiert. In der Forschungsliteratur werden immer wieder zentrale Daten der Zeitspanne zwischen 1914 und 1917 hervorgehoben: zum einem die Verlobung mit Felice Bauer in diesen beiden Jahren (beide Male scheiterte das Ehevorhaben), dann der Beginn des Ersten Weltkrieges am 28.7.1914 und zum anderem der Ausbruch der Tuberkulose im Jahr 1917. In meiner Hausarbeit versuche ich zu klären, welche Umstände und ob die oben genannten Ereignisse auf die Entstehung der Erzählung Einfluß nahmen. Eine Interpretation wird sich aber nicht einfach gestalten, da Kafka aufgrund seiner „Bilder, die in ihrer paradoxen Form das Unaussprechliche aussprachen, ohne es zu verraten“1 schwer zu durchschauen ist. Heinz Politzer bezeichnet diese und viele weitere Erzählungen Kafkas als Parabeln und stellt eine Besonderheit in seinen Parabeln fest: die undurchsichtige Bildebene steht im Gegensatz zu der klaren scharfen Erzählform in den Parabeln.2 Das spricht ebenfalls für eine komplizierte Interpretation. Zunächst muß die scheinbar eindeutige Sprache Kafkas als nicht eindeutig entlarvt werden – sie bedeutet nicht das, was bei einer ersten Betrachtung vermutet wird. So entsteht dann eine „Überwirklichkeit“3, die sich hinter der Realität verbirgt und aus unerfindlichen Gründen zum Ausbruch kommt. In folgendem gebe ich einen Überblick über die Forschungsliteratur (Punkt 2). Dabei gehe ich besonders im Absatz 2.1 auf die Rolle der Pferde und des Knechts sowie im Absatz 2.2 auf das Dienstmädchen und die Wunde ein, da beide Bereiche eine zentrale Stellung in der Forschungsliteratur einnehmen. Im 3. Punkt komme ich zum Hauptteil der Hausarbeit und damit zur Interpretation der Erzählung und widme mich zunächst der Tiermetapher (Punkt 3.1). Eine biographische Perspektive auf die Erzählung versuche ich im Punkt 3.2 zu entwickeln, wobei ich mich auf den Vater-Sohn-Konflikt (Absatz 3.2.1) und Kafkas Beziehung zu Frauen (Absatz 3.2.2) beschränke. Abschließend ziehe ich mein Fazit zu der Interpretation im 4. Punkt. Am Ende folgt die Auflistung der verwendeten Literatur.