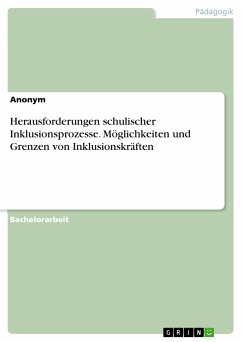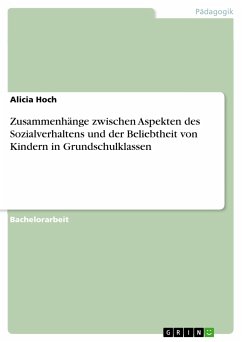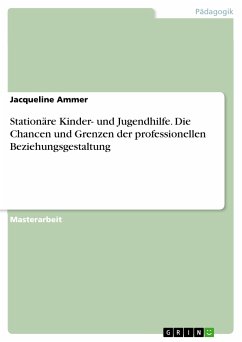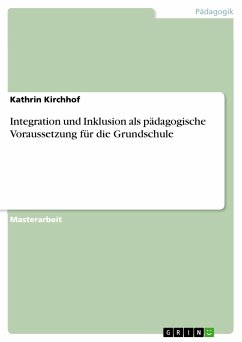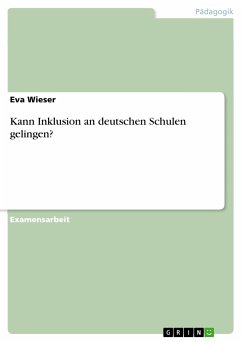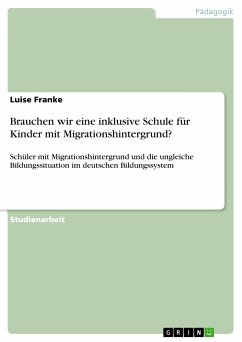Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Pädagogik - Inklusion, Note: 1,3, Bergische Universität Wuppertal, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit über dreißig Jahren gibt es in Deutschland die Forderung, eine separierte Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zugunsten einer integrativen Beschulung aufzuheben. Infolgedessen wurden in den vergangenen Jahren im Rahmen von zahlreichen Modellversuchen integrative Klassen ins Leben gerufen. Diese hatten das Ziel, eine gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung zu realisieren, um einer Diskriminierung entgegenzuwirken und eine Chancengleichheit garantieren zu können. Die Berechtigung der Sonder--‐ bzw. Förderschulen wurde zunehmend infrage gestellt. Obwohl die Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in einem Gemeinsamen Unterricht der Regelschule als gleichwertig mit der Beschulung in einer Sonderschule gilt, werden heutzutage vergleichsweise wenig Kinder mit Behinderung integrativ beschult. Angesichts der Tatsache, dass in anderen europäischen Ländern (z.B. Italien oder Schweden) nahezu 100 Prozent dieser Schülerinnen und Schüler den Gemeinsamen Unterricht besuchen, stellt sich die Frage, welche Ursachen in Deutschland zu solch einer niedrigen Integrationsquote führen. Ziel ist es, immer mehr Kinder mit Behinderung an der Regelschule zu unterrichten. Kann dies gelingen? Welche Hürden und Probleme müssen gemeistert werden und welche Auswirkungen hat dieser Wille auf den Lernerfolg aller Kinder der Klassengemeinschaft? Sind Theorie und Praxis vereinbar? Zu diesen und noch vielen anderen Fragen der Integration und Inklusion Lehrer wurden Lehrer und deren Antworten ausgewertet. Diese wurden u.a. Bezug zu wissenschaftlichen Positionen gestellt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zentrale Elemente des Gemeinsamen Unterrichts im Primarbereich herauszuarbeiten, um anschließend subjektive Einstellungen und Erfahrungen der Lehrkräfte bezüglich derselben zu erfassen.