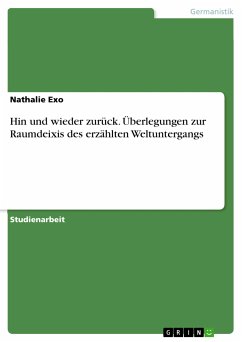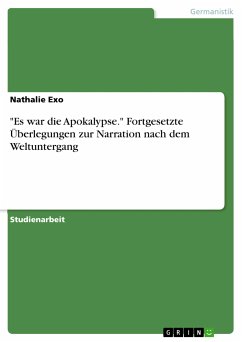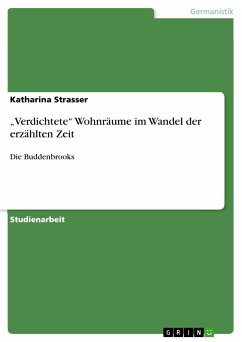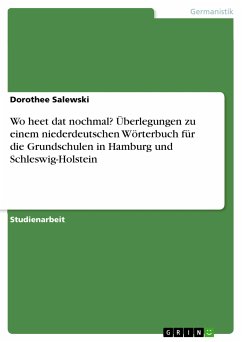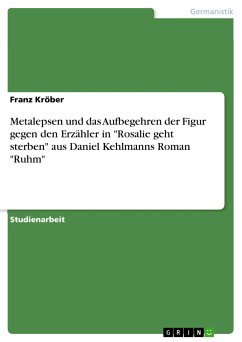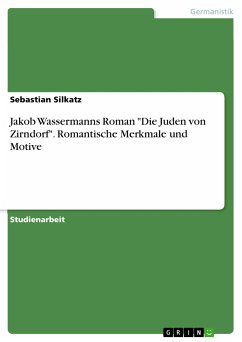Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,3, Georg-August-Universität Göttingen (Seminar für Deutsche Philologie), Veranstaltung: Probleme der Literaturtheorie, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Erzählungen vom Weltuntergang, und besonders im aktuellen Jahr 2012, das mit dem 21. Dezember den Tag enthält, an dem nach populärer Interpretation des Maya- Kalenders das Ende der Welt ansteht, ist die Apokalypse ein beliebtes, ernsthaft oder satirisch aufgegriffenes Motiv in Buch, Film und Nachrichten. Gemeinsam ist den Diskussionen um den Weltuntergang, ob nun in dem Film 2012 von Roland Emmerich, dem Roman Der Schwarm von Frank Schätzing oder der dritten Ankündigung der Apokalypse des amerikanischen Predigers Harold Camping (die offensichtlich, genau wie die vorherigen, nicht in Erfüllung gegangen ist), dass sie in aller Regel einen Spielraum für Überlebende lassen: Eine Arche, die einen ausgewählten Teil der Menschen überleben lässt, die Flucht in höher gelegene Gebiete oder eine höhere Kraft, die die Auserwählten vor dem Untergang rettet. Warum mindestens ein Überlebender für eine Erzählung vom Ende der Welt notwendig zu sein scheint, wurde in einer vorherigen Arbeit unter dem Aspekt der Sinnstiftung bereits dargelegt; in den vorliegenden Überlegungen soll es um einen erzähltheoretischen Aspekt gehen, der für eine Erzählung vom Weltuntergang mindestens einen Überlebenden verlangt, unabhängig davon, ob die Erzählung ohne selbigen sinnstiftend wäre oder nicht. Es soll nur darum gehen, ob eine solche Erzählung ohne Überlebende überzeugend und damit sinnvoll erzählt werden kann. Die Arbeit konzentriert sich auf den erzählten Raum und seine Beschreibungsmöglichkeiten, genauer gesagt auf die konkreten deiktischen Ausdrücke, mit denen Raum beschrieben und damit erzählt werden kann. Unter diesen Ausdrücken finden sich solche, die an eine Figurenperspektive gebunden sind und demnach die Frage aufwerfen, ob sie in einer Welt ohne Überlebende als Teil der Erzählung vom Raum angewendet werden können.