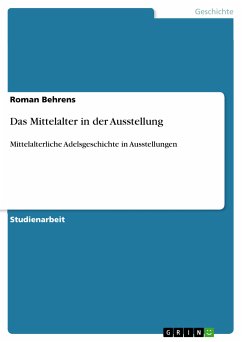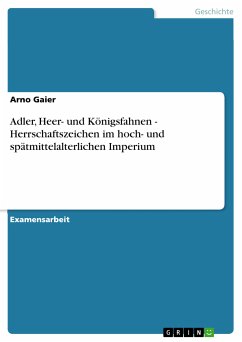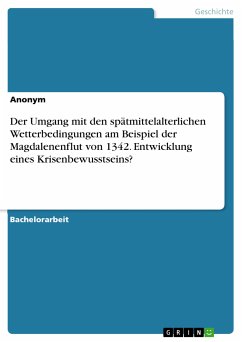Examensarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Historisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Einleitung Diese Arbeit soll einen Beitrag zur Erforschung des spätmittelalterlichen Hochadels leisten. Dabei werde ich mich auf den fürstlichen Hochadel(1), die Reichsfürsten(2), beschränken. Die Notwendigkeit, sich quellenimmanent mit dem Reichsfürstenstand zu beschäftigen, hat schon JULIUS FICKER angemahnt(3) und mit seiner umfangreichen Darstellung zum Reichsfürstenstand des Mittelalters einen großem Anfangsschritt in diese Richtung geleistet. Die Hinwendung zur Quellenkritik als Grundlage wissenschaftlicher Aussagen über verfassungs- und rechtsgeschichtliche Momente des Mittelalters erwuchs bei ihm aus den Widersprüchen, die sich zwischen den Aussagen der Rechtsbücher des 13. Jahrhunderts(4) und dem überlieferten Urkundenmaterial des Mittelalters ergaben. JULIUS FICKER entwickelte daraus die These, daß die Rechtsbücher als Erkenntnisquelle nur Gültigkeit haben, wenn die in ihnen enthaltenen Aussagen mit den in den Urkunden fixierten Rechtszuständen konform gehen(5). Tun sie dies nicht, ist den Urkunden als Quelle des historischen Erkenntnisprozesses der Vorrang einzuräumen. Der Grund dafür liegt in den verfassungs-, rechts- und letztendlich auch sozialgeschichtlichen Tatsachen, die in ihnen manifestiert sind. Die Beschäftigung mit den Eheverträgen des spätmittelalterlichen Fürstenadels eröffnet in dieser Hinsicht vielfältige Möglichkeiten der Erforschung von mittelalterlicher Wirklichkeit. [...] _______ (1) Zur Abgrenzung des fürstlichen vom nichtfürstlichen Adel und den „Grenzstufen“ (Fürstengenossen, gefürsteter Grafenstand) siehe weiter unten in Teil A. (2) Moraw, P., S. 118: „Es fehlen [...] Studien über die Fürsten im Reich insgesamt, auch über ihre politisch-gesellschaftlichen Kontakte untereinander und ihr reichsständisches Verhalten. Zusammenfassende Werke [...] nahmen ihren Ausgangspunkt beim Königtum und befaßten sich mit dem Fürstentum eher ex negativo.[...] (3) Ficker, J., S. VII; S. 19 f. (4) Goetz, H.-W., Proseminar, S.138: „Das älteste und bekannteste Werk ist der um 1225 entstandene Sachsenspiegel Eikes von Repgow, dessen lateinische Urfassung von Eike selbst ins Niederdeutsche übersetzt wurde [...] Nach seinem Vorbild entstanden um 1275 der Augsburger „Deutschenspiegel“ und der damit eng verwandte „Schwabenspiegel“, der ein allgemeines deutsches Recht bieten wollte. Im europäischen Horizont betrachtet, ordnen sich die „Spiegel“ in eine ganze Reihe solcher stets persönlich gefärbter Rechtsbücher ein.“ (5) Schönherr, F., S. 8