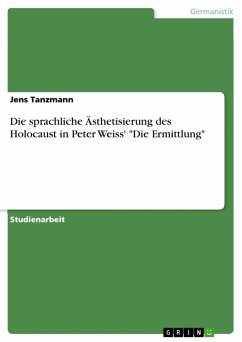Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,3, Univerzita Karlova v Praze, Veranstaltung: Hauptseminar Deutsche Literatur von 1945-68, Sprache: Deutsch, Abstract: Peter Weiss löst mit seinem Drama Die Ermittlung vor der Uraufführung im Jahre 1965 bei der Kritik heftige Proteste aus. Viele der Rezensenten assoziieren mit dem Bühnenwerk unmittelbar den Ausspruch Adornos: "[N]ach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch [...]." - Gemäß diesem vielzitierten Diktum des Frankfurter Philosophen, welches wohl auf alle literarischen Gattungen und ebenso auf andere Kunstformen übertragen werden kann und in aktuellen Diskussionen über das Gedenken an den Holocaust noch immer angeführt wird -, wäre eine Literatur nach Auschwitz und erst Recht ein Theaterstück über Auschwitz nicht denkbar. Peter Weiss gibt Adorno Recht darin, daß Auschwitz als Ganzes nicht faßbar sei, sondern lediglich ein Ausschnitt aus dieser Thematik künstlerisch umgesetzt werden könne. Allerdings ist für Weiss, gerade wegen der Unfaßbarkeit des Holocausts, die künstlerische Darstellung solcher Ausschnitte nötig, da der Fakt, daß die Schoah stattgefunden hat, "Bestandteil unseres Lebens ist". Der Dramatiker Weiss ist sich der Problematik der literarischen Ästhetisierung des Holocausts spätestens bei Erscheinen des Hochhuth Dramas Der Stellvertreter aus dem Jahr 1963, in dem der letzte Akt im Lager Auschwitz spielt, vollkommen bewußt. Noch 1964 schreibt er: "Wir müssen etwas darüber sagen. Doch wir können es noch nicht." Im Gespräch mit Girnus / Mittenzwei bemerkt er ebenfalls dazu: "Das Lager Auschwitz oder welches Lager auch immer auf der Bühne darzustellen, ist eine Unmöglichkeit. Ja eine Vermessenheit, es überhaupt nur zu versuchen, man kann diesen Gedankenkomplex überhaupt nur von heute aus im Rückblick beobachten und versuchen zu analysieren, was da vorgegangen ist." Weiter notiert er in den Anmerkungen zur Ermittlung, daß die Rekonstruktion des Prozesses über die Auschwitz-Täter ihm anfänglich ebenso unmöglich erschien, "wie es die Darstellung des Lagers auf der Bühne wäre." (9) Doch bereits kurz nach Beginn des Frankfurter Prozesses revidiert Weiss seine Ansicht in dieser Beziehung und merkt an: "zuerst dachte ich, es ließe sich nicht beschreiben, doch da es Taten sind, von Menschen an Menschen begangen -" So entschließt sich Weiss, Auschwitz als Chiffre für das Äußerste, was Menschen anderen Menschen antun können, in der Ermittlung indirekt über den Frankfurter Prozeß auf die Bühne zu holen. In der Wahl seiner Mittel, die, wie er oben einräumt, dem Thema Holocaust nur sehr schwer gerecht werden können, geht er einen anderen Weg als Hochhuth. Er reduziert ihren Einsatz auf ein Minimum - ein Versuch, dem er übrigens sehr kritisch gegenübersteht, denn er äußert die Befürchtung, die Darstellung der Schrecken könne dem Rezipienten eine "heile Welt" vorgaukeln - was natürlich nicht Sinn der Ermittlung sein soll. So rechtfertigt Weiss in seiner Rede anläßlich der Entgegennahme des Lessingpreises der Freien Hansestadt Hamburg am 23. April 1965 die Form der Ermittlung und stellt fest: "daß die Verwendung dieser kaum mehr tauglichen Mittel besser ist als das Schweigen und die Fassungslosigkeit." Die Art und Weise wie Peter Weiss das ihm vorliegende Material verarbeitet, interpretiert und auf die Bühne bringt, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Daneben wird der Frage nachgegangen, welche Gestaltungsmittel der Autor benutzte und welche aufgrund des Themas Auschwitz versagen müssen. Abschließend soll Die Ermittlung im Kontext aktueller politischen Debatten um Vergangenheitsbewältigung und Erinnerung an den Holocaust in der Bundesrepublik betrachtet werden. Im folgenden werden jedoch zunächst die biographischen Bezüge Weiss' zur nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie und zum Ort Auschwitz aufgezeigt, dann in einem Exkurs das dokumentarische Theater als beliebtes Genre der sechziger Jahre vorgestellt und schließlich das Rohmaterial für Die Ermittlung, der Frankfurter Auschwitz-Prozeß, knapp skizziert.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.