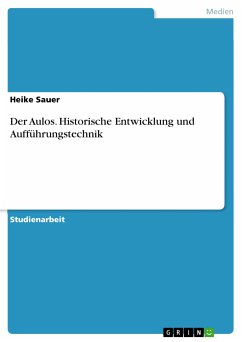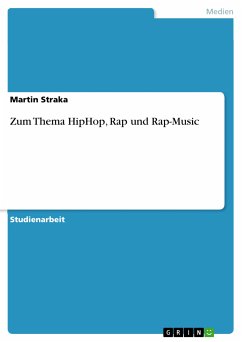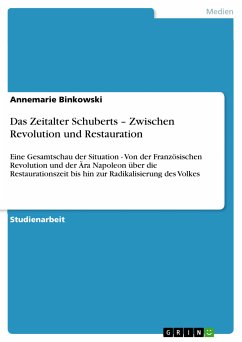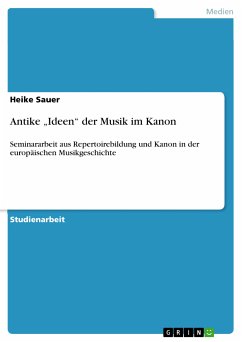Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Musik - Sonstiges, Note: sehr gut, Universität Wien (Institut für Musikwissenschaft), Veranstaltung: Historisch musikwissenschaftliches Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: „So heißt das Musikinstrument ‚Aulos’, weil die Luft hindurch geht, und alles was, geradlinig ausgestreckt ist, nennen wir Aulos, wie das Stadion und den Blutstrom.“ (Athenaios, Deipnosophistai V, 189 b,c) Auf diese Weise erklärt Athenaios (um 200 nach Chr.) in seinem „Gelehrtenmahl“ das Wort ‚Aulos’ (αυλός), und führt anschließend weitere Übersetzungsmöglichkeiten für ‚Aulos’ oder etymologisch sehr nah verwandte Wörter auf. So seien auch ‚Hof’, ‚Abgrund’, ‚Höhle’ und ‚Palast’ damit bezeichnet worden. Das Wort selbst ist indogermanischer Herkunft; ob die Indogermanen darunter jedoch schon ein Blasinstrument verstanden, oder aber damit einfach eine Röhre oder einen Hohlraum bezeichneten, hat sich bis heute noch nicht klären lassen. Man ist sich nicht einmal sicher, ob in der früheren Instrumentengeschichte ‚Aulos’ nicht nur als ein übergeordneter Sammelbegriff für Blasinstrumente fungierte. Der Aulos war ein Instrument, das in der Regel paarig gespielt wurde. Das bedeutet, dass zwei unabhängige Röhren, in einem spitzen Winkel zueinander, gleichzeitig verwendet wurden, und dass der Aulet zwei Mundstücke zugleich bewältigen musste. Daraus geht auch die häufig gebrauchte Pluralform ‚Auloi’ hervor, die demnach nicht unbedingt mehrere Instrumentalisten voraussetzen muss. Die Bohrung der Röhren war meist zylindrisch oder nur minimal konisch, wie es dem natürlichen Wachstum von Knochen, Schilfrohren oder Hölzern entspricht. Den ursprünglichen, einfachen Aulos beschreibt der griechische Schriftgelehrte Pollux (2. Hälfte des 2. Jh. nach Chr.) in seinem „Namenslexikon“ derart exakt, dass man sich genaue Vorstellungen von diesem Instrument machen kann (Abbildung 1): Bombyx (βόµβυξ) bezeichnet die Röhre, in die die Trypemata (τρυπήµατα), die Grifflöcher, eingearbeitet sind. Zwischen Bombyx und dem Mundstück Zeugos (ζευγος), das manchmal auch nur durch das Teilstück Glotta (γλωττα), die sogenannte Zunge, umschrieben wird, sitzen zwei eiförmige Zwischenstücke, Holmos (όλµος) und Hypholmion (υφόλµιον).