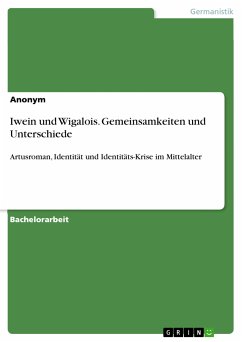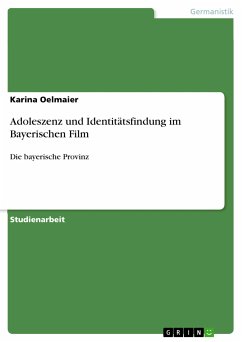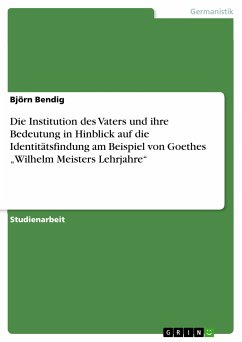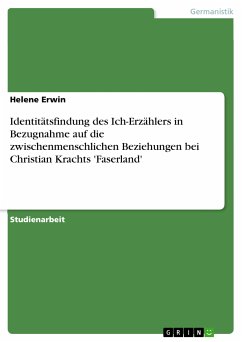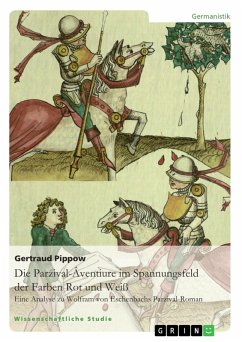Studienarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1, Technische Universität Chemnitz (Mediävistik), Veranstaltung: Hauptseminar: Hartmann von Aue -Iwein-, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Zentrum dieser Interpretation soll das Problem der Identitätsfindung in Hartmanns "Iwein" stehen. Ich werde damit beginnen, die Prämissen meiner Argumentation darzustellen, um dann auf dieser Grundlage meine Sichtweise illustrieren zu können. Ich isoliere zur Umsetzung meines Anliegens einige Schwerpunkte aus dem umfangreichen Angebot möglicher Aspekte des Romans und kann somit dem Text auch nur auf dieser eingeschränkten Ebene gerecht werden. Mein besonderes Interesse gilt in dieser Arbeit dem nach meiner Meinung dualistischen Aufbau des Textes (Gesellschaftsideal vs. mythologischer Bereich), der Gegenüberstellung beider Pole und den sich aus dieser Konstellation ableitenden Konsequenzen für das Werk als solches. Mich jâmert wærlîchen, / und hulfez iht, ich woldez clagen, / daz nû bî unseren tagen / selch vreude niemer werden mac / der man ze den ziten pflac. / doch müezen wir ouch nû genesen. / ichn wolde dô niht sîn gewesen, / daz ich nû niht enwære, / dâ uns noch mit ir mære / sô rehte wol wesen sol: dâ tâten in diu werc vil wol. (Vers 48-58) Mit diesen sowohl klagenden als auch richtungsweisenden Worten beschließt Hartmann von Aue den Prolog zum "Iwein". Die Zeiten großer Heldentaten und deren Ideale seien vergangen; was bliebe, sei allein die Bewahrung einer Erinnerung im literarischen Text. Aus diesem programmatischen Anliegen des Autors resultiert eine Unterordnung des Romans unter funktionelle Aspekte. Ort der Wertediskussion ist das ästhetische Werk, das, auf diese Weise in die Pflicht genommen, eine über die Textebene hinausweisende Interpretation ermöglicht: Nicht das Individualschicksal der einzelnen literarischen Figuren wird in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt, sondern vielmehr deren Funktion als personifizierte Wertvorstellung; deren Rolle innerhalb der Möglichkeiten eines künstlerischen ′Programms′. Das gilt selbst dann, wenn, wie im Falle Iweins, der Protagonist am stilisierten Wertideal (vorerst) scheitert und erst im Verlaufe der Handlung (in einem Stil, der an den Typ des Bildungsromans erinnert) in die Lage versetzt wird, diesem gerecht zu werden. Der Roman beginnt mit einer allgemeinen Sentenz, die die Kernbegriffe des Romans einführt: güete, sælde und êre. Daran schließt sich eine Erklärung an, die darauf zielt, die Erzählung über König Artus unter diese Aspekte unterzuordnen (Verse 4 ff). Die Erwähnung des Artushofes dient demnach als ein Beispiel, eine Illustration, für ein übergreifenderes Ziel. [...]