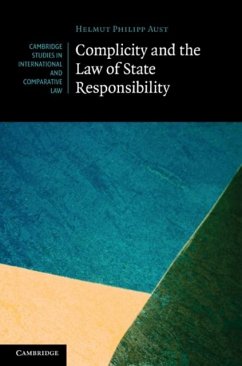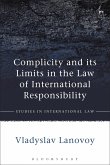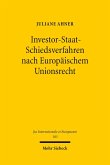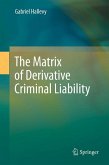This systematic analysis of State complicity in international law focuses on the rules of State responsibility. Combining a theoretical perspective on complicity based on the concept of the international rule of law with a thorough analysis of international practice, Helmut Philipp Aust establishes what forms of support for wrongful conduct entail responsibility of complicit States and sheds light on the consequences of complicity in terms of reparation and implementation. Furthermore, he highlights how international law provides for varying degrees of responsibility in cases of complicity, depending on whether peremptory norms have been violated or special subject areas such as the law of collective security are involved. The book shows that the concept of State complicity is firmly grounded in international law, and that the international rule of law may serve as a conceptual paradigm for today's international legal order.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Winke an die Richter in Den Haag: Helmut P. Aust buchstabiert die Verantwortung von Staaten für Beihilfe zu völkerrechtswidrigen Handlungen.
In Wirklichkeit jagen Staaten im Rudel, doch möchten sie lieber als Einzeljäger wahrgenommen werden", bemerkte vor einigen Jahren James Crawford, Sonderberichterstatter für Staatenverantwortlichkeit der UN-Völkerrechtskommission. Crawfords Beobachtung macht deutlich, warum die Verantwortlichkeit von Staaten für Beihilfe zu Völkerrechtsverletzungen immer noch zahlreiche Fragen aufwirft. Verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rückten fragwürdige Unterstützungshandlungen, als mit der Aufarbeitung der politisch-militärischen Reaktionen auf "9/11" begonnen wurde. Vor allem der von Präsident Bush initiierte Irak-Krieg, den Dutzende von Staaten in unterschiedlichem Maße unterstützten, sowie das Vorgehen gegen Terrorismusverdächtige, etwa deren Transfer zu Verhören in sogenannte Folterstaaten, haben die Aufmerksamkeit für die Verantwortlichkeit von Staaten für Hilfsleistungen zu Völkerrechtsverletzungen geschärft. Höchste Zeit also, dieses grundlegende Thema der Völkerrechtsordnung rechtswissenschaftlich aufzuarbeiten.
Einen entscheidenden Beitrag dazu hat der Völkerrechtler Helmut Philipp Aust von der Humboldt-Universität zu Berlin geleistet. Mit seinem Buch "Complicity and the Law of State Responsibility" zur Idee und Bedeutung, zu Voraussetzungen, Rechtsfolgen und Problemen der Beihilfe zu Völkerrechtsdelikten hat Aust die erste englischsprachige Monographie zur Haftung von Staaten für die Unterstützung völkerrechtswidrigen Tuns vorgelegt.
Im Zentrum der Arbeit steht Artikel 16 des Entwurfs der Völkerrechtskommission von 2001, in dem die Verantwortlichkeit von Staaten für "Hilfe oder Unterstützung bei der Begehung eines völkerrechtswidrigen Handelns" geregelt ist. Geschichte, Inhalt, Struktur, und völkerrechtlicher Kontext der Norm werden vom Autor umfassend und präzise analysiert. Dazu gehören auch die Konflikte zwischen Recht, Moral und Politik, die Entstehungsgeschichte und Auslegung der Beihilfevorschrift prägen. Aust bezieht dabei die Position eines sorgfältig abwägenden Pragmatikers, der völkerrechtliche Defizite klar benennt, aber wohltuend auf moralischen Rigorismus verzichtet.
Insgesamt zeichnet sich das Buch durch hohen Praxisbezug aus. Anhand einer umfangreichen Sammlung von Fällen zum Vorwurf der Beihilfe demonstriert Aust nüchtern und sachlich, wie weit und vielfältig das Spektrum der Staatenverantwortlichkeit für völkerrechtswidrige Hilfsleistungen ist: Von der Unterstützung unzulässiger militärischer Gewalt, etwa durch Erlaubnis zur Nutzung von Luftstützpunkten oder Gewährung von Überflugrechten, über die Mitwirkung von Drittstaaten an der Auslieferung verdächtiger Straftäter wie im Fall des Rüstungslobbyisten Karlheinz Schreiber, bis zu Fällen kontroverser ökonomischer Aktivitäten, zum Beispiel durch Gewährung von Kreditbürgschaften, mit denen zunächst auch Österreich, die Schweiz und Deutschland das türkische Ilisu-Staudammprojekt unterstützten.
Austs Überblick macht fast beiläufig deutlich, dass Deutschland in vielfältigen Konstellationen mit Vorwürfen der Beihilfe zu Völkerrechtsdelikten konfrontiert worden ist. Anderen westlichen Staaten ergeht es ähnlich. Umso mehr fällt auf, mit welcher Beharrlichkeit gerade Deutschland während der jahrelangen Vorarbeiten zu Artikel 16 der Ansicht widersprach, dass die geplante Beihilferegelung eine Norm des Völkergewohnheitsrechts sei. Die jeweilige deutsche Regierung nahm damit nicht nur international eine Außenseiterposition ein, ihre Haltung widersprach auch der völkergewohnheitsrechtlichen Lesart des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts. Dass Artikel 16 Völkergewohnheitsrecht entspreche, wurde schließlich auch vom Internationalen Gerichtshof in seinem wegweisenden Urteil zum Massaker von Srebrenica bestätigt. Der Haager Richterspruch von 2007 ließ allerdings zahlreiche Fragen zur Beihilfe offen. Umstritten ist vor allem, inwieweit die Verantwortlichkeit eines Staats wegen Unterstützung von Völkerrechtsverletzungen an subjektive Voraussetzungen gebunden ist.
Mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand des Völkerrechts hält Aust Vorsatz als Bindeglied zwischen der unterstützenden Tätigkeit und dem völkerrechtswidrigen Handeln für unverzichtbar. Der Autor distanziert sich damit von manchen progressiven Völkerrechtlern und Menschenrechtsaktivisten, die befürchten, dass Staaten sich allzu leicht ihrer Verantwortung entziehen könnten und Artikel 16 eine stumpfe Waffe im Kampf gegen Völkerrechtsverletzungen zu werden drohe, wenn man die Beihilfeverantwortlichkeit an den Nachweis von Vorsatz knüpfe.
Aust entgegnet darauf, dass die Völkerrechtsordnung nicht notwendigerweise gestärkt werde, wenn man den Kreis der Mitverantwortlichen für völkerrechtswidrige Akte so weit ziehe, dass selbst Staaten haften müssten, denen ein entsprechender Vorsatz nicht nachzuweisen sei. Vielmehr sei zu befürchten, dass sich Regierungen dann aus Sorge vor möglichen negativen Konsequenzen insgesamt weniger kooperationswillig zeigten. Durch neuen Isolationismus sei der Entwicklung internationaler Beziehungen jedoch gewiss nicht gedient. Seine pragamatische Argumentationslinie untermauert der Autor historisch-teleologisch, indem er die Befürworter einer extensiven Interpretation von Artikel 16 immer wieder daran erinnert, dass die Beihilfenorm an Verhalten anknüpfe, das für sich genommen rechtmäßig sei und erst im Zusammenhang mit der völkerrechtswidrigen Haupttat seinen Unrechtscharakter bekomme.
Aber welchem Nutzen kann Artikel 16 bei restriktiver Interpretation überhaupt haben? Ein "gewisses Gefühl der Entäuschung" könne schon aufkommen, räumt Aust ein, zumal der Internationale Gerichtshof sich in wichtigen Fällen zum Vorwurf der Beihilfe für unzuständig erklärt habe. Und zwar unter Hinweis auf das Konsensprinzip, wonach Drittstaaten nicht ohne ihre Zustimmung in Verfahren hineingezogen werden sollen. Kritisch bemerkt Aust zu dieser Haager Rechtsprechung, dass die Normierung gesteigerter staatlicher Mitverantwortlichkeit für völkerrechtswidriges Handeln auch prozessrechtlich flankiert werden müsse. Fehle es an Durchsetzungsmechanismen, drohe eine "Glaubwürdigkeitslücke".
Bleibt es also beim bloßen Lippenbekenntis, wenn Artikel 16 Verantwortlichkeit für Beihilfe zu völkerrechtswidrigem Handeln statuiert? Diese pessimistische Interpretation greife zu kurz, legt Aust in einem breiten Streifzug durch das Völkerrecht dar, auf dem er Ausschau hält nach Normen und Konzepten zur Stärkung und Ergänzung von Artikel 16. Fündig wird er unter anderem im System kollektiver Sicherheit, im humanitären Völkerrecht sowie in den Vereinbarungen zum Schutz der Menschenrechte, wo der Autor Regelungen wie die Verpflichtung zur Verhütung von Völkermord oder das völkerrechtliche Ausweisungs- und Zurückweisungsverbot zum Schutz von Flüchtlingen (Non-Refoulement-Prinzip) als denkbare "funktionelle Äquivalente" zum Beihilfeverbot identifiziert. Durch diese Vernetzung von Normen öffnet und schärft Aust den Blick dafür, wie das Prinzip der Staatenverantwortlichkeit bereits mit relativ bescheidenen Mitteln gestärkt werden könnte, indem Staaten bei sich anbahnenden Krisen frühzeitig überprüfen, ob sie womöglich im Begriff sind, völkerrechtswidriges Handeln zu unterstützen. Freimütig gesteht der Autor freilich zu, dass die Praxis vielfach anders aussieht. Um das Potential des Beihilfekonzepts zur Stärkung der Staatenverantwortlichkeit auszuschöpfen, so der Autor, müssten zunächst einmal Entscheidungsträger und Juristen, die mit Völkerrechtsfragen befasst seien, den entsprechenden Normen mehr Aufmerksamkeit schenken. Eine profunde und zugleich griffige Anleitung dazu gibt Helmut Aust ihnen mit seinem Buch an die Hand.
KATJA GELINSKY
Helmut Philipp Aust: "Complicity and the Law of State Responsibility".
Cambridge University Press, Cambridge 2011. 520 S., geb., 104,43 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
'It was high time for an academic treatment of this fundamental issue for the international legal order. A decisive contribution in this regard has now been made by Helmut Philipp Aust ... The history, content, structure and international legal context of the norm are analysed by the author in a comprehensive and precise manner. This is also true for the conflicts between law, morals and politics which impact upon the development and interpretation of the rule on complicity. Aust takes the position of a carefully balancing pragmatist who clearly identifies international legal deficits, but refrains from moral rigour. In general, the book excels in its high relevance to practice.' Translated from the Frankfurter Allgemeine Zeitung