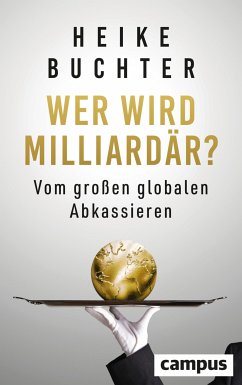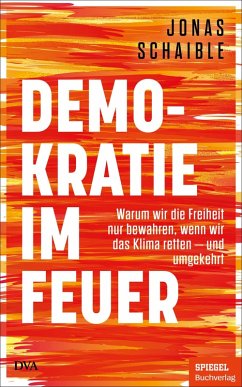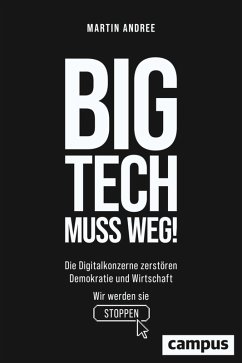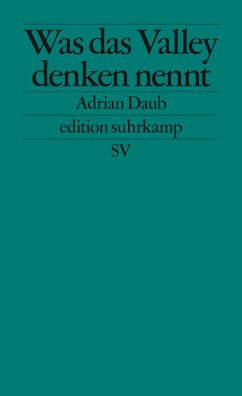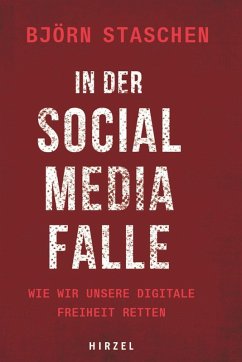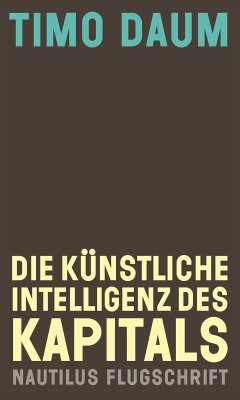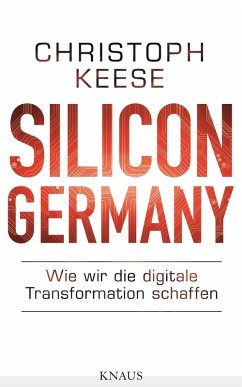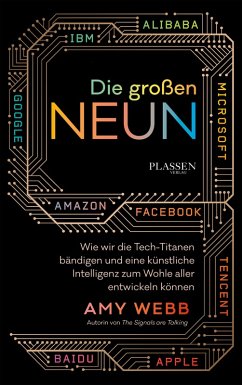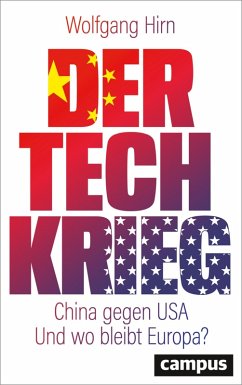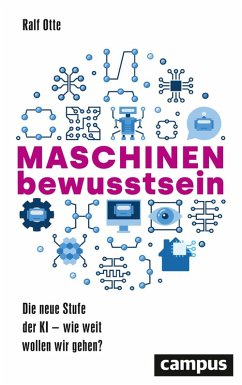Martin Andree
eBook, ePUB
Big Tech muss weg! (eBook, ePUB)
Die Digitalkonzerne zerstören Demokratie und Wirtschaft - wir werden sie stoppen
Sofort per Download lieferbar
Statt: 25,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Digitale Monopole bringen immer größere Teile unserer Lebenswelt unter ihre Kontrolle. Die Plattformen dominieren zunehmend die politische Meinungsbildung und schaffen zugleich unsere freie Marktwirtschaft ab. Man fragt sich: Ist das überhaupt noch legal? Warum sollten wir uns das noch länger gefallen lassen? Der Medienwissenschaftler Martin Andree zeigt messerscharf, wie weit die feindliche Übernahme unserer Gesellschaft durch die Tech-Giganten schon fortgeschritten ist - und wie wir uns das Internet zurückerobern können.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 16.95MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
Prof. Dr. Martin Andree lehrt Medienwissenschaft an der Universität zu Köln. Er forscht seit mehr als 15 Jahren zur Dominanz von Big Tech. Führende deutsche Medien (u.a. öffentlich-rechtliches Fernsehen und führende Zeitungen) und Konferenzen (u.a. der Digitalgipfel der Bundesregierung) greifen für Beiträge zu diesem Thema regelmäßig auf seine Expertise zurück. Im Jahr 2020 veröffentlichte er den hoch angesehenen »Atlas der digitalen Welt«. Er erhielt den Günter-Wallraff-Sonderpreis für Pressefreiheit und Menschenrechte für das Buch »Big Tech muss weg« (2023). Prof. Dr. Martin Andree teaches media science at Cologne University in Germany. He has been doing research on the dominance of Big Tech for more than 15 years. Leading German media (including public television and leading newspapers) and conferences (including the Digital Summit of the Federal German Government) regularly call on his expertise for contributions on this subject. In 2020, he published the book »Atlas der digitalen Welt«, which has a strong reputation. He received the Günter Wallraff Special Award for Press Freedom and Human Rights for his book »Big Tech muss weg!« (2023), which has also been published in English (»Big Tech Must Go!«, 2025). He studied in Cologne, Münster, Cambridge and Harvard.
Produktdetails
- Verlag: Campus Verlag GmbH
- Seitenzahl: 288
- Erscheinungstermin: 16. August 2023
- Deutsch
- ISBN-13: 9783593454719
- Artikelnr.: 67780116
»Eine energische Kampfschrift gegen die Macht der Tech-Riesen und deren Missbrauch.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung »Schluss mit Big Tech - ein schöner, demokratischer Gedanke.« ttt (ARD) »Selten hat einer wie Andree die schöne neue Internetwelt so nachvollziehbar erklärt, hat Gewinner und Verlierer so klar benannt und die unabweisbaren Gefahren für Demokratie und Wirtschaft aufgezeigt.« Deutsche Welle »Martin Andree zeigt sehr eindringlich, wie wenig Unternehmen das Internet gekapert haben - und was zu tun ist, um die Demokratie zu retten.« Welt am Sonntag »Warnungen vor der Macht der großen Tech-Konzerne gibt es viele - doch wenige deutsche Experten formulieren ihre Thesen so vehement wie Martin Andree.« Die Welt »Martin Andree sieht die großen Tech-Unternehmen und ihre Betriebsgeheimnisse als gefahr für Demokratie und Wirtschaft. Er plädiert dafür, das Netz zu liberalisieren.« Kulturjournal (NDR) »Das Buch ist faszinierend und schön zu lesen.« Correctiv »Martin Andree beschreibt, welche Folgen die Machtkonzentration von Big Tech für unsere demokratischen Grundstrukturen und die Wirtschaft hat. Und er zeigt auf, wie es gelingen kann, das Netz zu befreien.« Computerwoche
Gebundenes Buch
Dieses Buch muss man unbedingt lesen, denn die Inhalte sind einfach Wow, und geben Erkenntnisse und Vorschläge, die man einfach kennen MUSS.
Bin immer noch schwer beeindruckt und begeistert, obwohl paar Tage bereits ins Land gezogen sind, seit die letzte Seite umgeblättert wurde.
Sehr …
Mehr
Dieses Buch muss man unbedingt lesen, denn die Inhalte sind einfach Wow, und geben Erkenntnisse und Vorschläge, die man einfach kennen MUSS.
Bin immer noch schwer beeindruckt und begeistert, obwohl paar Tage bereits ins Land gezogen sind, seit die letzte Seite umgeblättert wurde.
Sehr zugänglich, mit vielen einleuchtenden Beispielen, Aufstellungen usw., sodass wirklich jeder diese Inhalte auf Anhieb begreifen kann. Also bitte keine Hemmungen aufgrund antizipierter Komplexität.
Sehr leserfreundlich ist der Stoff aufbereitet: Nur das nötigste dargelegt. Keine weit schweifende Exkursionen oder ähnl. Knapp, präzise und auf den Punkt. Wunderbar.
Die Inhalte sind explosiv wie einmalig. Viel Wissen und Können gehören dazu, die Daten zum Zustand der Ist-Situation korrekt zu erheben, sie zu interpretieren/ in voller Tiefe zu begreifen, was das alles zu bedeuten hätte und was für „tolle“ Auswirkungen für es für uns alle mit sich bringt, wenn es so weitergeht. U.a. spricht Prof André offen darüber, anhand welcher (illegaler wie unmoralischer) Tricks Big Tech Konzerne die öffentliche Meinung und das Verhalten der Massen manipulieren, um eigenen Nutzen daraus zu ziehen, in vielerlei Hinsicht. Sehr überzeugend. Er steht damit nicht allein da. Schon Shoshana Zuboff in „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“ hat auf diese Machenschaften seitens Google hingewiesen, so der Autor, ähnlichen Weg ist dann auch Facebook gegangen.
Ich kann all dem nur zusammen, das Zuboffsche Buch habe ich damals, als es neu herauskam, gelesen. Und ich beobachte das Treiben der Konzerne seit Längerem. Meine Erkenntnisse und Erfahrungen gehen konform mit dem, was Prof André berichtet. Er hat eine umfassendere Perspektive und spricht vom Verkauf der Nutzerdaten an die amerikanischen Geheimdienste, die Einflussnahme der Big Tech Konzerne in der hohen Politik, das Anfüttern der Vertreter der ehem. Leitmedien, in Millionenhöhe und somit die Einflussnahme auf ihr Verhalten uvm.
Prof. André kritisiert auch das bestehende Rechtssystem samt dessen entsprechenden Organen und legt dar, dass es in diesem System keine wirksame Handhabe gegen die Allmacht der Monopole gibt.
Viel Mut gehört dazu, diese Erkenntnisse so wunderbar für die breite Leserschaft vorzubereiten und zu veröffentlichen. Hut ab.
Dieses Werk sollte ein Klassiker werden und jedem bekannt sein, wirklich jedem. Denn um die prekäre Lage zu vermeiden, in die man erst gar nicht geraten möchte, muss sich vieles ändern.
Die Lösungsvorschläge haben Hand und Fuß. Eine wohl konzipierte, gründliche Rundumerneuerung. Schön wäre es.
Es ist noch viel mehr im Buch. Lesen Sie selbst. Eine gute Idee. Reden Sie darüber im Freundes-/Bekannten-/Familienkreis. Toller Diskussionsstoff ist da.
Die hochwertige Buchgestaltung mit all den Diagrammen, in Farbe!, uvm. macht das Buch zum tollen Geschenk/Mitbringsel.
Fazit: Großartiges Werk. Selbst lesen und weiter sagen! Tolle Inhalte, sehr zugänglich erklärt. Ein Must read! Definitiv.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für