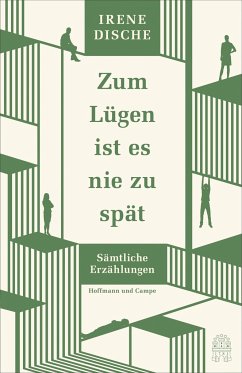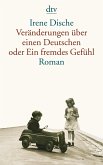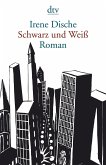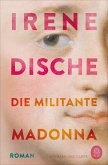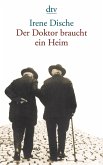Der legendäre Erzählband "Fromme Lügen" machte Irene Dische mit einem Schlag zur Bestsellerautorin. Jetzt sind endlich alle ihre wunderbaren und wundersamen Erzählungen in einem Band versammelt - ergänzt um zwei neue, bislang unveröffentlichte Texte.
Verlorene Muttersöhnchen, allzu selbstbewusste Versager, Außenseiter, Gestrandete, Emigranten, Juden, lebenstüchtige Frauen und männliche Weicheier, liebenswürdige Schmarotzer, schlitzohrige Verwirrte und anderes buntes Personal bevölkern Irene Disches Erzählungen, die mit haarsträubenden Schicksalen und unerhörten Wendungen aufwarten. Ein erzählerischer Kosmos - zwischen Berlin und New York - voller Familien-, Liebes-, Emigranten-, Lebens- und Lügengeschichten, erzählt in Irene Disches unverwechselbarem Stil - "von graziöser Leichtigkeit, sparsam und genau in den Mitteln, heiter und trocken im Ton, dabei verstohlen zärtlich" ("Der Spiegel").
Verlorene Muttersöhnchen, allzu selbstbewusste Versager, Außenseiter, Gestrandete, Emigranten, Juden, lebenstüchtige Frauen und männliche Weicheier, liebenswürdige Schmarotzer, schlitzohrige Verwirrte und anderes buntes Personal bevölkern Irene Disches Erzählungen, die mit haarsträubenden Schicksalen und unerhörten Wendungen aufwarten. Ein erzählerischer Kosmos - zwischen Berlin und New York - voller Familien-, Liebes-, Emigranten-, Lebens- und Lügengeschichten, erzählt in Irene Disches unverwechselbarem Stil - "von graziöser Leichtigkeit, sparsam und genau in den Mitteln, heiter und trocken im Ton, dabei verstohlen zärtlich" ("Der Spiegel").

© BÜCHERmagazin, Tanja Lindauer (lin)

Eine Begegnung mit der Schriftstellerin Irene Dische, deren gesammelte Erzählungen "Zum Lügen ist es nie zu spät" jetzt erscheinen
Die letzte Erzählung ist abgegeben, und was folgt, muss man sich so vorstellen: Irene Dische und die Schauspielerin Angela Winkler sitzen in der Küche und knabbern Kürbiskerne von Brötchen, die sie gerade im Lidl gegenüber gekauft haben. Kleine Küche in großer Wohnung am Kurfürstendamm in Berlin. Die Mischung zwischen gigantischen Bücherregalen und etwas schrammeliger Einrichtung macht das Bürgertum Berlin-West ja erst aus, es ist der Gipfel des Understatements. Die richtige Art, ein Möbel zu verachten, es aber sich trotzdem hinzustellen, weil es dann doch nützlich ist. Das Sofa zum Beispiel im Wohnzimmer: wichtig, aber bitte kein Designerstück.
An der Wand des Esszimmers hängt ein Schwarzweißbild, darauf sieht man ihren Großvater, der Chirurg im Ersten Weltkrieg war, mit einer Säge in der Hand, daneben einen amputierten Oberschenkel, dahinter fröhliche Krankenschwestern mit Hüten, die an den Ku-Klux-Klan erinnern. Es ist ein fast komisches Bild, das zugleich auch die Schriftstellerin Irene Dische beschreibt, vielleicht sogar ein wenig den Stil ihrer Bücher: bissig, hart, aber humorvoll und nicht bösartig. Man erkennt in dem Bild und ihren Büchern eine Art zarter Überlegenheit.
Da kommt Elisabeth Plessen um die Ecke in die kleine Küche, so unvermittelt wie ein Hauself aus "Harry Potter". Sie ist die Übersetzerin von Irene Disches im Herbst erschienenem Roman "Schwarz und Weiß", außerdem selbst Autorin und Intellektuelle und die Witwe von Peter Zadek. Da knabbern nun sehr Intellektuelle an den Kürbiskernbrötchen und besprechen die Lage der Welt.
Man möchte sagen: Willkommen in der Welt der Irene Dische. Diese Welt kennt nicht viele Grenzen: Irene Dische ist Österreicherin, Amerikanerin und Jüdin. Sie gehört zu den wichtigen Schriftstellerinnen im deutschsprachigen Raum, ist Autorin von Bestsellern wie "Großmama packt aus" und "Fromme Lügen" - und zugleich Darling der "New York Times" und Mitarbeiterin des "New Yorker". Die Welt ihrer Gedanken aber ist eine Mischung aus Holocaust-Trauma und Willy Wonkas düster-phantastischer Schokoladenfabrik aus dem Film mit Gene Wilder.
Es ist fast ein bisschen zu viel. Angela Winkler berichtet jetzt, wie sie einmal in Rom einem Polizisten eine runtergehauen hat und dafür verhaftet wurde. Irene Dische berichtet von ihrer Arbeit an ihren Erzählungen "Zum Lügen ist es nie zu spät", ihrer Arbeit mit Schimpansen, ihrer Freundschaft mit dem polnischen Kamikaze-Journalisten Ryszard Kapuscinski . . . aber dazu später. Für einen Moment sieht man Disches Ehemann Nicolas Becker den Flur entlanglaufen: Er ist ehemaliger Anwalt von Erich Honecker, Manfred Krug, Mitgliedern der RAF und inzwischen auch von arabischen Familienclans in Berlin-Neukölln. Hinter ihm schlendert Silvester Groth, einer der Bösewichte des Deutschen Kinos. Sie sind manchmal zum Einkaufengehen verabredet.
So. Elisabeth Plessen ab (muss was erledigen), Angela Winkler ab (muss "Dreigroschenoper" am Berliner Ensemble spielen), Nicolas Becker ab, Silvester Groth ab (müssen einkaufen gehen). Im Nebenzimmer kippt die Stimmung. Disches Tochter Emily liest einen Retweet von Julian Reichelt von der "Bild"-Zeitung vor.
Irene Dische wächst in New York als Tochter von jüdischen Emigranten auf. Mutter Maria Renate ist Pathologin. Vater Zacharias Biochemiker. Ihre erste Obduktion beobachtet Irene Dische mit sieben Jahren. Ihre Jugend ist schön, wenn sie auch weiß, dass sie weder hier noch da richtig dazugehört: Die Eltern denken auch in Amerika europäisch, sprechen deutsch. Ihre papsttreue und antisemitische Großmutter sorgt dafür, dass die Enkelin streng katholisch erzogen wird (sie redet oft vom Höllenfeuer). Jüdische und katholische Verwandte, die um eine Kinderseele rangeln: Das ist der klassische Stoff, der den Ton von Irenes Büchern prägt.
Nach Flucht und Zerstörung ist die Familie nicht sonderlich reich, Irene besucht trotzdem sehr gute Schulen. Das Einzige, was ihr fehlt, ist die Wahrheit: "Es ist viel über den Holocaust geschrieben worden", sagt Irene Dische. "Aber als Kind von Überlebenden wächst du mit einem Schweigen der Eltern auf. Man redete darüber nie." Die Flucht ihrer Eltern beschreibt Dische in ihrem Dokumentarfilm "Zacharias", der 1986 den Eduard-Rhein-Preis erhielt. In Lemberg geboren, in Wien aufgewachsen, entkommt Zacharias Dische sehr knapp über Frankreich den Nazi-Mördern und landet in New York.
Wir hängen inzwischen auf zwei sehr großen roten Sofas im Wohnzimmer herum. Im Bücherregal steht all das, was in ihrer Kindheit ausgespart wurde, etwa: "Das Who is Who des Nationalsozialismus vor und nach 1945". Irene Dische berichtet von einem Moment, als ihr Bruder und sie ein Buch über Auschwitz in der Wohnung der Eltern fanden. Als sie darin blättern, kommt der wütende Zacharias und sagt, ernst und voller Entsetzen: "Das ist Pornographie." Er will nicht, dass in den Köpfen der Kinder die eigene Geschichte zum interessanten Gruselroman wird.
"Mit 16 wollte ich endlich Amerikanerin werden", erzählt Irene Dische. "Ich wollte das Europäische meiner Familie wohl irgendwie loswerden. Meine Eltern waren sehr verankert in Europa. Da habe ich mich erst mal in die Berge von Colorado abgesetzt. Ich wollte alles selbst entdecken: die Welt außerhalb meiner jüdischen New York Community. Da landete ich natürlich als Erstes im Gefängnis."
Als Minderjährige, unterwegs in den Bergen - das geht wohl nirgendwo gut. Doch noch während sie wartet, dass ihre Eltern sie abholen, hat Irene schon ganz andere Horizonte im Visier. Mit 17 verlässt sie gleich den ganzen Kontinent - und landet in Afrika. Dort findet sie die Antwort auf ein paar Fragen.
"In Ostafrika bin ich zum ersten Mal Deutschen begegnet", erzählt sie. "Rein physisch haben sie mir schon Angst gemacht. Riesige Männer, die kamen gerade aus Indien. So Pascha-Typen. Ich war höflich und bin mit ihnen an den Strand gegangen. Und dann haben sie über Juden geredet. Wie gierig die seien, dass sie jetzt wieder nach Deutschland kommen, um Entschädigungen einzufordern, und die Deutschen, die ja auch gelitten haben im Krieg, sind wieder die Armen. Das sei die jüdische Gier. Hab natürlich nicht erzählt, wer ich bin." Und nach einer kleinen Stille: "An diesem Strand in Ostafrika habe ich so eine Idee von Deutschland bekommen!"
Sie lacht. Wie überhaupt viel gelacht wird in dieser Wohnung von Irene Dische. Es ist ja auch alles ein großer Witz.
1970 erreicht sie, keine zwanzig Jahre alt, die Forschungsstation des Paläoanthropologen Louis Leakey in Kenia. Leakey hat durch seine Funde maßgeblich dazu beigetragen, die Annahme Darwins zu untermauern, dass die Menschheit aus Afrika stammt. Ein Mondkrater ist nach ihm benannt. Fortan beobachtet sie die Schimpansen des Louis Leakey. Erhebt Daten, schaut den Tieren zu, schreibt mit. Sie wird Leakeys engste Mitarbeiterin, begleitet ihn zwei Jahre lang, bis er schließlich stirbt. "Ich hätte das auch gut weitermachen können", sagt sie jetzt. "Ich glaube, ich wäre eine gute Affenforscherin geworden. Das ging aber nicht. Und dann ist das Naheliegende natürlich, Schriftstellerin zu werden." Affenforscherin oder Schriftstellerin, das sei im Prinzip das Gleiche.
Sie geht zurück nach Amerika, um an der Universität Harvard zu studieren, erst Anthropologie, dann Literatur. Sie beginnt, erste Texte im "New Yorker" zu veröffentlichen. Ende der Siebziger lebt sie in Deutschland, findet in Hans Magnus Enzensberger, den sie kurz Magnus nennt, einen Fan und Förderer. Bald schreibt sie auch für "Kursbuch", das Kompendium der Post-68er-Geisteselite und Enzensbergers neue Zeitschrift "Transatlantik". Ein schneller Aufstieg in die Berliner Boheme beginnt - und auf die Höhen von Journalismus und Literatur.
Und so sitzt sie, längst erfolgreiche Autorin und Reporterin, 1992 in einem Berliner Gerichtssaal. Es ist der zehnte Verhandlungstag. Der Angeklagte: Erich Honecker, ehemaliger Staatschef der DDR. Ein alter, zusammengefallener, krebskranker Mann. Der Prozess, ohnehin umstritten, die Rechtslage schwierig, geht nur Millimeter voran. Schließlich geht es um die Frage: Wie krank ist Honecker wirklich? Ist ein Verfahren in seinem Zustand überhaupt noch menschlich? Alle Zuschauer müssen nun den Saal verlassen. Nur Irene bleibt im Zuschauerraum: Durch einen Trick kann sie sich als Sekretärin von Honecker ausgeben.
Sie schreibt später in ihrer Reportage: "Honeckers Begeisterung für die Arbeiterklasse und den Kommunismus ist immer noch unverbraucht, jugendfrisch. An einem der ersten Morgen seiner neuerlichen Gefangenschaft in Moabit hörte er vertraute Schritte im Hof, und als er aus dem Zellenfenster schaute, sah er seinen Genossen Erich Mielke, der im Hof seine Runden zog. ,Erich! Rotfront!', rief er durch die Stäbe. Weder das Alter noch die Jahre der Herrschaft scheinen Honeckers Ideale angetastet zu haben. An materiellen Dingen war er nie interessiert. Besucher empfängt er im Schlafanzug. Zu seinem achtzigsten Geburtstag wurde ihm ein Geschenk erlaubt, und er erbat sich eine Schachtel ,Mon Chéri'. Wegen der Alkoholfüllung durfte er die Pralinen aber nicht essen, also verlangte er ein Buch. Er ist kein Nörgler, er klagt nicht über Schmerzen oder andere Beschwerden. Als er zum ersten Mal vor Gericht erschien, sagte einer seiner Verteidiger, als er ihm die Hand gab: ,Oh, wie heiß', und Honecker meinte: ,Es geht mir gut.'" Letztlich durfte Honecker allerdings nach Chile ausreisen, wo er kurze Zeit später starb.
Irene Dische schrieb ihre Beobachtungen auf. Der "New Yorker" druckte sie sofort. Heute liest sich der Text wie eine besonders spannende Reportage, ein Einblick in die Geschichte, als sie sich noch jeden Tag veränderte. Damals aber löste er einen Shitstorm aus. Denn Disches ersten Satz ("Ich bin die Frau des Anwalts von Erich Honecker") hatte der "New Yorker" gestrichen: Jetzt empfanden viele die Reportage als distanzlos, als heimliche Verteidigung eines Diktators. In Telefonanrufen, Briefen, sogar Faxen unterstellten ihr aufgebrachte Zeitgenossen, sie sei Kommunistin. "Dreißig Mal am Tag", erzählt sie, hätten Journalisten sie gefragt, ob sie überhaupt noch Amerikanerin sei.
Auch das frisch vereinte Deutschland reagierte verständnislos: Gerade war es sehr en vogue, die DDR zu hassen und Menschen aus dem Osten zu verachten. Kritiker beschuldigten sie, als Maulwurf ihres Mannes, des Honecker-Verteidigers Nicolas Becker, die Medien zu infiltrieren. Eine Loyalität, die von Irene Dische allerdings kaum zu erwarten wäre: "Anwälte sind alle doof", erzählt sie, habe schon ihre Mutter immer gesagt.
Sie pfeift nun mal auf einige Konventionen. Dabei ist das ihre große Stärke: Irene Dische macht quasi von Geburt an, was sie will. Ein Eigensinn, ein Beharren auf einem Standpunkt, der nur ihr allein gehört - und der auch ihr Schreiben unverwechselbar macht. In ihren Romanen und Erzählungen tauchen immer wieder Figuren auf, die sich außerordentlich unangepasst der Welt präsentieren. Die eigene und die Exzentrik anderer ist es, was sie interessiert. Alle ihre Bücher und Reportagen lesen sich witzig und dringlich zugleich, ein wenig spöttisch, aber auch unglaublich lebendig - wenn sie etwa in ihrem Bestseller "Großmama packt aus" die deutsche Gemütlichkeit der nuller Jahre mit Grübeleien über die Spermaqualität ihres Großvaters konfrontiert.
Es ist etwas ungewöhnlich, dass der Verlag, kurz nachdem ihr Roman "Schwarz und Weiß" im Herbst 2017 erschienen ist, gleich einen Erzählband nachlegt. Tut er aber trotzdem, weil Irene Dische ja auch gern tut, was sie will - und weil es höchste Zeit ist, die Dekaden literarisch zusammenzuziehen. Ihre Geschichten heben uns aus der Enge der kleinen Existenz und lassen uns, wie eine epische Serie, die letzten Jahre noch einmal ganz nahe kommen. Dische zeigt hier noch einmal ihren ganzen Witz und scharfsinnigen Blick auf die Welt. Ihre Themenvielfalt ist unterhaltsam, der Ton scharf, die Figuren selbst im dunkelsten Satz noch rührend. Und ja, manchmal ist sie böse.
Und so sind auch die Interviews, die sie gibt, nicht immer berechenbar. Wie recherchiert sie? "Eigentlich fast gar nicht." Haben Sie einen Giftschrank, also so ein Manuskript, dass einem zu peinlich zur Veröffentlichung ist? "Man ist sich selbst ja der langweiligste Verwandte!" Wie ist es für sie gerade in den Vereinigten Staaten? "Ich werde dort als noch exzentrischer wahrgenommen als sowieso schon hier in Deutschland." Unvermittelt fragt sie plötzlich: "Waren Sie eigentlich schon einmal im Krankenhaus?"
Auf solche Fragen darf man nur intuitiv antworten. Ohne genau zu wissen, was das jetzt bedeutet. Denn es ist jederzeit möglich, dass sie den Raum verlässt - was man dann als Zeichen des Abschieds werten müsste. Doch all das macht sie mit dem Charme und der Höflichkeit einer Kosmopolitin.
Einige Zeit später treffen wir uns noch einmal in der Wohnung eines engen Freundes: Geoffrey Layton war Dramaturg bei Luc Bondy und führt in seiner Wohnung mit einer ukrainischen Schauspielgruppe eine Art Theaterstück fürs Wohnzimmer auf. Die jungen Schauspieler sind geschminkt wie in einem Stück von Robert Wilson, sehr weiß mit schwarzen Augenbrauen, sie tanzen in Kleidern und Tutu durch eine typische Berliner Wohnung. Man kann sich an diesem Abend sehr, sehr leicht vorstellen, wie Berlin in den zwanziger Jahren ausgesehen, wie es sich angefühlt hat. Irene Dische schweift etwas durch die Räume und quer durch die Aufführung, als durchstreifte sie ihr eigenes Figurenkabinett oder eine Party des Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld, es ist ein irrer Anblick, dann zieht sie aus dem Bücherregal ein Buch des österreichisch-amerikanischen Psychoanalytikers Otto F. Kernberg.
"Ach", sagt sie, "das habe ich ihm geschenkt." Es heißt "Liebesbeziehungen". Der Untertitel: "Normalität und Pathologie". Und der beschreibt vielleicht auf treffende Art auch die Literatur der Irene Dische.
ANDREA HANNA HÜNNIGER
Irene Disches gesammelte Erzählungen "Zum Lügen ist es nie zu spät" sind soeben im Verlag Hoffmann & Campe erschienen (640 Seiten, 25 Euro).
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Dische zeigt hier noch einmal ihren ganzen Witz und scharfsinnigen Blick auf die Welt.« Andrea Hanna Hünninger FAS, 06.05.2018