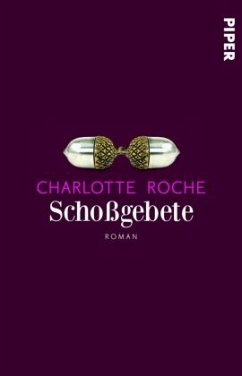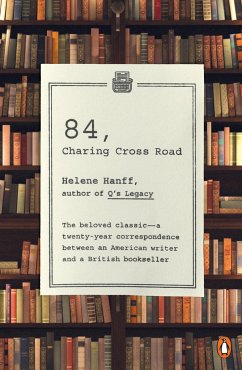Nicht lieferbar
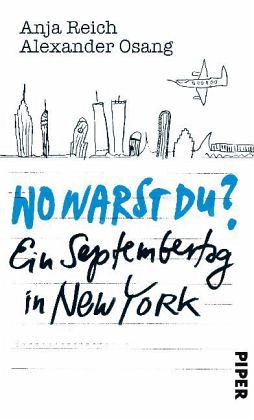
Wo warst du?
Ein Septembertag in New York
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Sie sind Korrespondent in New York und haben gerade eine Jahrhundert-katastrophe überlebt. Ein paar Meilen weiter wartet Ihre Frau mit den Kindern auf ein Lebenszeichen wen rufen Sie an? Richtig: die Redaktion.So ist über den 11. September noch nie berichtet worden: persönlich, berührend und manchmal sogar komisch. Alexander Osang, damals Spiegel-Korrespondent, erzählt von seiner Odyssee durch das geschockte New York, immer auf der Suche nach "seiner" Geschichte. Seine Frau und Kollegin Anja Reich sieht die schwarzen Wolken aus Manhattan auf ihr Haus in Brooklyn zukommen. Sie durchlebt di...
Sie sind Korrespondent in New York und haben gerade eine Jahrhundert-katastrophe überlebt. Ein paar Meilen weiter wartet Ihre Frau mit den Kindern auf ein Lebenszeichen wen rufen Sie an? Richtig: die Redaktion.
So ist über den 11. September noch nie berichtet worden: persönlich, berührend und manchmal sogar komisch. Alexander Osang, damals Spiegel-Korrespondent, erzählt von seiner Odyssee durch das geschockte New York, immer auf der Suche nach "seiner" Geschichte. Seine Frau und Kollegin Anja Reich sieht die schwarzen Wolken aus Manhattan auf ihr Haus in Brooklyn zukommen. Sie durchlebt diesen Tag mit den gemeinsamen Kindern und Nachbarn in der Straße ganz anders, nicht weniger dramatisch und ohne Nachricht von ihrem Mann. Jeder von beiden schreibt nun seine eigene Geschichte über den längsten Tag von New York City. So entstehen zwei Erzählungen, die zusammen einen ungemein dichten, mitreißenden und farbigen Bericht eines Paares ergeben über die Katastrophe und darüber, was diesemit ihnen macht.
So ist über den 11. September noch nie berichtet worden: persönlich, berührend und manchmal sogar komisch. Alexander Osang, damals Spiegel-Korrespondent, erzählt von seiner Odyssee durch das geschockte New York, immer auf der Suche nach "seiner" Geschichte. Seine Frau und Kollegin Anja Reich sieht die schwarzen Wolken aus Manhattan auf ihr Haus in Brooklyn zukommen. Sie durchlebt diesen Tag mit den gemeinsamen Kindern und Nachbarn in der Straße ganz anders, nicht weniger dramatisch und ohne Nachricht von ihrem Mann. Jeder von beiden schreibt nun seine eigene Geschichte über den längsten Tag von New York City. So entstehen zwei Erzählungen, die zusammen einen ungemein dichten, mitreißenden und farbigen Bericht eines Paares ergeben über die Katastrophe und darüber, was diesemit ihnen macht.