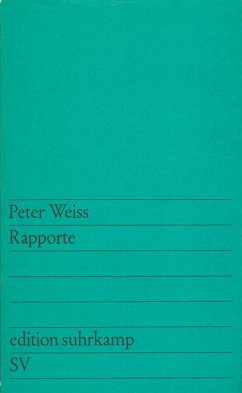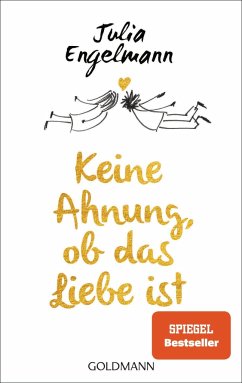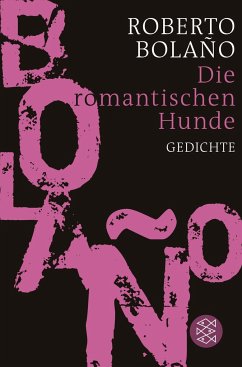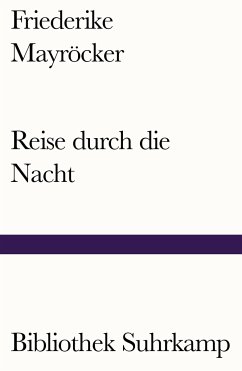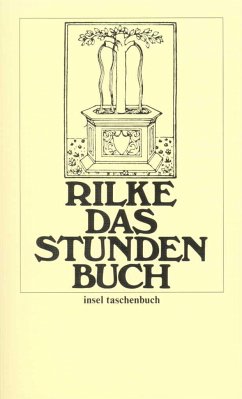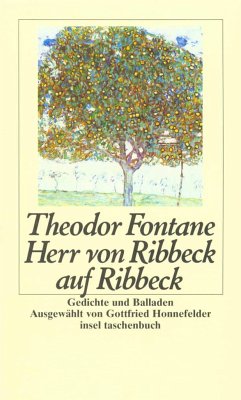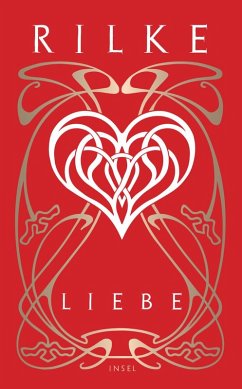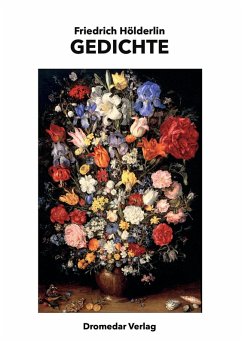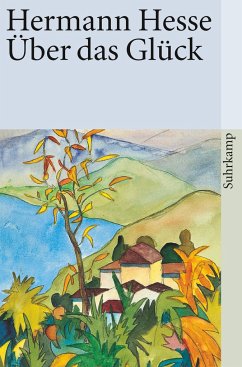überlassen das Feld anderen. Diedrich Diederichsen etwa, so ist zu hören, schreibe eines. Und weil man dann eh alles noch einmal liest und anschaut, hat er unter dem Titel "Martin Kippenberger. Wie es wirklich war" schon mal einen Band mit "Lyrik und Prosa" herausgegeben, nur Texte, die sich, so Diederichsen, auch ohne den Kontext behaupten könnten, in dem sie entstanden.
Seit Martin Kippenberger (1953 bis 1997) nicht mehr dauerhaft nervt und nur seine Werke übrig geblieben sind, findet sich kaum noch einer, der ihn nicht gut findet. Es ist schon seltsam, wie der penetrante Kippenberger-Furor aus der Zeit gerissen und so getan wird, als wären die "Hetzler Boys" samt M. K. mit seiner Dauerpubertät alles gewesen, nur keine frech-anarchische Opposition gegen die Großmalerfürstenkunst der achtziger Jahre. So ist das eben mit dem historischen Abstand und den toten Künstlern. Aber soll und kann man deswegen heute noch all die mehr oder weniger zutreffenden Charakterisierungen nachbeten, die Martin Kippenberger zuteil wurden? Kann man, wie es Susanne Kippenberger, die jüngste seiner vier Schwestern und Redakteurin beim Berliner "Tagesspiegel" (O-Ton M. K.: "meine Schwester, die Sonntagsbeilage"), in ihrem Buch auf mehr als fünfhundert Seiten versucht, ein Porträt statt einer Biographie des Menschen und des Künstlers schreiben, das auf die gemeinsam erlebte Kindheit und Jugend gründet, sich ansonsten aber auf die Aussagen von allzu vielen verlässt, die dabei gewesen sind? Was bekommt man zu fassen, wenn man all die Sprüche - "Wer Bonanza selber dreht, der die Welt umso besser versteht" -, die M. K. so gern klopfte, mit suchend ausgeworfenen Charakterisierungen wie Anarchist, Gentleman, Männerbündler und Frauenfeind, Einzelgänger und Alleinunterhalter, Selfmademan und Menschengärtner verbindet? Heißt das nicht: Jedem seinen Kippenberger?
"Er war", beginnt Susanne Kippenberger ihr Buch, "mein großer Bruder. Mein Beschützer, mein Verbündeter, mein Held." Fast überflüssig zu erwähnen, dass die Kapitel über Kindheit und Jugend die intensivsten sind. Der "Pappa", samt der ganzen Familie, "ein Exot in einer konservativen, nüchternen Welt", "Mutti" eigentlich Ärztin, doch bis zur Scheidung "hauptberuflich Ehefrau und Mutter", das "Haus Kippenberger" in Essen-Frillendorf samt Kinderhaus, Au-pair-Mädchen, Haustöchtern, Künstlern und allerlei Freunden ein chaotisches Paradies, in dem alles, was geschah, festgehalten wurde "auf Bildern, Filmen, Fotos und in Worten". Und mittendrin der Stammhalter: Martin, von Kindesbeinen an Schauspieler und Entertainer. 1962, Martin Kippenberger ist neuneinhalb, kommt er aufs Internat, ins "staatlich genehmigte Schulheim" Tetenshof in Hinterzarten/Titisee, von wo aus er Briefe schreibt und den Umschlägen "zeichnenderweise seinen persönlichen Stempel" aufdrückt. "So", heißt es dann, "beginnt die Kippenbergerisierung der Welt" - und wieder einmal triumphiert der Mythos vom Künstler im Nachhinein über eine Jugend.
Danach, als er obsessiv Städte, Wohnungen und Kneipen wechselt und sein Programm "Durch die Pubertät zum Erfolg" durchzieht, lässt die Autorin so viele Stimmen sprechen, dass sich die Konturen des Martin Kippenberger zunehmend verlieren. Fast scheint es, sie habe es partout vermeiden wollen, die eigene Stimme zu erheben. Und so entsteht weniger ein Porträt des Künstlers als sensibler Macho als ein Panorama der achtziger Jahre, mit all ihrem Überschwang, mit Köln als Zentrum und den "Hetzler Boys", in deren Mitte Martin sitzt wie die Spinne im Netz. Nicht von ungefähr war Spiderman eines seiner Vorbilder. Was hier ausgebreitet wird, ist nicht das Leben des Künstlers als "Menschengärtner", als den er selbst sich gern sah, kein einfacher Blick auf "Leben und Werk", sondern eine Annäherung an ein alles verschlingendes Schöpfertum, an einen Dionys, der so nah wie möglich heranwollte an die Welt und an die Menschen, weil er Kontakt suchte und sich selbst lebendig fühlen wollte, ja musste. M. K. war nicht zu bremsen. Da brannte einer und verzehrte sich, rücksichtslos. Das macht seine Faszination aus, nach seinem Tod und im Abstand zu der Anstrengung, die er war, vielleicht noch mehr als zu seinen Lebzeiten. Der Proteus M. K. aber ist ohne direkten Bezug zu seinem Werk nicht zu fassen. Doch indem man das Auf und Ab, die Zweifel und Sehnsüchte des kleinen-großen Martin verfolgt, versteht man plötzlich mehr von der überschwenglich-lauten, oft auch melancholischen Dynamik jener Jahre, in denen der Kunstmarkt begonnen hat, über die Kunst zu triumphieren.
Was fehlt, sind Zwischentöne, auch der eigene, liebevolle, manchmal kritische Blick, der "Sankt Martin" zwischen Rabauken und Peinlichkeitsvirtuosen, zwischen sensiblem Familienmensch und Kotzbrocken, Weltverbesserer und Schandmaul aufspürt. Manchmal hat man sogar das Gefühl, Susanne Kippenberger habe ihren großen Bruder - den Helden und Beschützer, nicht den Künstler M. K. - so sehr verehrt und geliebt, dass sie diese schwierige Nähe mit all den Aussagen seiner Künstlerfreunde, Weggefährten, Galeristen, Frauen und Kritiker wie mit einem Berg von Worten zudeckt, um den eigenen Schmerz lindern und ihr Auge überhaupt auf Martin richten zu können.
Vielleicht übertreibt sie es deshalb, packt noch mal alles hinein und rutscht so doch ins Hagiographische, obgleich dem Buch eine solche Tonlage eigentlich fremd ist. So, wie sie sich umgekehrt dem Familiären zwar überlässt, aber keine Funken daraus schlägt. "Gibt's mich wirklich?" heißt einer von Martins Bildtiteln. "Erst drehen, dann wenden" ein anderer. Und plötzlich stößt man bei der Suche nach Martin auf den Vater. Wer ihn erlebte, war schockiert: "Diese Hemmungslosigkeit im öffentlichen Auftritt, egal ob beim Tanzen, Reden oder Singen, dieses I.N.P.-Gefühl - ist nicht peinlich -, dieses Zwangsbeglückertum, auch die Sentimentalität, die exzessive künstlerische Produktivität, die Arbeit am allumfassenden Gesamtkunstwerk, dieses Alles-gestalten-Wollen." "Die Extremversion von Martin" nennt ihn Albert Oehlen. Und Carmen und Imi Knoebel sagen, als sie Vater Kippenberger erleben: "Wir dachten, Martin wäre das Original." "Eine Familie eine Linie", schrieb der Sohn auf den Grabstein des Vaters.
THOMAS WAGNER
Susanne Kippenberger: "Kippenberger". Der Künstler und seine Familien. Berlin Verlag, Berlin 2007. 576 S., Abb., geb., 22,- [Euro].
Martin Kippenberger: "Wie es wirklich war". Am Beispiel Lyrik und Prosa. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Diedrich Diederichsen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 360 S., br., 12,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
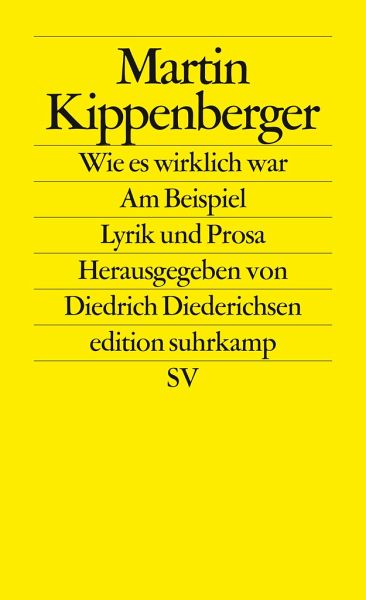




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2007