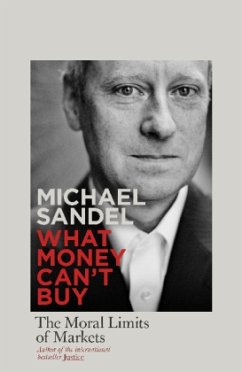Die zentrale Frage dieses Buches ist: Wo sind die moralischen Grenzen des Marktes? Ist es in Ordnung, Kinder dafür zu bezahlen, dass sie gute Noten nach Hause bringen? Sollte man ein Menschenleben in Währung umrechnen, um die Zulässigkeit von Umweltverschmutzung zu kalkulieren? Ist es ethisch vertretbar, mit Geld zu locken, um riskante Medikamente zu testen oder Organspenden zu forcieren? Sollte man mit Söldnern in den Krieg ziehen?

frei sein
Es ist beeindruckend, was man für Geld alles kaufen kann: parlamentarische Mitsprache, Staatsbürgerschaften und sogar Kinder – mit solchen und ähnlichen Beispielen lenkt Harvard-Professor Michael Sandel den Blick seiner Leser auf den Siegeszug des Preisschildes in unserer Gesellschaft. Und dem sagt er in seinem jüngsten Buch „Was man für Geld nicht kaufen kann. Die moralischen Grenzen des Marktes“ den Kampf an.
Bekannt wurde der charismatische Philosophie-Professor mit seiner Vorlesung „Justice“, die er Jahr für Jahr an der US-Eliteuniversität Harvard hält. Seitdem die Video-Aufzeichnung der Vorlesung im Internet weltweit millionenfach geklickt wurde, ist Sandel so etwas wie der Pop-Star der Philosophie.
Nun versucht er seinen Lesern nahezubringen, was der Unterschied zwischen einem Wert und einem Preis ist. Viele Ökonomen würden nicht beachten, dass manchmal schon allein die Tatsache, dass es einen Preis gibt, den zugrunde liegenden Wert zerstört. „Der Markt hinterlässt eine Spur“, schreibt Sandel. Man denke etwa an einen Liebesbrief oder eine Hochzeitsrede, deren Textvorlage in Redaktionsbüros gekauft werden kann. Wenn herauskommt, dass der Redner oder der Autor etwas für den Text bezahlt hat, dann ist die Enttäuschung groß.
Auch wenn die Ökonomen gern suggerieren, dass hinter allem ein „Anreiz“ stecke, den man nur verändern müsse, wenn man das Verhalten der Menschen ändern wolle. Man könne nicht jede Entscheidung wertneutral treffen – es sind moralische Entscheidungen. Als Beispiel dient ihm eine Schweizer Gemeinde, die kein Geld von der Politik nehmen wollte, damit bei ihnen im Ort ein Atommüll-Endlager gebaut wird. Sie stimmten erst zu, als sie dafür kein Geld geboten bekamen. Die Bürger wollten sich die Entscheidung nicht abkaufen lassen, sondern sie wollten frei entscheiden dürfen.
Fast unbemerkt habe sich der Markt in alle Bereiche unserer Gesellschaft eingeschlichen und unsere Werte aufgeweicht, warnt der Philosoph. „Wir haben nicht länger eine Marktwirtschaft, wir sind eine Marktgesellschaft geworden“, prangert er an. Ihn verwundert, dass selbst die Finanzkrise die Marktgläubigkeit in großen Teilen der Bevölkerung nicht erschüttert hat. „Wir müssen die Rolle der Märkte neu definieren“, fordert er. Damit will er Platz schaffen für die wirklich wichtigen moralischen Fragen.
ANDREA REXER
Michael J. Sandel: Was man für Geld nicht kaufen kann. Die moralischen Grenzen des Marktes.
Ullstein. 304 Seiten. 19,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Michael Sandel will die Moral vor den Moralisten retten
Man braucht zurzeit nicht viel Mut, um sich über die Macht der Märkte zu beschweren, die Gier der Banker oder die Schwäche der Politik - und einen Doktor in Philosophie braucht man schon gar nicht. Und wenn dann einer kommt, der auf die Ideen großer Denker zurückgreift, um vor den Gefahren eines ausufernden Kapitalismus zu warnen, dann sollte man schon mehr erwarten dürfen als die handelsübliche Predigt gegen die Dominanz ökonomischer Prinzipien und den Verfall der Werte. Wer aber die Bücher des amerikanischen Philosophieprofessors Michael Sandel liest, dem kann es leicht passieren, dass er sie nach ein paar Seiten wieder zuschlägt, allein schon, um sich zu vergewissern, ob er nicht aus Versehen einen Erbauungstext von Paolo Coelho vor sich hat.
Vor allem Sandels Buch "Was man für Geld nicht kaufen kann" verdankt seinen Erfolg der akademischen Ratifizierung virulenter Klagen: Dass sich die Marktwirtschaft zu einer Marktgesellschaft entwickelt, in der man längst mehr als Waren kaufen kann, Zeit, Privilegien, Gesundheit, Bildung. Dass Kommerzialisierung die Gemeinschaft zersetzt. Dass es der Politik "an moralischer und spiritueller Substanz" fehlt. Aha, denkt man, das bringt man also heute den jungen Studenten in Harvard bei: wie schlecht die Welt ist und dass es besser wäre, wenn sie besser wäre.
Dass solche Kirchentagstöne erfolgreich sind, im Buchhandel, bei den Erstsemester-Studenten, die es in Sandels überfüllten Vorlesungen schaffen, bei dreißig Millionen Youtube-Schülern in China oder, im vergangenen Jahr, bei 14 000 Zuhörern in einem Fußballstadion in Südkorea, das mag in erster Linie ihrer seelsorgerischen Wirkung zu verdanken sein. Als "Rockstar der Moral" wird Sandel manchmal bezeichnet: Philosophie zum Mitgrölen. Und trotzdem verbirgt sich hinter all der Harmlosigkeit seiner Anti-Kapitalismus-Slogans ein politischer Appell, der schärfer und kämpferischer gemeint ist, als es die besinnlichen Begriffe (Werte, Tugenden, Moral) vermitteln können, ohne die seine Disziplin nun einmal nicht auskommt. Moral, könnte man sagen, ist Sandel zu wichtig, um sie den Moralisten zu überlassen.
Vergangene Woche war Sandel in Berlin, um ein paar Interviews zu geben, und dass einem die Unaufgeregtheit, die in seinen Büchern immer eher als Unverbindlichkeit erscheint, im persönlichen Gespräch natürlich sehr angenehm ist, das trägt womöglich auch dazu bei, den inhaltlichen Kern seiner Thesen genauer zu erkennen. Die laufen nämlich dann doch auf eine Kritik am Neoliberalismus hinaus, die radikaler ist als der wütende Protest einiger Occupy-Aktivisten. Nämlich gerade nicht auf friedliches Händchenhalten; sondern auf eine Wiederbelebung sozialer Fähigkeiten wie Streit und Konflikt.
Vor Sandels Plädoyer für mehr Moraldebatten steht dabei, wie man in seinem Buch "Gerechtigkeit" nachlesen kann, eine Analyse, wie sich die Moral überhaupt aus dem politischen Diskurs verabschiedet hat. Für Sandel liegt das vor allem an dem Erfolg des Liberalismusmodells von John Rawls. Dessen Konzept vom "Schleier des Nichtwissens" verbannte den Streit um moralische Fragen aus der Politik, um eine pluralistische Gesellschaft vor zermürbenden Konflikten zu bewahren. Vor allem linke Liberale gaben auf, um ihre Überzeugungen zu streiten, weil sie Neutralität mit Toleranz verwechselten. "Sie waren geradezu allergisch gegen den Begriff der Werte", sagt Sandel. "Das hat zu einem moralischen Vakuum geführt, das leicht mit intoleranten moralistischen Stimmen gefüllt werden kann."
Moralische Überzeugungen, darauf deutet auch der Erfolg von Sandel hin, sind eine Kraft, die nicht einfach verschwindet, wenn man sie ignoriert. Das Scheitern der gegenseitigen Abrüstung hat allenfalls zur Stärkung konservativer Spielarten geführt. "Die Öffentlichkeit ist anfällig geworden für Fundamentalisten verschiedener Arten, die ihren Moralismus mit aller Gewalt geltend machen wollen; und weil es ein moralisches Vakuum gibt, haben sie eine enorme Resonanz, die sie nicht hätten, wenn es eine breite pluralistische Auseinandersetzung über Gerechtigkeit, Ethik oder das Gemeinwohl gäbe", sagt Sandel. Gegen Moral, könnte man sagen, hilft nur Moral.
Radikal ist Sandels Kritik aber auch, weil er sich mit den Freiheitsidealen des politischen Liberalismus anlegt, auf die sich eben auch der Neoliberalismus beruft, wenn er mit utilitaristischen Argumenten nicht mehr weiterkommt. Was nach moralischer Neutralität klingt, verschweigt aber, dass auch Freiheit und Toleranz Werte sind, die gegen andere verhandelt werden müssen. In Europa, wo immerhin noch Reste des Sozialen in der Marktwirtschaft überlebt haben, muss man das vielleicht nicht so stark betonen wie in den Vereinigten Staaten, wo es selbst die Finanzkrise nicht geschafft hat, eine grundlegende Debatte über ökonomische Regulierung auszulösen. Aber auch hier könnte es nicht schaden, wenn inmitten all der Haushaltsdebatten auch einmal eine politische Vision erkennbar wäre.
Moral, das ist die Pointe von Sandels Thesen, ist nicht das stumpfe Schwert der Zukurzgekommenen, sondern eine Kraft, die die Politik nicht verschenken sollte. "Die Menschen wollen, dass es im öffentlichen Leben um größere Dinge geht, um Werte und Überzeugungen. Wer so tut, als könnte man neutral sein, erzeugt Ressentiments, weil die Leute merken, dass ihre Ansichten unter den Teppich gekehrt werden", sagt Sandel. Dass er die "moralische Sehnsucht" der Menschen verstanden hatte, glaubt Sandel, darauf gründet auch der Erfolg von Barack Obama. Sie gegen die mächtige Realität der Märkte in Stellung zu bringen hat deshalb am Ende nicht zwangsläufig etwas mit Naivität zu tun, sondern womöglich auch mit politischem Instinkt.
HARALD STAUN
Michael Sandel: "Gerechtigkeit", Ullstein, 416 Seiten, 21,99 Euro. "Was man für Geld nicht kaufen kann", Ullstein, 304 Seiten, 19,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main