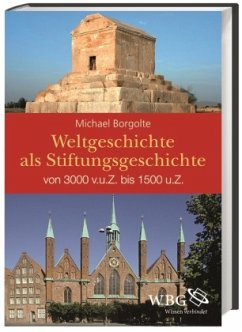Was bewegt Menschen dazu, auf einen Teil ihres Besitzes zu verzichten? Warum geben Sie Geld und Gut weg? Zu allen Zeiten und in allen Kulturen stifteten Menschen Vermögen - für das Allgemeinwohl, aber auch für ihr Andenken und Seelenheil. Sie unterstützen Arme und Kranke, fördern religiöse Kulte oder Kunst und Wissenschaft. Stiftungen sind ein grundlegendes soziales Phänomen, an dem sich das Gefüge der ganzen jeweiligen Gesellschaft ablesen lässt.Der Universalhistoriker Michael Borgolte, der sich seit Jahrzehnten mit weltweiten gesellschaftlichen Vergleichen beschäftigt, legt die erste Weltgeschichte der Stiftungen vor, von 3000 v.Chr. bis 1500 n.Chr. und vom Alten Ägypten über Persien, die Induskulturen und China bis zum Judentum, dem Islam und nicht zuletzt, breit ausgeführt, zum christlichen Mittelalter. Das monumentale Werk "Weltgeschichte der Stiftungen" ist die Frucht der Forschungen von rund 30 Jahren und das Ergebnis des Austauschs mit Expert/innen vieler Fächer und Länder

Kapitalanlage mit Kulturertrag: Michael Borgolte folgt der Praxis der Stiftungen über 4500 Jahre
Die Globalisierung ist in der Kulturgeschichte angekommen. Michael Borgolte dokumentiert das mit einem Buch, in dem er die Geschichte der Menschheit als Geschichte von Stiftungen liest. Dafür ist der Autor, gegenwärtig Gründungsdirektor des Instituts für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität, prädestiniert. Er hat über lange Jahre an der Humboldt-Universität einen Schwerpunkt für Stiftungsforschung aufgebaut und eine bahnbrechende Geschichte des Mittelalters in der Verschränkung von jüdischen, muslimischen und christlichen Perspektiven vorgelegt ("Christen, Juden, Muselmanen", 2006).
In seinem neuesten Buch weist er nach, dass alle großen Kulturen gestiftet haben: Ägyptische Pharaonen trugen Vorsorge, dass ihr Grab nach ihrem Tod rituell betreut wurde, woraus die Domänenwirtschaft entstanden sei. Im chinesischen Buddhismus erhielten Klöster immense Zuwendungen, in der Hoffnung, dass den Stiftern damit eine bessere Wiedergeburt beschieden sein möge. Im Christentum gab es Stiftungen um der Memoria und der Fürbitte willen, weil man gehofft habe, damit das jenseitige Heil zu sichern. Im Islam hingegen habe das Ideal der "Gottesnähe" das Stiftungsverhalten bestimmt und möglicherweise zu einer Stiftungslandschaft von Madresen, den Einrichtungen für höhere Bildung, geführt; das Studium des Koran sollte die Gottesnähe befördern.
In einer überreichen Fülle von Beobachtungen behält Borgolte den Überblick, indem er eine klare Definition als roten Faden durch die Jahrtausende legt: Eine Stiftung ist für ihn auf Dauer angelegt und liefert auf der Grundlage eines Kapitals fortwährend Erträge, wohingegen eine Schenkung aus einer einmaligen Gabe besteht. Borgolte präsentiert das Ergebnis einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Stiftungsthema. Mit der Vielfalt von Entwicklungen, die er dokumentiert, wehrt er, vielleicht ist dies das wichtigste Ergebnis, jeder simplizistischen Weltgeschichtsschreibung, die entweder in der Romantik von Gemeinsamkeiten schwelgt oder die Geschichte der Menschheit in zusammenhanglose Differenzen auseinanderfallen lässt.
Aber zugleich wünschte man sich eine stärker systematische Analyse des Materials. Ist wirklich jedes auf Dauer angelegte Kapital eine Stiftung? Das Problem tritt etwa bei Genossenschaften auf, die im lateinischen Okzident oft den Grundstein für Stiftungen bildeten. Borgolte sieht selbst, dass die Gleichung Genossenschaft = Stiftung nicht aufgeht. Damit aber verschwimmt die Grenze zwischen einem gemeinsam verwalteten Eigentum und einer Stiftung. Letztlich ist der Frage nicht auszuweichen, ob Borgoltes Stiftungsbegriff zu weit ist.
Eine andere Problemzone ist die Systematik des Vergleichs. In welchem Ausmaß sind vorgenommene Vergleiche etwa europäisch geprägt? Dieses Problem lässt sich gleichfalls am Konzept der Genossenschaft erläutern. Borgolte geht davon aus, dass es Genossenschaften in Indien gab. Aber trifft man dann auch in Indien auf die sehr spezifischen Formen genossenschaftlicher Selbstverwaltung wie in Europa? Kann man überhaupt mit europäischen Konzepten Stiftungen in Indien verstehen?
Schließlich bleiben interessante offene Fragen: Gehört die Stiftungsgeschichte konstitutiv in die Geschichte der Entstehung von Staaten? Dazu legt Borgolte immer wieder Spuren für weiteres Nachdenken aus. Stiftungen könnten dazu gedient haben, in frühen Gesellschaften Stabilität über Generationen herzustellen oder Gemeinsamkeiten über Clangrenzen hinweg zu eröffnen. Man kann sich fragen, ob Staatswerdung und Stiftungspraxis nicht zumindest zweieiige historische Zwillinge sind.
Eine andere Frage wirft der Zusammenhang von Spitälern und Stiftungen auf, dem Borgolte in Buddhismus, Christentum und Islam nachgeht. Warum aber waren in ihnen Krankenhäuser unterschiedlich verbreitet? Stiftungen waren offensichtlich eine mögliche, aber keine ausreichende Bedingung für eine weite Verbreitung von Spitälern. Hinsichtlich derartiger Fragen bleiben die behandelten Kulturen in ihrer faszinierenden Pluralität oft nebeneinander stehen, auch in der abschließenden "Synthese".
Borgolte stellt die Stiftungstraditionen in kulturelle Kontexte, schreibt Miniaturen etwa zur Entstehung des Buddhismus oder zur Geschichte des frühen Kalifats im Islam. Dieses Umfeldwissen braucht man, keine Frage. Anzumerken bleibt aber doch, dass wenn Borgolte sein ureigenes Feld, das Mittelalter, verlässt, die Informationen oft nicht mehr auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung sind.
Doch es braucht Bücher wie dieses, die das Material für die großen Fragen der aktuellen Geschichtswissenschaft aufblättern: Was verbindet die vielen Kulturen, die heute wie nie zuvor zu einer globalen Menschheit zusammenwachsen? Aber mehr noch: Warum entwickeln sich Kulturen unterschiedlich, und zwar langfristig und trotz enger Beziehungen? In der globalen Geschichtsforschung ist dies unter dem Stichwort "great divergence" (die große Gabelung), etwa zwischen China und dem Westen, ein großes und politisch aufgeladenes Thema. Und so wüsste man gerne, wie unterschiedliche Stiftungstraditionen die Gegenwart prägen und warum sich diese Pfadabhängigkeiten bis heute halten. Aber es ginge zu weit, von Borgolte die Antwort auf diese Frage zu erwarten. Sein Buch endet im Jahr 1500 - vor der großen Gabelung.
HELMUT ZANDER
Michael Borgolte: "Weltgeschichte als Stiftungsgeschichte". Von 3000 v. u. Z. bis 1500 u. Z.
WBG/Theiss Verlag, Darmstadt 2018. 728 S., Abb, geb., 79,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Es braucht Bücher wie dieses, die das Material für die großen Fragen der aktuellen Geschichtswissenschaft aufblättern.« Frankfurter Allgemeine Zeitung »Sponsoring hat Tradition, wie der Berliner Historiker in seinem fesselnden Wälzer vorführt.« Nordseezeitung »Das monumentale Werk 'Weltgeschichte der Stiftungen' ist die Frucht der Forschungen von rund 30 Jahren und das Ergebnis des Austauschs mit Expert/innen vieler Fächer und Länder« Maecenata