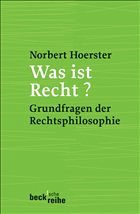Eine philosophische Einführung in das Wesen des Rechts
Worin besteht das Fundament einer Rechtsordnung, die in einer Gesellschaft Geltung und Wirksamkeit besitzt? Wodurch unterscheiden sich Rechtsnormen von anderen sozialen Normen? Kann das Recht einer Gesellschaft jeden beliebigen Inhalt haben, oder gibt es Kriterien für das moralisch richtige Recht? Kann die Anwendung des Rechts im Einzelfall tatsächlich objektiv erfolgen? Welcher Methoden hat sich eine rational vorgehende Rechtsanwendung zu bedienen?
Norbert Hoerster gibt in seinem prägnanten und sachorientierten Buch auf diese und ähnliche Fragen für jedermann verständliche und nachvollziehbare Antworten. Der Leser verliert sich nicht in unwichtigen Details, sondern erfährt, was das Wesen des Rechts ausmacht.
Worin besteht das Fundament einer Rechtsordnung, die in einer Gesellschaft Geltung und Wirksamkeit besitzt? Wodurch unterscheiden sich Rechtsnormen von anderen sozialen Normen? Kann das Recht einer Gesellschaft jeden beliebigen Inhalt haben, oder gibt es Kriterien für das moralisch richtige Recht? Kann die Anwendung des Rechts im Einzelfall tatsächlich objektiv erfolgen? Welcher Methoden hat sich eine rational vorgehende Rechtsanwendung zu bedienen?
Norbert Hoerster gibt in seinem prägnanten und sachorientierten Buch auf diese und ähnliche Fragen für jedermann verständliche und nachvollziehbare Antworten. Der Leser verliert sich nicht in unwichtigen Details, sondern erfährt, was das Wesen des Rechts ausmacht.

Norbert Hoersters Verteidigung des Rechtspositivismus
Eingangs schreibt Norbert Hoerster: "Als Leser des Buches wünsche ich mir Menschen, die primär unter philosophischem - und nicht unter politischem - Aspekt am Phänomen des Rechts interessiert sind. Unter deutschen Rechtsprofessoren sind solche Menschen, wie ich während meiner langjährigen Tätigkeit an einem juristischen Fachbereich erfahren mußte, kaum zu finden." Ausweislich einer biographischen Notiz hat Hoerster von 1974 bis 1998 in Mainz Rechtsphilosophie gelehrt. Deshalb wird man aus seinem Satz schließen dürfen, daß sich die Mainzer Kollegen mit seiner Philosophie nicht anfreunden konnten und dafür politische Gründe gehabt haben müssen, weil Hoerster natürlich der Philosoph ist. Wenn man dieses Buch gelesen hat, versteht man die Mainzer Kollegen besser.
Der Rezensent teilt im wesentlichen Hoersters politische Intentionen, aber nicht seine philosophischen Ansätze. Hoersters Konzept hängt an der Wahrheit eines Satzes: "Auch innere Einstellungen sind prinzipiell vermittelt durch entsprechende äußere Bekundungen - empirischer Wahrnehmungen zugänglich." Der Rezensent hält innere Einstellungen für nicht feststellbar. Man kann keinem ins Herz schauen, und der eigene Standpunkt ist ein blinder Fleck. Deshalb muß man sich seine Welt selbst konstruieren, dabei Widersprüche vermeiden und Paradoxien auflösen. Hoerster dagegen kann sich auf Evidenzen berufen und macht davon ausgiebig Gebrauch. "Offensichtlich" ist eines seiner Lieblingswörter. Zu entscheiden ist die Meinungsverschiedenheit nur durch eine Bewertung der Darstellungen von Welt, die die beiden Erkenntnistheorien liefern. Aber das muß hier auf sich beruhen.
Zunächst will Hoerster zeigen, daß Rechtsnormen im Staat ihren Ursprung haben und zwangsweise durchgesetzt werden. Die Anwendung von Zwang ist nur bei Geboten oder Verboten möglich, nicht zum Beispiel bei Regeln, die zum Abschluß von Kaufverträgen oder zum Erlaß von Gesetzen ermächtigen. Nach Ansicht Hoersters ist jedoch die Vertragsfreiheit stets mit Einschränkungen und daher im Ergebnis mit Zwangsakten verknüpft. Den Ermächtigungen zur Gesetzgebung fehlt allerdings der Zwangscharakter. Deshalb sind sie keine Normen, sondern Regelungen. Normen gibt es nur als Pflicht, nicht als Anspruch. Legitimation kommt nicht vor.
Zusammengehalten und geordnet wird die Rechtsordnung durch eine Verfassung. Die Verfassung wird getragen durch Akzeptanz der Amtsträger, die sie einsetzt, beispielsweise der Abgeordneten. Wenn die Amtsträger nicht mehr mitmachen, ist Schluß: "Die Akzeptanz der Verfassung durch die Zwangsakte setzenden Amtsträger ist die letzte normative Basis von Staat und Rechtsordnung." Und die Akzeptanz - was immer sie psychophysisch bedeutet - kann Hoerster eben feststellen. Geschichte und Völkerrecht kommen nicht vor, obwohl sich das Grundgesetz mehrfach darauf bezieht. Wer eine Verfassung initiiert, formuliert und durchsetzt, bleibt offen.
Letztlich entscheidet die Macht oder so etwas wie politische Realität, die Hoerster genau wahrnimmt. Der philosophisch ungebildete Leser oder ein Rechtsprofessor sehen Macht eher als eine Quelle von Willkür und fragen sich, ob sie eine zureichende Antwort auf "Grundfragen der Rechtsphilosophie" ist. Diese Frage ist zu bejahen, wenn man mit dem Positivismus annimmt, daß es außerhalb der staatlichen Rechtsordnung kein Recht gibt. Dann ist Macht eine Metapher für alle nichtrechtlichen Einflüsse auf das Recht.
Hoerster verteidigt den Rechtspositivismus und einen moralneutralen Rechtsbegriff vehement gegen die bekannte Kritik des Strafrechtlers Gustav Radbruch, nach der ein positives Gesetz der Gerechtigkeit zu weichen hat, wenn seine Ungerechtigkeit unerträglich ist. Diese Radbruchsche Formel zeichnet sich mehr durch die Untadeligkeit ihres Schöpfers als durch ihre philosophische Erklärungsstärke aus. Auf das Paradox des "gesetzlichen Unrechts" hat Hoerster seit langem hingewiesen, ohne zu sehen, daß man Paradoxe durch Unterscheidungen auflösen muß. Das Paradox der Auslegung - wie kann man einen Text befragen, von dem man nicht weiß, was er meint? - will er mit der Unterscheidung zwischen rechtstheoretischer und innerrechtlicher Betrachtung entspannen.
Angesichts der Bedeutung, die Hoerster Verfassungen zuweist, mutet seine Weigerung merkwürdig an, sich auf die Frage einzulassen, seit wann es Verfassungen in seinem Sinne gibt, woher sie kommen und wer sie formuliert. Verfassungen fallen nicht vom Himmel, und immerhin spricht die Präambel des Grundgesetzes von der verfassunggebenden Gewalt des Deutschen Volkes. Nach Hoerster müßte das eine dreiste Lüge sein. Einfach "Macht" zu sagen klärt die historischen Vorgänge nicht.
In der Sache beantwortet Hoerster die Frage nach der Herkunft der höchsten Rechtsnormen aber doch. Unter dem für einen bekennenden Rechtspositivisten überraschenden Titel "Ethische Anforderung an das Recht" beschreibt er schön didaktisch, was die Menschen zusammentreibt: die Not. Zum Beispiel wollten sie sich auf einer sturmbedrohten Insel mit einem Deich schützen. Das gehe nur durch gemeinsames Handeln. Für eine Rechtsordnung gelte Entsprechendes. Hobbes und Marx lassen grüßen, der eine mit dem Krieg aller gegen alle, der andere mit der Verelendung der Arbeiterklasse. Aber Geschichte ist eben nicht Hoersters Fach.
GERD ROELLECKE
Norbert Hoerster: "Was ist Recht?". Grundfragen der Rechtsphilosophie. Verlag C. H. Beck, München 2006. 160 S., br., 10,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Nüchtern? Naiv? Aufrichtig fragt Norbert Hoerster, was Recht sei
Was ist Recht? Eine alte Frage. Rechtshistoriker etwa fragen sich seit jeher, ab wann von „Recht” gesprochen werden kann. Schon zu Zeiten des Neandertalers vielleicht oder doch erst bei den Herrschaften des entwickelten Zweistromlandes oder gar erst, jedenfalls so richtig, bei den Römern? Ist die historische Schwelle zum Recht erst einmal verlegt, hört dieses Fragen auf. Die Rechtsethnologen fragen ähnlich nach der Schwelle vom Nichtrecht zum Recht und haben im Gegensatz zu den Historikern lebende Quellen zur Verfügung, zu denen man reisen kann, auch wenn es immer weniger wilde und in Ruhe gelassene und somit echte Eingeborene mit ihrem Recht oder ihrer Sitte als Nichtrecht gibt.
Die Rechtssoziologen haben mit ihren empirischen Interessen die aktuelle Bevölkerung vor Augen und produzieren sogenannte Tatsachenforschungen über gegenwärtige Vorstellungen von Recht. Rechtstheoretiker befassen sich eher mit den Rechtsvorstellungen der lebenden professionellen Rechtsarbeiter, der Juristen also. Hier wird die Frage, was Recht ist, weniger erörtert, da es darum geht, die zweifelsohne Recht betreffenden Argumentationen der Entscheider und Lehrer des Rechts zu reflektieren. Diese selbst, die Richter und Dogmatik-Professoren, stellen sich die Frage gar nicht, sowenig wie ein Maurer sich fragt, was eine Mauer ist. Er baut sie einfach.
Bleiben die Rechtsphilosophen. Die fragen immer. Das ist sokratische Tradition. Philosophen fragen grundsätzlich und universal. Die Was-Frage ist ihre ureigenste Domäne. Allerdings stehen ihnen, soweit sie nicht Philosophiehistorie betreiben, nicht Quellen wie den anderen Rechtsgrundlagenbedenkern zur Verfügung. Ihre einzige Quelle ist der Kopf, in dessen Reich sich die Ideen tummeln. Das ist nicht wirklich ein Nachteil, ist doch das Reich der Tatsachen selbst längst in den Ruch des Konstruierten geraten. So sehr die Rechtshistoriker und –soziologen auch den echten Quellen anhängen möchten, philosophisch ist das, was ist, schon längst nur das, was man meint, dass es ist.
Bei Rot bleibe stehen!
Norbert Hoerster ist Rechtsphilosoph. Man hat ihm in den neunziger Jahren übel mitgespielt, weil er mit seinen Auffassungen zu Sterbehilfe und Embryonenschutz den mainstream verfehlte. Er verließ die Universität und schreibt seitdem Bücher. Jetzt also: Was ist Recht? Eine richtige Antwort kann der Autor natürlich nicht geben. Aber er kreist einige Elemente ein, die zu einer Annäherung führen sollen. Etwa: Wesen der Rechtsnorm; Recht ist Recht, wenn es zwangsweise durchgesetzt werden kann; Unterschied zwischen Normen des Rechts, der Moral und der Etikette; Adressaten der Rechtsnorm (Amtsträger, Volk?); sind die Normen einer Räuberbande Recht?; Rechtspositivismus versus Naturrecht; Trennung von Recht und Moral; Richterrecht; Unrecht als Recht.
Hoerster gibt sich dabei, werkgeschichtlich nicht überraschend, als modifizierter Rechtspositivist zu erkennen. Den Rahmen für die Antwort auf die Frage, was Recht ist, stellt die jeweilig geltende Rechtsordnung selbst auf. Metaphysische, naturrechtliche Fundamentalbegründungen lehnt Hoerster ab. Kelsen und seiner „Reinen Rechtslehre” wird aber ebenfalls eine Absage erteilt, nicht zuletzt in einem etwas zusammenhanglosen ausführlichen „Anhang”, der Hoersters geballte Kelsenkritik enthält.
Es handelt sich um ein merkwürdiges Buch. Merkwürdig deshalb, weil die einzelnen Begründungsgänge des Autors so überzeugend wie kleinstteilig und blutleer sind. In zahllosen Minibeispielen wird erörtert, wie es im Hinblick auf die Titelfrage zu bewerten ist, dass man bei Rot nicht über die Straße gehen darf, dass die Nichtzahlung des Mietzinses zur Zwangsvollstreckung führen kann, dass der Beischlaf zwischen Geschwistern verboten ist. Ein Gesamtbild – abgesehen vom auktorialen modifizierten Rechtspositivismus – ergibt sich im Hinblick auf die große Was-Frage nicht. Das hat vielleicht etwas mit der philosophischen Grundhaltung des Autors zu tun. Diese ist nämlich in gewisser Weise archaisch.
„Beschreiben und bewerten sind der Sache nach ganz unterschiedliche Aktivitäten” – „Eine Rechtsordnung und ihre Normen (kann man) völlig wertungsfrei erkennen und beschreiben . . . so, wie es wirklich ist”. Es wäre ungerecht und billig, diese klassische Haltung im Gefolge der neueren postmodernen, systemtheoretischen, konstruktivistischen oder sonstiger Gewissheiten zu verhöhnen. Aus ihr spricht eine Aufrichtigkeit, die das ganze Buch durchzieht. Doch so mustergültig die beschriebenen Argumente und die argumentativen Beschreibungen auch ausfallen – ein Bild dessen, was Recht ist, erscheint nicht. Das Synthetische, also gerade das Philosophische, geht den Erörterungen Hoersters fast gänzlich ab. Das kann man als Nüchternheit loben. Man kann es auch als Naivität gegenüber dem Politischen jeder – und gerade der juristischen – Argumentation kritisieren. Vor allem aber kann man betrübt darüber sein, dass hier ein Rechtsphilosoph in einer Manier schreibt, wie es die Rechtshistoriker und Rechtssoziologen lange getan haben und immer noch tun – mit allen Defiziten an Phantasie, der Königsklasse der Philosophie. RAINER MARIA KIESOW
NORBERT HOERSTER: Was ist Recht? Grundfragen der Rechtsphilosophie. Verlag C. H. Beck, München 2006. 160 Seiten, 10,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Das Buch des Rechtsphilosophen Norbert Hoerster hat für Gerd Roellecke zwei Seiten. Da sind Hoersters "politische Intentionen", die der Rezensent teilt. Und da sind seine "philosophischen Ansätze", deren auf der empirischen Wahrnehmbarkeit innerer Einstellungen basierende Konzeption Roellecke nicht akzeptiert. Genauso wenig wie Hoersters "Rechtspositivismus" und seinen "moralneutralen" Rechtsbegriff. Spätestens hier, meint Roellecke, wird jeder Rechtsprofessor protestieren, in dessen Rechtsverständnis Gerechtigkeit mehr wiegt als Macht. Auch das Problem der Verfassungsgebung findet Roellecke nicht zufriedenstellend behandelt. Wie in diesem Sinne Macht entsteht, sähe er gerne historisch, nicht apodiktisch geklärt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH