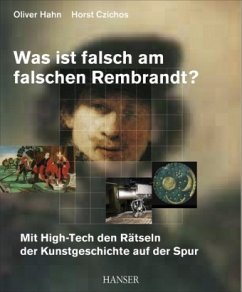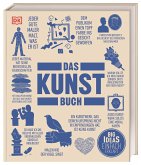Die Himmelsscheibe von Nebra, römische Statuen oder ein Kupferstich von Dürer - das Material, aus dem Kulturgüter bestehen, gibt ungeahnte Geheimnisse preis: über Alter, Entstehung - und Echtheit. Oliver Hahn und Horst Czichos sind High-Tech-Detektive der Bundesanstalt für Materialforschung. Mithilfe modernster Methoden und der Unterstützung kompetenter Experten lassen sie uns Kunstwerke aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten. Sie erläutern, wie sich die Echtheit von Meissner Porzellan beweisen lässt, entlarven eine Schubert-Partitur als Fälschung und rekonstruieren, wie der berühmte Porträtkopf der ägyptischen Königin Teje ursprünglich aussah. Czichos und Hahn lüften Geheimnisse über Albrecht Dürers private Vorlieben und beweisen, dass Rembrandts bekanntestes Selbstportrait nicht von ihm selbst stammt. Ein Buch über den Stoff, aus dem die Künste sind - und Physiker und Ingenieure, die dreisten Kunstfälschern das Handwerk legen.

Zahllose dreiste und perfekte Fälschungen haben im vergangenen Jahr den Kunstmarkt traumatisiert. Aber wie erkennt man, was gefälscht wurde? Ein neues Buch gibt Aufschluss.
VON SOPHIE VON MALTZAHN
Er sei die schönste aller antiken, griechischen Statuen, schrieb Johann Winckelmann im 18. Jahrhundert über die Bronze "Idolino". Im Jahr 1530 entdeckt, wurde die Figur mit den grazilen Muskelsträngen, dem lockigen Haar und symmetrischen Gesichtszügen in Florenz schon 1630 zum "Idol" für die griechische Kunst erklärt, woher sich sein Spitzname ableitet. Fast fünfhundert Jahre später erst ermittelte man durch computertomografische Untersuchungen in der Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung (BAM) seine wahre Identität: nicht griechisch, sondern römisch antik. Und das auch nur in Teilen. Seine Füße wurden nämlich während der Renaissance rekonstruiert. Verraten haben es die unterschiedlichen Dichten der Wandstärke. Während im antiken Rom mit Dünngusstechnik gearbeitet wurde, ist die Bronzewand in der Renaissance schon massiver - man goss zu der Zeit schließlich schon Kanonen. Millimeter kleine Unterschiede machen also Jahrhunderte, gar Jahrtausende der Zuschreibung aus. Auch die berühmte Plastik der bronzenen Wölfin, an deren Zitzen Romulus und Remus saugen, fiel unlängst als Original durch. Statt als Werk eines etruskischen Bildhauers, legte die Analyse offen, entstand es im Mittelalter.
Diese Erkenntnisse sind vor allem als eindringlichen Mahnung im Umgang mit jeglicher antiker Bronze zu bewerten, ist doch auch und besonders hier das Wesentliche für das Auge unsichtbar. Erst recht unter schwarzer Patina. Wie sich die Materialidentität von Kunstwerken ermitteln lässt, erläutern Oliver Hahn, Leiter der Arbeitsgruppe "Kunst- und Kulturgutanalyse" am BAM, und Horst Czichos, ehemaliger Präsident derselbigen, in der zweiten Auflage ihres Buches "Was ist falsch am falschen Rembrandt?". Epochen- und materialübergreifend zeigen sie an ausgewählten Beispielen, welche erstaunlichen Erkenntnisse aus Analysen gewonnen werden konnten, und geben einen Überblick über Methoden und Vergleichswerte, nach denen in jedem gut ausgestatteten Labor die Echtheit eines Kunstwerkes anhand seiner Datierung falsifiziert werden könnte.
Ein wichtiger Indikator für die Datierung noch älterer Objekte der Bronzezeit, ab 3000 vor Christus, ist Zink. In seiner Verarbeitung als metallische Legierung war es bis ins Mittelalter unbekannt. Nur der Zinkgehalt war es, der einst die vielen gefälschten antiken Skulpturen entlarvte, die der Kunstschlosser Karl Sioli aus Halle um 1900 goss und in Privatsammlungen wie Museen einschleuste. Erst Jahrzehnte nach seinem Tod im Jahr 1913 ließ sich der Betrug nachweisen.
Schon lange ein Lieblingsobjekt von Fälschern ist Porzellan. Bereits im 19. Jahrhundert wurden die ersten Meissner Designs aus den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts mit Chinoiserien und Landschaftsmotiven teuer gehandelt und dementsprechend gerne gefälscht. Aufklärung liefern hier die Elemente in grüner Farbe und Gold, deren Zusammensetzung sich im 19. Jahrhundert änderte. Da man den zum Original erklärten Scherben keine Probe entnehmen kann, ermittelt man die Inhaltsstoffe mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse. Grüne Pigmente mit Chromgehalt oder Goldfarbe mit Wismutsubstanzen überführen das Porzellan als Kopie oder Fälschung aus dem 19. Jahrhundert.
Auch bei der Untersuchung von Gemälden lässt der Nachweis von Chrom in grüner Farbe Warnlampen angehen, wenn es sich bei dem Werk um ein früheres, als aus dem 19. Jahrhundert handeln soll, denn Chrom kennt man darin erst ab 1809 beziehungsweise 1850. Genauso ist Zink mehr als einen zweiten Blick wert, sollte man ihn im Weiß eines deutlich früher als 1835 datierten Werks finden. Schwefel und Cadium in gelber Farbe sind Beweise, dass das Werk nicht vor 1825 entstanden sein kann. Alle diese chemiegeschichtlichen Fauxpas konnten die Forscher der BAM nachweisen, als ein Mann Mitte der Siebziger mit einem großen Stahlkoffer das Laboratorium betrat und behauptete, seine Version von Rembrandts Selbstbildnis mit Samtbarett und Pelzkragenmantel von 1634 sei die echte, die aus Sorge vor Bombenangriffen in Hitlers ostpreußische Kommandozentrale Wolfsschanze gebracht worden; in der Berliner Gemäldesammlung hinge bloß die Kopie.
Ein ganzes Kapitel ist eigens der Zusammensetzung von Farbmitteln gewidmet, worin Pigmente von der Antike bis zur Gegenwart tabellarisch ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrer ersten Herstellung nach sortiert sind. Darunter ist auch Titanweiß, das in seiner qualitätvolleren Form Rutil erst seit 1938 verfügbar war. Im jüngsten Kunstfälscherskandal um die sogenannte "Jägers-Sammlung" entlarvte sein Nachweis die Betrüger.
Hahn und Czichos machen aber auch deutlich, dass die Materialanalyse nach Stoff und Form immer nur eine Falsifizierung ergeben kann. Das Werk einem Künstler zuordnen, das kann nur die Stilkritik. Man kann aber nur hoffen, dass diese immer häufiger auf die Materialanalyse zurückgreifen wird und anerkennt, dass der Kennerblick eng gesteckten Grenzen unterliegt. Um überhaupt ein Urteil über die Authentizität zu fällen, müsste man sich schon mit Röntgenbrille, wenn nicht gar mit dem Chemiekoffer den vielen Kunstangeboten nähern.
Oliver Hahn / Horst Czichos: "Was ist falsch am falschen Rembrandt? Hanser Verlag, München 2011. 223 S., geb., 24,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main