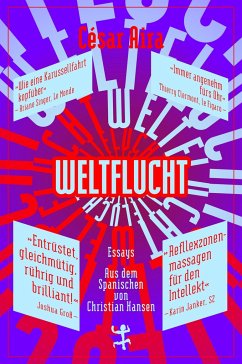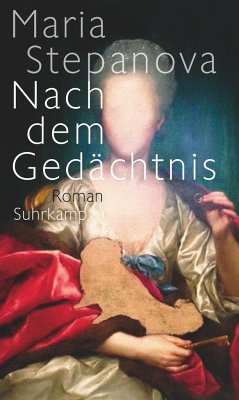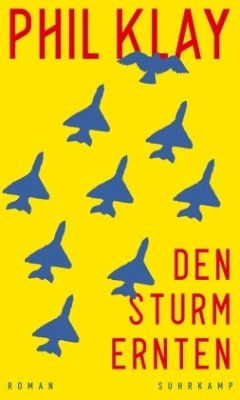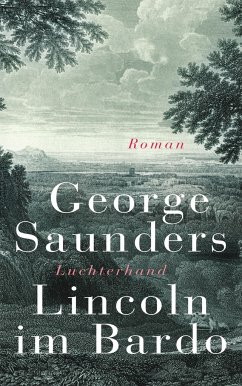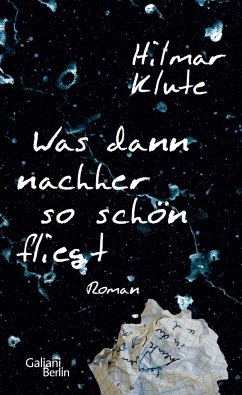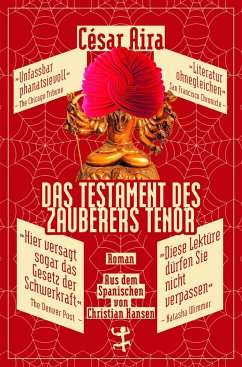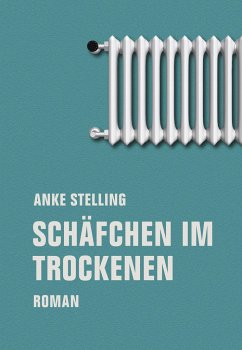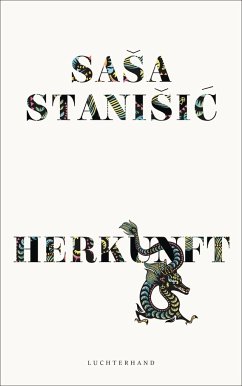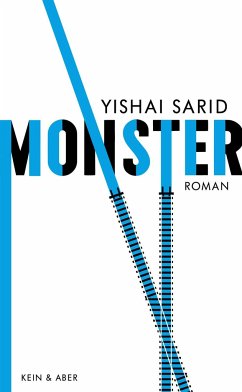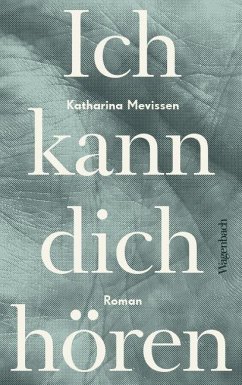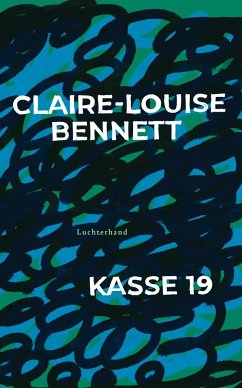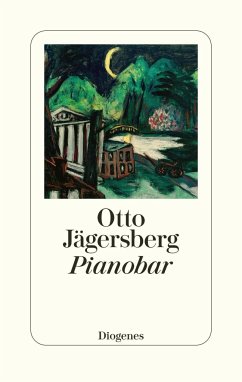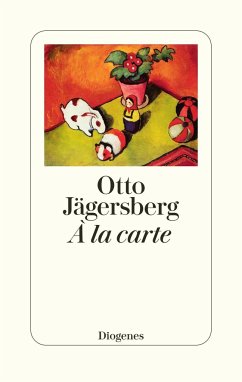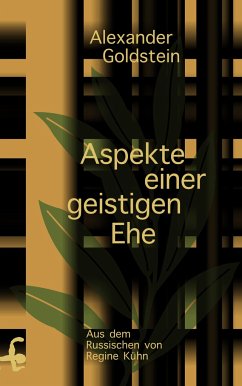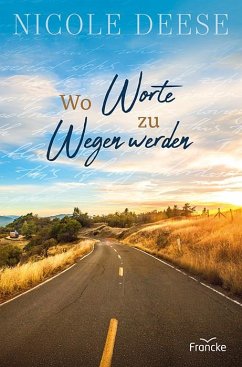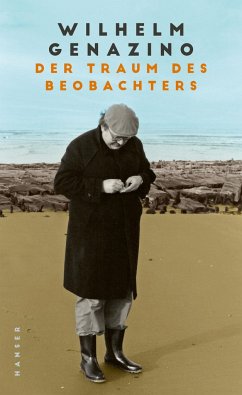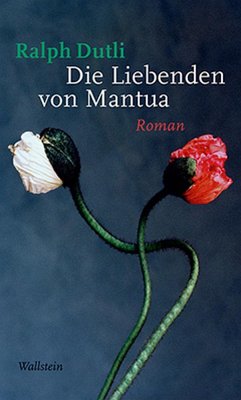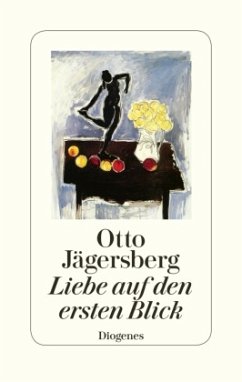César Aira
Gebundenes Buch
Was habe ich gelacht
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Ist das Lachen nicht bloßer Reflex, gedankenloses Schafsblöken, das der komplexen Tragikomik des Lebens nicht gerecht wird? Ein sinnentleerter Epilog, der auf eine gute Geschichte folgt? Aira eröffnet in dieser überraschend intimen Erzählung, die mal Autofiktion, mal wilde Fabel ist, einen Raum zwischen Witz und Gelächter, jenen Spalt, der oft zwischen dem eigenen Bewusstsein und der Gegenwart des Moments klafft: Darin finden wir Träume, Erinnerungen, einen Ozean der Wehmut - und schließlich auch das Lachen. Eigensinnig und doppelbödig zeigt sich der argentinische Ausnahmeautor hier i...
Ist das Lachen nicht bloßer Reflex, gedankenloses Schafsblöken, das der komplexen Tragikomik des Lebens nicht gerecht wird? Ein sinnentleerter Epilog, der auf eine gute Geschichte folgt? Aira eröffnet in dieser überraschend intimen Erzählung, die mal Autofiktion, mal wilde Fabel ist, einen Raum zwischen Witz und Gelächter, jenen Spalt, der oft zwischen dem eigenen Bewusstsein und der Gegenwart des Moments klafft: Darin finden wir Träume, Erinnerungen, einen Ozean der Wehmut - und schließlich auch das Lachen. Eigensinnig und doppelbödig zeigt sich der argentinische Ausnahmeautor hier in seiner ganzen weltliterarischen Größe.
César Aira, geboren 1949 in Coronel Pringles, veröffentlichte bisher über 80 Bücher: Romane, Novellen, Geschichten und Essays. Darüber hinaus übersetzt er aus dem Englischen, Französischen und Portugiesischen und lehrt an den Hochschulen von Rosario und Buenos Aires, wo er heute lebt. Aira gilt als einer der wichtigsten lateinamerikanischen Autoren der Gegenwart - und als ihr raffiniertester. Seine Texte überraschen durch Genresprünge, aberwitzige und riskante Erzählkonstruktionen und Plots. 2016 erhielt er den Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Christian Hansen, 1962 in Köln geboren, ist Übersetzer aus dem Spanischen. Zu den von ihm übersetzten Autoren zählen u. a. Roberto Bolaño, Julio Cortázar, Alan Pauls und Sergio Pitol.
Produktdetails
- Bibliothek César Aira 008
- Verlag: Matthes & Seitz Berlin
- Originaltitel: Cómo me reí
- 1. Auflage
- Seitenzahl: 92
- Erscheinungstermin: 15. Februar 2019
- Deutsch
- Abmessung: 185mm x 126mm x 16mm
- Gewicht: 172g
- ISBN-13: 9783957576859
- ISBN-10: 3957576857
- Artikelnr.: 54593563
Herstellerkennzeichnung
Matthes & Seitz Verlag
Großbeerenstraße 57A
10965 Berlin
vertrieb@matthes-seitz-berlin.de
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.02.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.02.2019Die Gespenster werden gratis mitgeliefert
Konzentriert auf die Flüchtigkeit des Nichtigen: Zwei neue Novellen von César Aira, dem Meistererzähler aus Argentinien
Die Verführungskraft ist unwiderstehlich. Pünktlich zum heutigen siebzigsten Geburtstag von César Aira bringt sein deutscher Verlag Matthes & Seitz gleich zwei Novellen des großen argentinischen Schriftstellers heraus. Und die eine der beiden Erzählungen handelt von einem alternden Zauberer, der seinen letzten Zaubertrick, nachdem er dessen Geheimnis sein Leben lang gehütet hat, jetzt einem Nachfolger vermachen will. Der Autor als Zauberkünstler - was für ein verführerisches Angebot. Aber wir schlagen diese Offerte aus, um Aira als das zu preisen, was er
Konzentriert auf die Flüchtigkeit des Nichtigen: Zwei neue Novellen von César Aira, dem Meistererzähler aus Argentinien
Die Verführungskraft ist unwiderstehlich. Pünktlich zum heutigen siebzigsten Geburtstag von César Aira bringt sein deutscher Verlag Matthes & Seitz gleich zwei Novellen des großen argentinischen Schriftstellers heraus. Und die eine der beiden Erzählungen handelt von einem alternden Zauberer, der seinen letzten Zaubertrick, nachdem er dessen Geheimnis sein Leben lang gehütet hat, jetzt einem Nachfolger vermachen will. Der Autor als Zauberkünstler - was für ein verführerisches Angebot. Aber wir schlagen diese Offerte aus, um Aira als das zu preisen, was er
Mehr anzeigen
tatsächlich ist: der gewiefteste und raffinierteste Ökonom unter den gegenwärtigen lateinamerikanischen Erzählern.
Schon sein Romandebüt, 1981 unter dem Titel "Ema, la cautiva" erschienen, was nicht nur die historische Bezeichnung für eine von Indianern Gefangene ist, sondern umgekehrt auch das Fesselnde, Gefangennehmende, ja Verzaubernde heißt, entpuppt sich als kalkuliert ausschweifende Wirtschafts- und Geldphantasie im Gewand der Verschleppungs- und Abenteuergeschichte. Auf Deutsch 2004 erschienen, ist sie gespickt mit Weltweisheiten wie: "Wenn man die Geschichte von allem hohlen Gefasel befreit, ist sie nichts als eine Folge von Zahlungen, je exorbitanter, desto besser. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Form und der Kredit." Tatsächlich mit einem heiklen Kredit gründet Ema am Ende der Erzählung mitten in der Pampa - wie man in diesem argentinischen Fall zu Recht sagen darf - ein Unternehmen.
Auch Airas international bislang größter erzählerischer Erfolg, "Gespenster", ist eine durch und durch ökonomische Novelle. Sie nimmt die Herkunft der Ökonomie von "oikos", dem häuslichen Herd, beim Wort und erzählt die Geschichte eines Wohnhauses im Rohbau, das sich sechs Eigentümer in einer Kaufgemeinschaft mit einer chilenischen Hausmeisterfamilie teilen. Nicht etwa ein kommunistisches Gespenst geht um in Airas ökonomischem Gesellschaftsentwurf, sondern zahlreiche Gespenster öffnen die Möglichkeitsräume zu alternativen Lebensweisen: "Los fantasmas", Geister, Phantasmen, Phantasien, hausen in den Winkeln, auf den Schwellen und Giebeln der Haushalte. Ob man will oder nicht, kauft man sie für teures Geld mit ein. Die Gespenster, ihren Spuk und die undefinierten Zwischenräume, in denen sie umgehen, muss man mit auf der Rechnung haben. Und derjenige, der mit ihnen rechnet, ist gerade nicht der klassische, sondern der erzählende Ökonom.
Das Öffnen der phantasmatischen Zwischenräume und -zeiten kann man in jeder einzelnen Geschichte von Airas verfolgen. Und spätestens an dieser Stelle treffen sich doch Ökonomie und Zauberei, denn macht der Zauberer etwas anderes, als trickreich einen Raum zwischen Illusion und realem Erlebnis zu öffnen und, mit den Geistern rechnend, einem ein Phantasma für echt zu verkaufen?
Tatsächlich unterliegt nicht nur César Airas literarische Produktion einer besonderen Ökonomie. Seit den neunziger Jahren verzichtet er darauf, Romane zu verfassen, und veröffentlicht stattdessen in schier unerschöpflich wirkender Produktivität zwei bis drei knapp einhundertseitige Erzählungen pro Jahr. Und in der Tat sind auch die beiden jetzt auf Deutsch erscheinenden Novellen von besonderer Erzählökonomie geprägt. "Was habe ich gelacht" spielt wie so viele Erzählungen von César Aira in dem kleinen Städtchen Pringles. Dieses argentinische Seldwyla liegt in der Provinz Buenos Aires und ist ein Ort, in dem sich außer der Fliesenfabrik des Großvaters noch nie ein Betrieb gehalten hat. In Pringles konzentriert man sich statt auf Leistung "auf den Stil, die Eleganz, die Zwecklosigkeit und, ganz allgemein, auf die Flüchtigkeit des Nichtigen". "Was habe ich gelacht" ist ein erzählerischer Essay über die Komik von Büchern, über das Lachen im Allgemeinen, über dessen soziale Funktion und bindende Kraft vor allem in der Jugend. Die einzelnen Reflexionen sind unterbrochen von feinkörnigen Beobachtungen, atmosphärischen Erinnerungsbildern und - tatsächlich im romantischen Sinne - wunderbaren Erzählsequenzen. Ein atemraubend eindringlicher Bogen von Erzählungen und Figuren, bei dem die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit ebenso verwischt wie die zwischen Theorie und Realität: "Im Grunde ist die Wirklichkeit viel theoretischer als das Denken" lautet einer der Leitsätze des Erzählens.
"Was habe ich gelacht" gleicht einer virtuosen Faltarbeit: Sie geht von der Feststellung des Erzählers aus, dass seine Leser ihn stets mit dem Kommentar "Was habe ich gelacht" ansprechen würden. Das sei das einzige, empörend unangemessene Urteil über seine Literatur, von dem er erfahre. Eine wirkungsökonomische Katastrophe, bedenke man nur, wie facettenreich seine Erzählungen doch auf so viel mehr Wirkungen als nur auf das Lachen abzielten. Von dieser Diagnose aus vertieft sich der Erzähler in die Sommer seiner Jugend, in denen das Lachen in seiner Clique ein Gegengewicht bildete zur sonst allgegenwärtigen Müdigkeit, welche das Leben der jungen Leute wie in einen Kokon eingesponnen hatte.
Kniff für Kniff sieht man dem Autor zu, wie er eine Erinnerungsschicht über die andere faltet, mit sicheren Handgriffen, sanft, präzise und zugleich entschieden über den Falz streichend, bis sich das Papier zu einer kunstvollen Figur fügt. Wobei die Erzählung mit der letzten Faltung, noch einmal von innen nach außen gewendet, plötzlich eine vollkommen neue Gestalt annimmt, sich als schwarzer Schwan entpuppt. Denn auch in den Fugen der einzelnen Textlagen nistet bei Aira das Gespenstische und bewirkt, dass das Erzählte lange etwas anderes zu sein scheint, als es wirklich ist.
Der Zauber dieser Erzählungen hängt von der dichten, atmosphärischen Beschreibung ab. Von den eindringlichen Szenen und einleuchtenden Bildern, die Airas entwirft. Alles kommt bei einer solchen Erzählweise auf die Balance zwischen den einzelnen Episoden an. Ausgerechnet die Erzählung "Das Testament des Zauberers Tenor" aber führt die Gefahr vor Augen, was passiert, wenn Aira nicht der Verführungskraft widerstehen kann, noch einen und noch einen und noch einen Stein in die spiegelglatte Erzähloberfläche zu werfen, um jeden einzelnen Erzählkreis bis zu seiner weitesten Ausdehnung zu verfolgen. Das Vermächtnis des Zauberers von der Schweiz bis nach Indien und schließlich bis zum totalen Zusammenbruch des Erzählens zu verfolgen sei aufgrund seiner extrem luxurierenden Erzählökonomie nur eingefleischten Aira-Lesern empfohlen. "Was habe ich gelacht" aber gehört zu den zauberhaftesten Erzählungen, die César Aira seinem Publikum geschenkt hat.
CHRISTIAN METZ
César Aira: "Was habe ich gelacht".
Aus dem Spanischen von Christian Hansen. Matthes & Seitz, Berlin 2019. 92 S., geb., 16,- [Euro].
César Aira:
"Das Testament des Zauberers Tenor".
Aus dem Spanischen von Christian Hansen. Matthes & Seitz, Berlin 2019. 168 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schon sein Romandebüt, 1981 unter dem Titel "Ema, la cautiva" erschienen, was nicht nur die historische Bezeichnung für eine von Indianern Gefangene ist, sondern umgekehrt auch das Fesselnde, Gefangennehmende, ja Verzaubernde heißt, entpuppt sich als kalkuliert ausschweifende Wirtschafts- und Geldphantasie im Gewand der Verschleppungs- und Abenteuergeschichte. Auf Deutsch 2004 erschienen, ist sie gespickt mit Weltweisheiten wie: "Wenn man die Geschichte von allem hohlen Gefasel befreit, ist sie nichts als eine Folge von Zahlungen, je exorbitanter, desto besser. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Form und der Kredit." Tatsächlich mit einem heiklen Kredit gründet Ema am Ende der Erzählung mitten in der Pampa - wie man in diesem argentinischen Fall zu Recht sagen darf - ein Unternehmen.
Auch Airas international bislang größter erzählerischer Erfolg, "Gespenster", ist eine durch und durch ökonomische Novelle. Sie nimmt die Herkunft der Ökonomie von "oikos", dem häuslichen Herd, beim Wort und erzählt die Geschichte eines Wohnhauses im Rohbau, das sich sechs Eigentümer in einer Kaufgemeinschaft mit einer chilenischen Hausmeisterfamilie teilen. Nicht etwa ein kommunistisches Gespenst geht um in Airas ökonomischem Gesellschaftsentwurf, sondern zahlreiche Gespenster öffnen die Möglichkeitsräume zu alternativen Lebensweisen: "Los fantasmas", Geister, Phantasmen, Phantasien, hausen in den Winkeln, auf den Schwellen und Giebeln der Haushalte. Ob man will oder nicht, kauft man sie für teures Geld mit ein. Die Gespenster, ihren Spuk und die undefinierten Zwischenräume, in denen sie umgehen, muss man mit auf der Rechnung haben. Und derjenige, der mit ihnen rechnet, ist gerade nicht der klassische, sondern der erzählende Ökonom.
Das Öffnen der phantasmatischen Zwischenräume und -zeiten kann man in jeder einzelnen Geschichte von Airas verfolgen. Und spätestens an dieser Stelle treffen sich doch Ökonomie und Zauberei, denn macht der Zauberer etwas anderes, als trickreich einen Raum zwischen Illusion und realem Erlebnis zu öffnen und, mit den Geistern rechnend, einem ein Phantasma für echt zu verkaufen?
Tatsächlich unterliegt nicht nur César Airas literarische Produktion einer besonderen Ökonomie. Seit den neunziger Jahren verzichtet er darauf, Romane zu verfassen, und veröffentlicht stattdessen in schier unerschöpflich wirkender Produktivität zwei bis drei knapp einhundertseitige Erzählungen pro Jahr. Und in der Tat sind auch die beiden jetzt auf Deutsch erscheinenden Novellen von besonderer Erzählökonomie geprägt. "Was habe ich gelacht" spielt wie so viele Erzählungen von César Aira in dem kleinen Städtchen Pringles. Dieses argentinische Seldwyla liegt in der Provinz Buenos Aires und ist ein Ort, in dem sich außer der Fliesenfabrik des Großvaters noch nie ein Betrieb gehalten hat. In Pringles konzentriert man sich statt auf Leistung "auf den Stil, die Eleganz, die Zwecklosigkeit und, ganz allgemein, auf die Flüchtigkeit des Nichtigen". "Was habe ich gelacht" ist ein erzählerischer Essay über die Komik von Büchern, über das Lachen im Allgemeinen, über dessen soziale Funktion und bindende Kraft vor allem in der Jugend. Die einzelnen Reflexionen sind unterbrochen von feinkörnigen Beobachtungen, atmosphärischen Erinnerungsbildern und - tatsächlich im romantischen Sinne - wunderbaren Erzählsequenzen. Ein atemraubend eindringlicher Bogen von Erzählungen und Figuren, bei dem die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit ebenso verwischt wie die zwischen Theorie und Realität: "Im Grunde ist die Wirklichkeit viel theoretischer als das Denken" lautet einer der Leitsätze des Erzählens.
"Was habe ich gelacht" gleicht einer virtuosen Faltarbeit: Sie geht von der Feststellung des Erzählers aus, dass seine Leser ihn stets mit dem Kommentar "Was habe ich gelacht" ansprechen würden. Das sei das einzige, empörend unangemessene Urteil über seine Literatur, von dem er erfahre. Eine wirkungsökonomische Katastrophe, bedenke man nur, wie facettenreich seine Erzählungen doch auf so viel mehr Wirkungen als nur auf das Lachen abzielten. Von dieser Diagnose aus vertieft sich der Erzähler in die Sommer seiner Jugend, in denen das Lachen in seiner Clique ein Gegengewicht bildete zur sonst allgegenwärtigen Müdigkeit, welche das Leben der jungen Leute wie in einen Kokon eingesponnen hatte.
Kniff für Kniff sieht man dem Autor zu, wie er eine Erinnerungsschicht über die andere faltet, mit sicheren Handgriffen, sanft, präzise und zugleich entschieden über den Falz streichend, bis sich das Papier zu einer kunstvollen Figur fügt. Wobei die Erzählung mit der letzten Faltung, noch einmal von innen nach außen gewendet, plötzlich eine vollkommen neue Gestalt annimmt, sich als schwarzer Schwan entpuppt. Denn auch in den Fugen der einzelnen Textlagen nistet bei Aira das Gespenstische und bewirkt, dass das Erzählte lange etwas anderes zu sein scheint, als es wirklich ist.
Der Zauber dieser Erzählungen hängt von der dichten, atmosphärischen Beschreibung ab. Von den eindringlichen Szenen und einleuchtenden Bildern, die Airas entwirft. Alles kommt bei einer solchen Erzählweise auf die Balance zwischen den einzelnen Episoden an. Ausgerechnet die Erzählung "Das Testament des Zauberers Tenor" aber führt die Gefahr vor Augen, was passiert, wenn Aira nicht der Verführungskraft widerstehen kann, noch einen und noch einen und noch einen Stein in die spiegelglatte Erzähloberfläche zu werfen, um jeden einzelnen Erzählkreis bis zu seiner weitesten Ausdehnung zu verfolgen. Das Vermächtnis des Zauberers von der Schweiz bis nach Indien und schließlich bis zum totalen Zusammenbruch des Erzählens zu verfolgen sei aufgrund seiner extrem luxurierenden Erzählökonomie nur eingefleischten Aira-Lesern empfohlen. "Was habe ich gelacht" aber gehört zu den zauberhaftesten Erzählungen, die César Aira seinem Publikum geschenkt hat.
CHRISTIAN METZ
César Aira: "Was habe ich gelacht".
Aus dem Spanischen von Christian Hansen. Matthes & Seitz, Berlin 2019. 92 S., geb., 16,- [Euro].
César Aira:
"Das Testament des Zauberers Tenor".
Aus dem Spanischen von Christian Hansen. Matthes & Seitz, Berlin 2019. 168 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Subversives Narrativ
Er schreibe nicht für ein großes Publikum, hat der argentinische Schriftsteller César Aira, ewiger Nobelpreis-Kandidat, in einem Interview geäußert, und so ist denn auch sein Roman «Was habe ich gelacht» eher etwas für …
Mehr
Subversives Narrativ
Er schreibe nicht für ein großes Publikum, hat der argentinische Schriftsteller César Aira, ewiger Nobelpreis-Kandidat, in einem Interview geäußert, und so ist denn auch sein Roman «Was habe ich gelacht» eher etwas für literarische Gourmets. Sein Œuvre besteht unter anderem aus Dutzenden von Kurzromanen, davon schreibt er mehrere pro Jahr, immer nach dem Motto: Hundert Seiten sind genug. Wobei auch der vorliegende Band einem literarischen Genre kaum eindeutig zuzuordnen ist, er enthält einerseits Elemente des Essays, ist andererseits zum Teil aber auch eindeutig surrealistisch. César Aira wird im Klappentext als «Ausnahmeautor» bezeichnet, von «weltliterarischer Größe», - und das stimmt hier ausnahmsweise tatsächlich mal, es sind keine lediglich umsatzfördernde Werbephrasen!
«Mit unwirschem Bedauern höre ich Leser zu mir sagen, sie hätten bei meinen Büchern ‹gelacht›, und muss mich bitter über sie beklagen», heißt es gleich im ersten Satz des autofiktionalen Kurzromans. Und der Ich-Erzähler fügt ergänzend hinzu, «dass mir derartige Kommentare meine schriftstellerische Existenz vergällt haben». Denn Lachen in der Literatur «als obligatorische Coda aller Erzählungen» sei ihm ein Graus. Dieses Lamento zieht sich über viele Seiten dahin, zeitlich beginnend in der Jugend des Autors im Kreise seiner Clique, der er in Pringles, einer Kleinstadt im Süden der Provinz Buenos Aires, angehört. Mit vielen Anekdoten angereichert erzählt er von deren ungeschriebenen Konventionen und von seinem Außenseiter-Status. Er versucht die Mechanismen zu verstehen, die ihn zum Spielverderber in diesem Kreis werden ließ, aber auch sein Desinteresse an den eher lethargischen Freunden. Wenn er beharrlich fragend alles über sie erfahren hat, sind sie als Quelle für ihn quasi «ausgebrannt», - dem Spion gleichend, der nichts Neues mehr zu berichten weiß.
César Aira schildert in einem virtuosen Mix aus Realität und Fiktion, wie sein Alter Ego im Buch Spaß rezipiert, wobei sein Humor ausgesprochen unterschwellig angelegt ist. Außer der von seinem Großvater gegründeten Fliesenfabrik, die den Ort ökonomisch prägte, habe sich dort noch nie ein Betrieb längere Zeit gehalten. «Pringles war für Firmen ein Fluch», - Seldwyla lässt grüßen! Eine Freundin foppt den arglosen jungen Mann, als sie ihm von ihrer weitverzweigten Verwandtschaft in Buenos Aires erzählt, wo er studieren will. Dabei kommt sie vom Hundertsten ins Tausendste, die Aufzählung ihrer Großsippe dort erstreckt sich über mehrere Seiten des Romans und listet dabei fast sämtliche gebräuchlichen Vornamen Argentiniens auf. Es gibt auch mystische Szenen, im riesigen Park der Fabrikantenvilla des Großvaters taucht des Nachts öfter mal Sylvia auf, eine nur undeutlich sichtbare Frauengestalt, die «um Mitternacht ihr gräusliches Gelächter» auszustoßen beginnt. Als der Vater dem Spuk nachgehen will, wird er am nächsten Morgen mit gebrochenem Genick am Grund einer Schlucht gefunden. Nach dem Studium ist der Protagonist in Buenos Aires hängen geblieben und wohnt vierzig Jahre später immer noch in der kleinen Wohnung, die seine Mutter ihm zum Studienbeginn geschenkt hatte. «Und da ich nie auf Reisen gehe oder in Urlaub fahre, kann ich mit dem interessanten Rekord prahlen, nicht einen einzigen Tag, keine einzige Nacht außerhalb dieser zwei Zimmer verbracht zu haben». Sein Bewegungsradius betrage gerade mal zwei, drei Straßenzüge um seine Behausung herum. «Meine Blase ist von der Größe einer Linse, alle fünf Minuten muss ich pinkeln, und das kann ich nirgendwo anders als in meinem Bad».
Das «gottverdammte Lachen» erweist sich letztendlich also als doppelbödig, ist nichts anderes als Satire, was man durch diverse eingestreute, melancholische Szenen leicht überlesen kann bei einem derart subversiven Narrativ. Besonders hat mir die Schlüsselloch-Perspektive gefallen, mit der César Aira seinen Lesern beim Schreiben erhellende literarische Einblicke gewährt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für