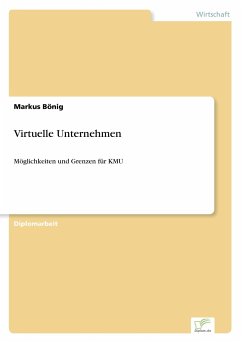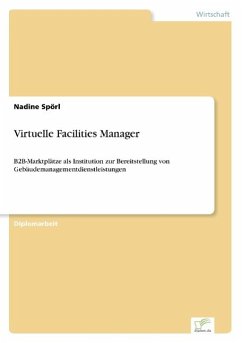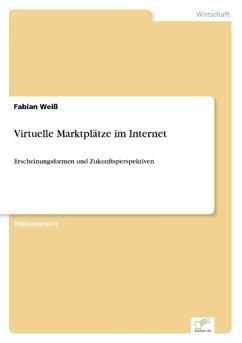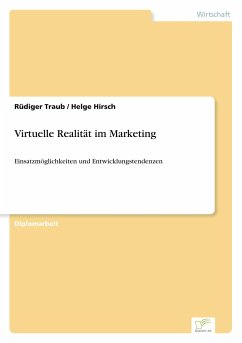Diplomarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,7, Leuphana Universität Lüneburg (Betriebswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
In den letzten Jahren hat sich der Wettbewerb in Industrien wie der Automobilzulieferindustrie drastisch verschärft. Im Zuge der Globalisierung der Märkte, also der Ausdehnung des Teilezukaufs auf die internationalen Beschaffungsmärkte, hat sich auch die Konkurrenz heimischer Zulieferer erweitert. Osteuropäische und asiatische Billiglohnländer schaffen mit ihren Angeboten einen starken Preisdruck.
Zusätzlich stellt die Strategie des Single Sourcing die Zulieferer vor neue Anforderungen, da die meisten Hersteller langfristig bemüht sind, die Zahl ihrer Direktzulieferer stark einzuschränken. Die gelieferten Produkte müssen dadurch immer stärker Systemcharakter besitzen und weisen somit auch eine höhere Komplexität auf. Die zunehmende Produktvielfalt der Hersteller verringert andererseits die Stückzahlen der einzelnen Modelle und erhöht hiermit den relativen Entwicklungsaufwand pro Modell. Dieser Trend wird durch die Verkürzung der Produktlebenszyklen weiter verstärkt.
Unternehmen, die im Zuliefermarkt wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen daher über breites Know-how verfügen und in der Lage sein, kostengünstig zu produzieren. Sie müssen flexibel auf die Anforderungen des Kunden reagieren und in kurzer Zeit Produkte mit hoher Qualität entwickeln können.
Kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fällt es zunehmend schwerer, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Weder verfügen sie über das breite Know-how, das heute von einem Lieferanten umfangreicher Systeme erwartet wird, noch stehen ihnen die Finanzmittel zur Verfügung, um dem Kunden rund um die Welt zu folgen bzw. dort zu fertigen, wo die Produktionskosten niedrig sind. Mittelständische Zulieferunternehmen sind deshalb gut beraten, unter anderem Kooperationen mit anderen Mittelständlern einzugehen, um sich gegenseitig zu ergänzen. Eine in der Literatur derzeit vieldiskutierte Kooperationsform ist das Virtuelle Unternehmen. Die Idee dieser flexiblen Kooperationsform ist die überbetriebliche Verlagerung, Integration und Konzentration von Geschäftsprozessen der Kooperationspartner. .
Gang der Untersuchung:
Zunächst bedarf es meines Erachtens einer differenzierten Auseinandersetzung über die konkreten Ausgestaltungen des Virtuellen Unternehmens, sowie der Voraussetzungen. Der Begriff, die Merkmale und die Entstehungsgeschichte der Virtuellen Unternehmung, die im zweiten Kapitel erläutert werden, sind auch für die meisten Insider der Szene noch unbekannte Selbstverständlichkeiten. Dabei sollen hier weniger die informationstechnologischen Aspekte beleuchtet werden, da sie weder Virtualisierungs-strategien wirklich ermöglichen noch verhindern. Die beiden Netzwerkexperten Nitin und Nohria und Robert G. Eccles bestätigten diese Position bei einer Konferenz an der Harvard University: Man kann Netzwerkorganisationen nicht allein auf elektronischen Netzwerken aufbauen. Es geht mir hier vielmehr um die komplexen organisationalen und kommunikativen Prozesse. Der bisherigen Diskussion mangelt es - ihrer eigenen Einschätzung nach - sowohl an einer operativen, konsistenten Modellierung von Virtualisierungsstrategien als auch am Praxisbezug.
Am Ende des dritten Kapitels steht deshalb ein komplexeres Modell, das zwischen vier Ebenen mit jeweils vielschichtigen Dimensionen der Virtualisierung unterscheidet. Anhand des Modells lässt sich der aktuelle und der angestrebte Virtualisierungsgrad in den jeweiligen Virtualisierungsdimensionen ableiten.
Das sich anschließende vierte Kapitel setzt sich aus drei Teilbereichen zusammen. Auf der einen Seite werden konkrete Chancen der interorganisationalen Virtualisierung für KMUs aufgezeigt. Auf der ande...
In den letzten Jahren hat sich der Wettbewerb in Industrien wie der Automobilzulieferindustrie drastisch verschärft. Im Zuge der Globalisierung der Märkte, also der Ausdehnung des Teilezukaufs auf die internationalen Beschaffungsmärkte, hat sich auch die Konkurrenz heimischer Zulieferer erweitert. Osteuropäische und asiatische Billiglohnländer schaffen mit ihren Angeboten einen starken Preisdruck.
Zusätzlich stellt die Strategie des Single Sourcing die Zulieferer vor neue Anforderungen, da die meisten Hersteller langfristig bemüht sind, die Zahl ihrer Direktzulieferer stark einzuschränken. Die gelieferten Produkte müssen dadurch immer stärker Systemcharakter besitzen und weisen somit auch eine höhere Komplexität auf. Die zunehmende Produktvielfalt der Hersteller verringert andererseits die Stückzahlen der einzelnen Modelle und erhöht hiermit den relativen Entwicklungsaufwand pro Modell. Dieser Trend wird durch die Verkürzung der Produktlebenszyklen weiter verstärkt.
Unternehmen, die im Zuliefermarkt wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen daher über breites Know-how verfügen und in der Lage sein, kostengünstig zu produzieren. Sie müssen flexibel auf die Anforderungen des Kunden reagieren und in kurzer Zeit Produkte mit hoher Qualität entwickeln können.
Kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fällt es zunehmend schwerer, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Weder verfügen sie über das breite Know-how, das heute von einem Lieferanten umfangreicher Systeme erwartet wird, noch stehen ihnen die Finanzmittel zur Verfügung, um dem Kunden rund um die Welt zu folgen bzw. dort zu fertigen, wo die Produktionskosten niedrig sind. Mittelständische Zulieferunternehmen sind deshalb gut beraten, unter anderem Kooperationen mit anderen Mittelständlern einzugehen, um sich gegenseitig zu ergänzen. Eine in der Literatur derzeit vieldiskutierte Kooperationsform ist das Virtuelle Unternehmen. Die Idee dieser flexiblen Kooperationsform ist die überbetriebliche Verlagerung, Integration und Konzentration von Geschäftsprozessen der Kooperationspartner. .
Gang der Untersuchung:
Zunächst bedarf es meines Erachtens einer differenzierten Auseinandersetzung über die konkreten Ausgestaltungen des Virtuellen Unternehmens, sowie der Voraussetzungen. Der Begriff, die Merkmale und die Entstehungsgeschichte der Virtuellen Unternehmung, die im zweiten Kapitel erläutert werden, sind auch für die meisten Insider der Szene noch unbekannte Selbstverständlichkeiten. Dabei sollen hier weniger die informationstechnologischen Aspekte beleuchtet werden, da sie weder Virtualisierungs-strategien wirklich ermöglichen noch verhindern. Die beiden Netzwerkexperten Nitin und Nohria und Robert G. Eccles bestätigten diese Position bei einer Konferenz an der Harvard University: Man kann Netzwerkorganisationen nicht allein auf elektronischen Netzwerken aufbauen. Es geht mir hier vielmehr um die komplexen organisationalen und kommunikativen Prozesse. Der bisherigen Diskussion mangelt es - ihrer eigenen Einschätzung nach - sowohl an einer operativen, konsistenten Modellierung von Virtualisierungsstrategien als auch am Praxisbezug.
Am Ende des dritten Kapitels steht deshalb ein komplexeres Modell, das zwischen vier Ebenen mit jeweils vielschichtigen Dimensionen der Virtualisierung unterscheidet. Anhand des Modells lässt sich der aktuelle und der angestrebte Virtualisierungsgrad in den jeweiligen Virtualisierungsdimensionen ableiten.
Das sich anschließende vierte Kapitel setzt sich aus drei Teilbereichen zusammen. Auf der einen Seite werden konkrete Chancen der interorganisationalen Virtualisierung für KMUs aufgezeigt. Auf der ande...