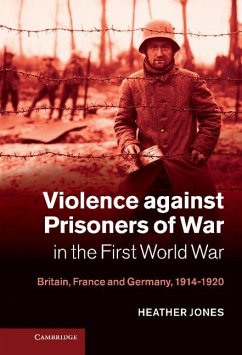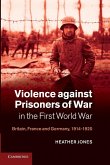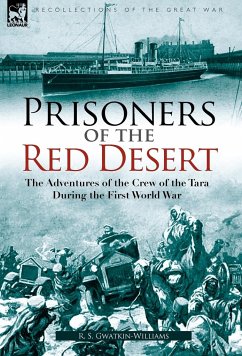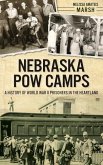Kriegsgefangene des Ersten Weltkrieges in Deutschland, England und Frankreich
Die furchtbaren Bilder verhungernder russischer Kriegsgefangener während des Zweiten Weltkrieges sind weithin bekannt. Sie gelten als Beispiele für die verbrecherische Art, mit der das nationalsozialistische Regime ungeachtet aller internationalen Konventionen einen Teil der von der Wehrmacht gefangenen Soldaten behandelte. Doch so umfassend die Lage der Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg erforscht ist, so "stiefmütterlich" haben Historiker bisher das Schicksal der Gefangenen des Ersten Weltkrieges behandelt. Angesichts der Bedeutung dieser "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" und der Erfahrungen, die geschätzte sieben bis neun Millionen Kriegsgefangene (genaue Zahlen existieren nicht) machten, ist dies mehr als erstaunlich.
Die auf breiter Quellengrundlage beruhende Studie von Heather Jones knüpft an einzelne Arbeiten an, geht aber insgesamt doch weit über diese hinaus. Sie versteht ihre Arbeit ausdrücklich als Beitrag zu einer modernen Kulturgeschichte der Gewalt. Aus ihrer Sicht ist der Umgang der jeweiligen Regierungen und Armeen, aber auch der Öffentlichkeit mit gefangenen Soldaten viel besser geeignet, weiter gehende Einsichten in den schleichenden Prozess der Radikalisierung von Gewalt zu gewinnen, als dies bei der traditionellen Konzentration auf das Geschehen auf dem Schlachtfeld möglich sei. Ihre vergleichende Betrachtung der Behandlung von Kriegsgefangenen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien soll zugleich nationale Besonderheiten und internationale Gemeinsamkeiten herausarbeiten. In Anlehnung an andere Studien geht es ihr dabei vor allem um die Frage, ob die deutsche militärische Kultur tendenziell "gewalttätiger" gewesen sei als die englische oder französische.
In drei großen Abschnitten beschreibt die Verfasserin das Schicksal der Kriegsgefangenen. Das Bild, das sie dabei zeichnet, ist erschütternd. Auch wenn die Zahl derjenigen, die in Gefangenschaft ihr Leben verloren - zirka 36 000 deutsche Soldaten in alliierten, zirka 26 000 alliierte Soldaten in deutschen Lagern - im Vergleich zu den Millionen toten Gefangenen während des Zweiten Weltkrieges gering erscheint, so war das dominierende Merkmal von Gefangenschaft über alle Grenzen hinweg gleichwohl die Erfahrung von stetig zunehmender physischer und psychischer Gewalt. Dies begann damit, dass Gefangene - teilweise auf Befehl - noch auf dem Schlachtfeld erschossen wurden, weil der Gegner sich mit ihnen während des Vormarschs nicht unnötig belasten wollte. Gerade zu Beginn des Krieges soll dies auf deutscher Seite immer wieder vorgekommen sein. Aber auch die französische Armee setzte seit 1916 eigene Kommandos ein, die gestürmte Schützengräben "säuberten", indem sie dort vorgefundene Verwundeten töteten, anstatt sie gefangen zu nehmen.
Einmal in der Hand des Gegners, war keineswegs sichergestellt, dass Gefangene entsprechend den vereinbarten Normen behandelt wurden. Allein der Marsch in die Lager war in der aufgeheizten Atmosphäre des Krieges häufig eine Tortur: Beschimpfungen waren an der Tagesordnung, häufig flogen Steine, oder es kam zu Handgreiflichkeiten, von begleitenden Wachmannschaften zumeist geduldet. In den Lagern waren Hunger und Gewalt nicht unüblich. Hinzu kamen Seuchen, denen, wie 1915 in Deutschland, annähernd 5000 Gefangene zum Opfer fielen. Ob dafür - wie von alliierter Seite behauptet und von der Verfasserin für durchaus plausibel gehalten - vorsätzliche Vernachlässigung oder schlichtweg Überforderung der beteiligten amtlichen Stellen verantwortlich waren, muss offen bleiben. Aber auch in französischen Lagern war die Lage der deutschen Gefangenen schwierig. Vor allem diejenigen, die zum Straßenbau in die nordafrikanischen Kolonien transportiert worden waren, litten unter Hitze, harter Arbeit und tropischen Krankheiten, aber auch gezielten Misshandlungen.
Je länger der Krieg dauerte, umso mehr griffen alle Armeen auf Gefangene als Arbeitskräfte zurück, um die Lücken an der Heimatfront wenigstens teilweise zu schließen. Am stärksten ausgeprägt war dies wohl auf deutscher Seite - eine Tatsache, die für die Verfasserin zugleich ein Beleg für die besonders für das Deutsche Reich festzustellende Radikalisierung und Totalisierung des Krieges ist. Viel dramatischer als das Schicksal derjenigen, die in der Landwirtschaft oder der Industrie eingesetzt waren, war jedoch das Leben derer, die unmittelbar hinter den Fronten eingesetzt wurden, um Schützengräben auszuheben oder Unterstände zu bauen. Ihre Behandlung war menschenunwürdig: Zumeist lagen sie auf offenem Feld; Wind, Regen und Kälte, aber auch dem zahllose Opfer fordernden Beschuss der eigenen Artillerie ungeschützt ausgesetzt. Die Skrupellosigkeit, mit der insbesondere Deutsche und Franzosen ihre Gefangenen zeitweise behandelten, war ursächlich für einen schleichenden Prozess der Eskalation von Gewalt: 1916/17 misshandelten beide Seite ihre Gefangenen sogar absichtlich, um das Schicksal der jeweils eigenen in der Hand des Gegners zu verbessern.
Insgesamt leistet diese Studie einen wichtigen Beitrag zu einem lange vernachlässigten Thema. Der vergleichende Blick eröffnet neue Perspektiven. Ob allerdings die an die Sonderwegs-These anknüpfende Behauptung überzeugt, die deutsche militärische Kultur habe an sich ein höheres Maß an Gewalt ermöglicht, ja bewusst erzeugt, als dies bei den Alliierten aufgrund einer stärker ausgeprägten zivilen Tradition und politischen Kontrolle der Fall gewesen sei, bliebe durch weitere Forschungen zur "Kultur von Gewalt" im Zeitalter der Weltkriege erst noch zu beweisen. Dies gilt auch für die vorsichtig angedeuteten Kontinuitäten zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg.
MICHAEL EPKENHANS.
Heather Jones: Violence against Prisoners of War in the First World War. Britain, France and Germany, 1914-1920. Cambridge University Press, Cambridge 2011. 468 S., 84,85 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main