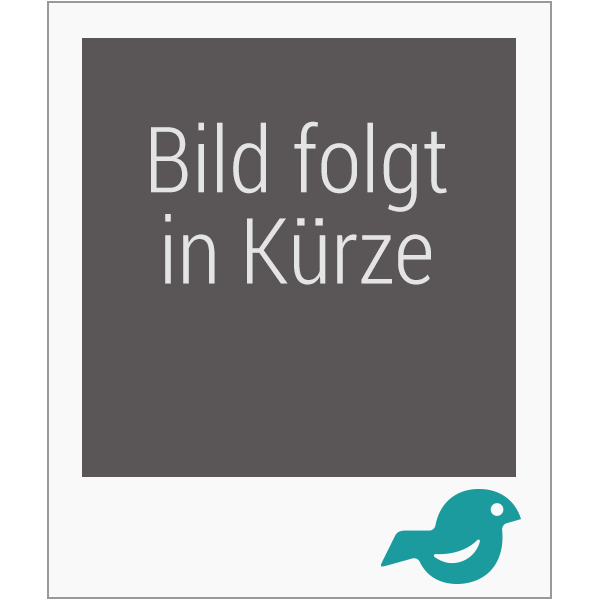Produktdetails
- Verlag: Insel
- ISBN-13: 9783763244126
- ISBN-10: 3763244123
- Artikelnr.: 26170868

Empfohlen werden nach einer monatlich erstellten Rangliste Bücher der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften sowie angrenzender Gebiete.
1. ALEXANDER DEMANDT: Alexander der Große. Leben und Legende. Verlag C. H. Beck, 655 Seiten, 29,90 Euro.
2. TONY JUDT: Das vergessene Jahrhundert. Die Rückkehr des politischen Intellektuellen. Übersetzt von Matthias Fienbork, Carl Hanser Verlag, 475 Seiten, 27,90 Euro.
3.-4. JOHN GRAY: Von Menschen und anderen Tieren. Abschied vom Humanismus. Aus dem Englischen von Alain Kleinschmied, Verlag Klett-Cotta, 246 Seiten, 19,90 Euro.
SIRI HUSTVEDT: Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven. Übersetzt von Uli Aumüller und Grete Osterwald, Rowohlt Verlag, 236 Seiten, 18,90 Euro.
5. SVENJA GOLTERMANN: Die Gesellschaft der Überlebenden. Deutsche Kriegsheimkehrer und ihre Gewalterfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Deutsche Verlags-Anstalt, 592 Seiten, 29,95 Euro.
6. KURT FLASCH: Meister Eckhart. Philosophie des Christentums. Verlag C. H. Beck, 365 Seiten, 24,95 Euro.
7. PHILIPP FELSCH: Wie August Petermann den Nordpol erfand. Luchterhand Literaturverlag, 272 Seiten, 12 Euro.
8. RUDI PALLA: Verschwundene Arbeit. Von Barometermachern, Drahtziehern, Eichmeistern, Lustfeuerwerkern, Nachtwächtern, Planetenverkäufern, Rosstäuschern, . . . und vielen anderen untergegangenen Berufen. Christian Brandstätter Verlag, 280 Seiten, 35 Euro.
9.-10. SARAH BLAFFER HRDY: Mütter und Andere. Wie die Evolution uns zu sozialen Wesen gemacht hat. Übersetzt von Thorsten Schmidt, Berlin Verlag, 537 Seiten, 28 Euro.
ALEXANDRE KOJEVE, LEO STRAUSS: Die Kunst des Schreibens. Hrsg. von Andreas Hiepko, übersetzt von Peter Geble und Andreas Hiepko, Nachwort von Friedrich Kittler, Merve Verlag, 104 Seiten, 10 Euro.
Besondere Empfehlung des Monats April von Herfried Münkler:
JOHN KENNETH GALBRAITH: Eine kurze Geschichte der Spekulation. Übersetzt von Wolfgang Rhiel, Eichborn Verlag, 123 Seiten, 14,95 Euro.
Die Jury: Rainer Blasius, Eike Gebhardt, Fritz Göttler, Wolfgang Hagen, Daniel Haufler, Otto Kallscheuer, Petra Kammann, Guido Kalberer, Elisabeth Kiderlen, Jörg-Dieter Kogel, Hans Martin Lohmann, Ludger Lütkehaus, Herfried Münkler, Wolfgang Ritschl, Florian Rötzer, Johannes Saltzwedel, Albert von Schirnding, Jacques Schuster, Norbert Seitz, Hilal Sezgin, Elisabeth von Tadden, Andreas Wang, Uwe Justus Wenzel.
Redaktion: Andreas Wang (NDR Kultur)
Die nächste SZ/NDR/BuchJournal-Liste der Sachbücher des Monats erscheint am 30. April.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Von Ammen, Pechsiedern und Wasserstiefelschustern: Rudi Pallas grandioses Lexikon untergegangener Berufe
Die Ammen, die Fächermacher, die Farbenmacher, Pottaschesieder und Zinngießer, Drahtzieher, Nachtwächter und Laternenanzünder, die Bader, Kastrierer und Wagenschmiermänner, sie alle gehören in jene versunkenen Arbeitswelten, die Rudi Palla in seinem Buch der untergegangenen Berufe beschreibt. Er verschafft ihnen als Archäologe des Alltags noch einmal einen großen Auftritt, entfaltet für den Leser dieses so lehrreichen wie unterhaltsamen Lexikons - nicht chronologisch und auch nicht auf Vollständigkeit Anspruch erhebend - eine Kulturgeschichte der Arbeit von der Antike bis ins Industriezeitalter.
Wehmut muss nicht aufkommen, denn Palla porträtiert anschaulich und oft lakonisch hartes Handwerk und Lebensumstände, die zum Glück überwunden sind; soziale Nischen, die auch gegen die Konkurrenz verteidigt werden mussten. Dort gedieh zuweilen eine eigene kulturelle Identität, mit Liedern, Tänzen und Witzen, die damals zwar in den Feuilletons gefeiert wurden und uns heute allenfalls noch als Redewendungen und aus der Literatur bekannt sind. Im wirklichen Leben schufteten etwa die Wäscherinnen oder Wäschemädels im Wien der Biedermeierzeit unter schwersten Bedingungen und für karges Entgelt gegen eine großstädtische Konkurrenz, der sie nur bedingt standhielten, woran die schönen Lieder und ihre Schlagfertigkeit nichts änderten.
Es waren nicht nur Maschinen und technologischer Fortschritt, die traditionelle Berufe verdrängten, sondern auch eine immer komplexere Arbeitsteilung und die zunehmende Verstädterung. Der Gassenkehrer von einst, ein wegen seiner schmutzigen Dienstleistung meist verachteter Beruf, existiert heute als Müllmann der Stadtwerke weiter. Auch das eine harte Arbeit, doch respektiert - spätestens dann, wenn man ein paar Streikwochen und Müllberge vor der Haustür überstanden hat. Andere sind als exklusive Handarbeitsprodukte zurückgekehrt, ohne dass jedoch der dazugehörige Beruf - zum Beispiel ein Seifensieder - dem Käufer vorstellbar wäre. Und wo die Farben, mit denen heute Massenware wie Jeans gefärbt wird, herkommen, will sich der politisch korrekt erzogene Mensch lieber gar nicht vorstellen.
Jahrhundertelang aber war es üblich, dem eigenen Tun, der Existenz, von der man lebte, und mochte sie noch so schwer sein, einen eigenen Namen zu geben. Der war mit einem Stolz verbunden und vorstellbar auch für andere. Ein Wasserstiefelschuster etwa war ein geschätzter Spezialist, der Schuhwerk für Fischer und Kanalarbeiter herstellte: Jeder Handgriff musste sitzen, sonst drang das Wasser ein. Doch wer könnte sich heute sofort etwas vorstellen unter Berufen wie Mechatroniker oder gar Kommunikationsdesignerin, wenn er ihn nicht selbst ausübt? Wüsste, was nur sie können, welches Werkzeug sie verwenden, welches Produkt sie vertreten und vor allem, wo man diese Arbeiten ausübt? Eine Kommunikationsdesignerin, so erfährt man im Internet aus sogenannten Berufssteckbriefen, arbeite vorzugsweise in Büros und in Besprechungsräumen. Mehr, also eigentlich nichts, muss man wohl heute nicht mehr wissen.
In Rudi Pallas Lexikon der verschwundenen Arbeit aber entdecken wir nicht nur konkrete Menschen, die zu bestimmten Zeiten einer klar benannten Arbeit nachgingen und warum. Unter den einzelnen Stichworten wird der Leser zudem in ein Geflecht von Waren und ihren Wegen verwickelt, die Geschichte der Arbeit mit einer Mentalitätsgeschichte verknüpft. Der jetzt im Brandstätter Verlag erschienene Band ist eine aktualisierte Wiederauflage; wunderbar gestaltet, noch reicher und origineller illustriert. Er macht außerdem mit zahlreichen neuen Stichworten auf einen entschwundenen Reichtum auch unserer Alltagssprache aufmerksam.
REGINA MÖNCH.
Rudi Palla: "Verschwundene Arbeit". Verlag Christian Brandstätter, Wien 2014. 272 S., zahlr. Abb., geb., 35.- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main