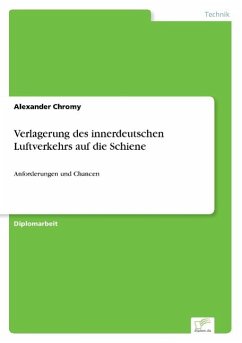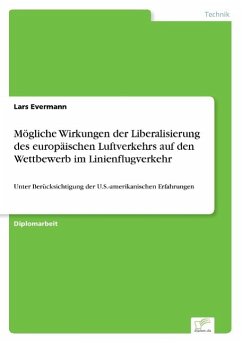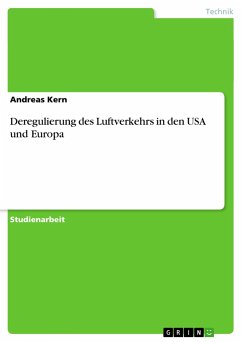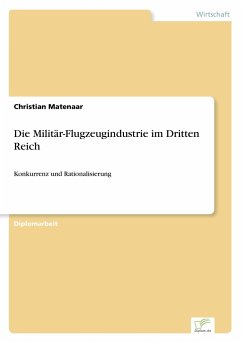Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Verkehrswissenschaft, Note: 1,0, Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft (Architektur und Bauwesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Zum Sommerfahrplan 1991 führte die Deutsche Bahn mit dem InterCityExpress (nachfolgend ICE genannt) den Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland ein. Auf den Neubaustrecken Mannheim Stuttgart und Hannover Würzburg erreichten die ICE-Züge erstmals eine Reisegeschwindigkeit von 280 km/h. Inzwischen sind diese Strecken Bestandteil eines Hochgeschwindigkeitsnetzes, das sowohl Neu- und Ausbaustrecken als auch Altstrecken des Bestandsnetzes umfasst, jedoch in den nächsten Jahren umfassend erweitert werden soll, wie zum Beispiel mit der Neubaustrecke Köln Rhein/Main ab August 2002. Weiterhin spielt das deutsche Hochgeschwindigkeitsnetz aufgrund der zentralen Lage des Landes eine Kernrolle im europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz.
Bei der Planung neuer ICE-Strecken wird zunehmend auch die Einbindung der Verkehrsflughäfen in das Fernverkehrsnetz der Bahn berücksichtigt. Vorreiter in Deutschland ist hier der Flughafen Frankfurt, der bereits 1972 einen S-Bahnhof erhielt und inzwischen mit dem 1999 eröffneten Fernbahnhof sehr gute Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen Schienen- und Luftverkehr eröffnet, zumal dieser Bahnhof direkt an die Neubaustrecke Köln Rhein/Main angeschlossen sein wird. Auch der Flughafen Düsseldorf erhielt im Mai 2000 mit dem Fernbahnhof Düsseldorf Flughafen einen hochwertigen direkten Anschluss an den Schienenfernverkehr.
Da in Zukunft weitere Flughäfen an die Bahn angeschlossen bzw. eine Verbesserung der derzeitigen Anbindung erfahren werden, wird es zunächst möglich sein, den derzeitigen Anteil des Schienenverkehrs bei der Anreise zum Flughafen erhöhen zu können. Dies ist insofern erforderlich, als dass das erwartete Wachstum des Luftverkehrs nicht nur die Terminalkapazitäten und die Start- und Landebahnsysteme zur Anpassung zwingen wird, sondern auch die landseitige Anbindung: eine wesentliche Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Luftverkehrssystems ist die zuverlässige und zeitlich kalkulierbare Erreichbarkeit [der Flughäfen; Anm. d. Verf.]. Wie in einem Fachartikel für das Beispiel Nordrhein-Westfalen dargestellt wird und auch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) ausgeführt hat, kann dieser zusätzliche Verkehr nicht nur durch den Straßenverkehr aufgenommen werden, da neben einer begrenzten Kapazität des Straßensystems auch Anwohnerbelange (Lärm- und Abgasbelastung) zu berücksichtigen sind. Eine Aufnahme des Wachstums im Anreiseverkehr durch die Bahn hat neben einer Entlastung im Straßensystem zwei weitere Vorteile: auch Mitarbeiter und Beschäftigte der Flughäfen können von einer Schienenanbindung profitieren, und dem im Modal Split zurückgehenden Straßenverkehr muss weniger Parkraum bereitgestellt werden.
Doch nicht nur der Anreiseverkehr, sondern auch die Verkehrsströme zwischen den Flughäfen können durch eine Vernetzung zwischen Luft- und Schienenverkehr auf die Bahn verlagert werden. Die Einbindung der Flughäfen in Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn eröffnet zusammen mit der Verkürzung der Reisezeiten neue Möglichkeiten, wirtschaftlich unrentable und besonders umweltschädigende Kurzstreckenflüge einzustellen und durch Züge zu ersetzen. Neben ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten sprechen dafür auch Kapazitätsprobleme der Flughäfen: Innerdeutscher Luftverkehr belegt die Kapazitäten, die für internationale Flüge nachgefragt werden.
Zwei verschiedene Flugverbindungs- arten gilt es bei einer Verlagerung innerdeutscher Flüge zu unterscheiden: In einer ersten Gruppe können Strecken zusammengefasst werden, die eine Zubringerfunktion zu den internationalen Flügen an den großen Drehkreuzflughäfen haben (in Deutschland vorrangig Frankfurt, aber auch München...
Zum Sommerfahrplan 1991 führte die Deutsche Bahn mit dem InterCityExpress (nachfolgend ICE genannt) den Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland ein. Auf den Neubaustrecken Mannheim Stuttgart und Hannover Würzburg erreichten die ICE-Züge erstmals eine Reisegeschwindigkeit von 280 km/h. Inzwischen sind diese Strecken Bestandteil eines Hochgeschwindigkeitsnetzes, das sowohl Neu- und Ausbaustrecken als auch Altstrecken des Bestandsnetzes umfasst, jedoch in den nächsten Jahren umfassend erweitert werden soll, wie zum Beispiel mit der Neubaustrecke Köln Rhein/Main ab August 2002. Weiterhin spielt das deutsche Hochgeschwindigkeitsnetz aufgrund der zentralen Lage des Landes eine Kernrolle im europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz.
Bei der Planung neuer ICE-Strecken wird zunehmend auch die Einbindung der Verkehrsflughäfen in das Fernverkehrsnetz der Bahn berücksichtigt. Vorreiter in Deutschland ist hier der Flughafen Frankfurt, der bereits 1972 einen S-Bahnhof erhielt und inzwischen mit dem 1999 eröffneten Fernbahnhof sehr gute Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen Schienen- und Luftverkehr eröffnet, zumal dieser Bahnhof direkt an die Neubaustrecke Köln Rhein/Main angeschlossen sein wird. Auch der Flughafen Düsseldorf erhielt im Mai 2000 mit dem Fernbahnhof Düsseldorf Flughafen einen hochwertigen direkten Anschluss an den Schienenfernverkehr.
Da in Zukunft weitere Flughäfen an die Bahn angeschlossen bzw. eine Verbesserung der derzeitigen Anbindung erfahren werden, wird es zunächst möglich sein, den derzeitigen Anteil des Schienenverkehrs bei der Anreise zum Flughafen erhöhen zu können. Dies ist insofern erforderlich, als dass das erwartete Wachstum des Luftverkehrs nicht nur die Terminalkapazitäten und die Start- und Landebahnsysteme zur Anpassung zwingen wird, sondern auch die landseitige Anbindung: eine wesentliche Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Luftverkehrssystems ist die zuverlässige und zeitlich kalkulierbare Erreichbarkeit [der Flughäfen; Anm. d. Verf.]. Wie in einem Fachartikel für das Beispiel Nordrhein-Westfalen dargestellt wird und auch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) ausgeführt hat, kann dieser zusätzliche Verkehr nicht nur durch den Straßenverkehr aufgenommen werden, da neben einer begrenzten Kapazität des Straßensystems auch Anwohnerbelange (Lärm- und Abgasbelastung) zu berücksichtigen sind. Eine Aufnahme des Wachstums im Anreiseverkehr durch die Bahn hat neben einer Entlastung im Straßensystem zwei weitere Vorteile: auch Mitarbeiter und Beschäftigte der Flughäfen können von einer Schienenanbindung profitieren, und dem im Modal Split zurückgehenden Straßenverkehr muss weniger Parkraum bereitgestellt werden.
Doch nicht nur der Anreiseverkehr, sondern auch die Verkehrsströme zwischen den Flughäfen können durch eine Vernetzung zwischen Luft- und Schienenverkehr auf die Bahn verlagert werden. Die Einbindung der Flughäfen in Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn eröffnet zusammen mit der Verkürzung der Reisezeiten neue Möglichkeiten, wirtschaftlich unrentable und besonders umweltschädigende Kurzstreckenflüge einzustellen und durch Züge zu ersetzen. Neben ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten sprechen dafür auch Kapazitätsprobleme der Flughäfen: Innerdeutscher Luftverkehr belegt die Kapazitäten, die für internationale Flüge nachgefragt werden.
Zwei verschiedene Flugverbindungs- arten gilt es bei einer Verlagerung innerdeutscher Flüge zu unterscheiden: In einer ersten Gruppe können Strecken zusammengefasst werden, die eine Zubringerfunktion zu den internationalen Flügen an den großen Drehkreuzflughäfen haben (in Deutschland vorrangig Frankfurt, aber auch München...