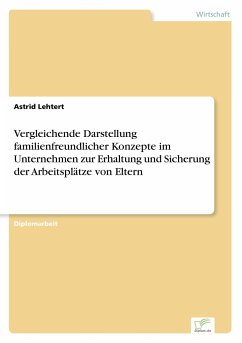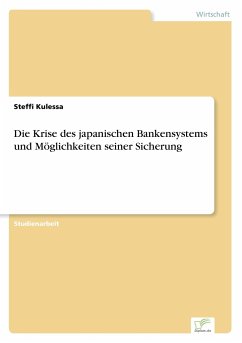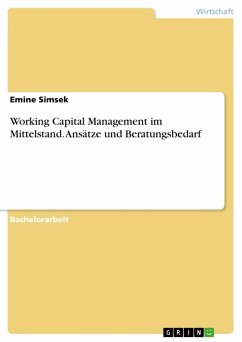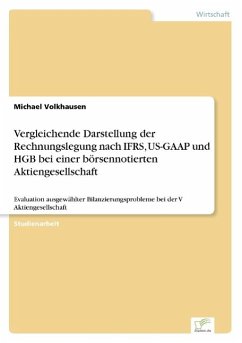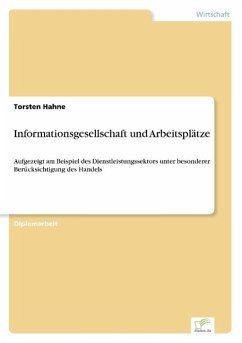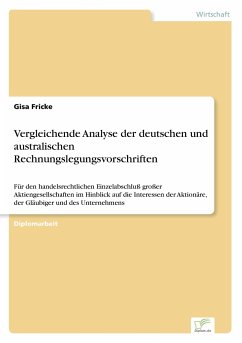Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Personal und Organisation, Note: 1,7, Rheinische Fachhochschule Köln (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Eines der großen gesellschaftlichen Themen ist die Frage, wie Familie und Arbeitswelt besser in Einklang gebracht werden können. Die moderne Arbeitswelt fordert von den Mitarbeitern Flexibilität und die Bereitschaft zu kurzfristigen Veränderungen. Diese Anforderungen sind oft nur schwer mit einer Familie zu vereinbaren. Jedoch stellt die Familie die nach wie vor meist geschätzte und gelebte Lebensform dar, so dass der Anspruch nach der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben immer größer wird. Die strikte Aufteilung, in der der Mann für die Versorgung der Familie und die Frau für die Haushaltsführung und Kindeserziehung zuständig gewesen ist, hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Es nehmen immer mehr Frauen am Erwerbsleben teil und tragen somit zum Lebensunterhalt der Familie bei.Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für familienfreundliche Arbeitskonzepte. Eltern soll mit Hilfe dieser die gemeinsame Bewältigung von Haushalt und Kindeserziehung neben ihrem Beruf ermöglicht werden.
In der Wirtschaft gibt es bereits eine Reihe positiver Beispiele zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Betriebe aller Größenordnungen und Branchen haben erkannt, dass sich familienfreundliche Arbeitsplätze auszahlen, da sie qualifizierte Arbeitskräfte an den Betrieb binden und die Motivation der Mitarbeiter erhöhen. Dies wiederum führt zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses.
Die Maßnahmenpalette zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist weit gefächert und reicht von personalstrategischen Überlegungen von familienbezogenen Arbeitszeitvarianten bis hin zur Schaffung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur. Kein Unternehmen kann jedoch alle diese Maßnahmen gleichzeitig realisieren. Es liegt an dem Unternehmen, die geeigneten Maßnahmen auszuwählen und mit Sorgfalt umzusetzen. Da es im Rahmen dieser Diplomarbeit jedoch nicht möglich ist auf jede dieser Varianten näher einzugehen, kann hier nur ein Überblick über die bekanntesten Maßnahmen gegeben werden.
Eine Aufteilung der Erziehungsaufgaben zwischen beiden Elternteilen ist bisher im deutschen Recht ziemlich schwierig gewesen. Beiden Elternteilen ist es nicht möglich gewesen, gemeinsam Erziehungsurlaub zu beanspruchen. Ein Wechsel ist grundsätzlich nur möglich gewesen, wenn er schon vor dem Beginn des Erziehungsurlaubes beantragt worden ist.
Der Gesetzgeber hat mit dem im Jahr 2001 in Kraft getretenen Teilzeitarbeitsgesetz einen Anfang gemacht, die Frauenerwerbsquote (Mai 2000: 43,5%) zu erhöhen. Werdende Eltern haben seit dem einen Rechtsanspruch auf Arbeitszeitverkürzung, sofern der Betrieb mehr als 15 Angestellte beschäftigt. Zudem haben sowohl verheiratete als auch unverheiratete Paare ein Anrecht auf gleichzeitige Inanspruchnahme der Elternzeit. Diese Entwicklung ist für Deutschland von hoher Bedeutung, denn im europäischen Vergleich zeichnet sich Deutschland durch einen extrem niedrigen Anteil von Familien mit zwei in Vollzeit beschäftigten Partnern aus. Beansprucht einer von beiden die Möglichkeit der Teilzeitarbeit, so ist es in der Regel die Frau.
Weiterhin besteht in Deutschland ein Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Versorgungsquote für Kleinkinder beträgt in Westdeutschland 3% und in Ostdeutschland 36%. Nur 6% der Schulkinder zwischen sechs und vierzehn Jahren können auf einen Hortplatz für den Nachmittag hoffen. Weniger als 5% der allgemein bildenden Schulen sind Ganztagsschulen. Allein für ausreichend Kindergartenplätze ist gesorgt, wobei hier die Betreuungszeiten meist nur bis zum Mittag gehen.
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes hat die Versorgungsquote der Drei- bis Sechsjährigen mit Kindergartenplätzen Ende des Jahres 1998 ...
Eines der großen gesellschaftlichen Themen ist die Frage, wie Familie und Arbeitswelt besser in Einklang gebracht werden können. Die moderne Arbeitswelt fordert von den Mitarbeitern Flexibilität und die Bereitschaft zu kurzfristigen Veränderungen. Diese Anforderungen sind oft nur schwer mit einer Familie zu vereinbaren. Jedoch stellt die Familie die nach wie vor meist geschätzte und gelebte Lebensform dar, so dass der Anspruch nach der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben immer größer wird. Die strikte Aufteilung, in der der Mann für die Versorgung der Familie und die Frau für die Haushaltsführung und Kindeserziehung zuständig gewesen ist, hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Es nehmen immer mehr Frauen am Erwerbsleben teil und tragen somit zum Lebensunterhalt der Familie bei.Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für familienfreundliche Arbeitskonzepte. Eltern soll mit Hilfe dieser die gemeinsame Bewältigung von Haushalt und Kindeserziehung neben ihrem Beruf ermöglicht werden.
In der Wirtschaft gibt es bereits eine Reihe positiver Beispiele zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Betriebe aller Größenordnungen und Branchen haben erkannt, dass sich familienfreundliche Arbeitsplätze auszahlen, da sie qualifizierte Arbeitskräfte an den Betrieb binden und die Motivation der Mitarbeiter erhöhen. Dies wiederum führt zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses.
Die Maßnahmenpalette zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist weit gefächert und reicht von personalstrategischen Überlegungen von familienbezogenen Arbeitszeitvarianten bis hin zur Schaffung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur. Kein Unternehmen kann jedoch alle diese Maßnahmen gleichzeitig realisieren. Es liegt an dem Unternehmen, die geeigneten Maßnahmen auszuwählen und mit Sorgfalt umzusetzen. Da es im Rahmen dieser Diplomarbeit jedoch nicht möglich ist auf jede dieser Varianten näher einzugehen, kann hier nur ein Überblick über die bekanntesten Maßnahmen gegeben werden.
Eine Aufteilung der Erziehungsaufgaben zwischen beiden Elternteilen ist bisher im deutschen Recht ziemlich schwierig gewesen. Beiden Elternteilen ist es nicht möglich gewesen, gemeinsam Erziehungsurlaub zu beanspruchen. Ein Wechsel ist grundsätzlich nur möglich gewesen, wenn er schon vor dem Beginn des Erziehungsurlaubes beantragt worden ist.
Der Gesetzgeber hat mit dem im Jahr 2001 in Kraft getretenen Teilzeitarbeitsgesetz einen Anfang gemacht, die Frauenerwerbsquote (Mai 2000: 43,5%) zu erhöhen. Werdende Eltern haben seit dem einen Rechtsanspruch auf Arbeitszeitverkürzung, sofern der Betrieb mehr als 15 Angestellte beschäftigt. Zudem haben sowohl verheiratete als auch unverheiratete Paare ein Anrecht auf gleichzeitige Inanspruchnahme der Elternzeit. Diese Entwicklung ist für Deutschland von hoher Bedeutung, denn im europäischen Vergleich zeichnet sich Deutschland durch einen extrem niedrigen Anteil von Familien mit zwei in Vollzeit beschäftigten Partnern aus. Beansprucht einer von beiden die Möglichkeit der Teilzeitarbeit, so ist es in der Regel die Frau.
Weiterhin besteht in Deutschland ein Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Versorgungsquote für Kleinkinder beträgt in Westdeutschland 3% und in Ostdeutschland 36%. Nur 6% der Schulkinder zwischen sechs und vierzehn Jahren können auf einen Hortplatz für den Nachmittag hoffen. Weniger als 5% der allgemein bildenden Schulen sind Ganztagsschulen. Allein für ausreichend Kindergartenplätze ist gesorgt, wobei hier die Betreuungszeiten meist nur bis zum Mittag gehen.
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes hat die Versorgungsquote der Drei- bis Sechsjährigen mit Kindergartenplätzen Ende des Jahres 1998 ...