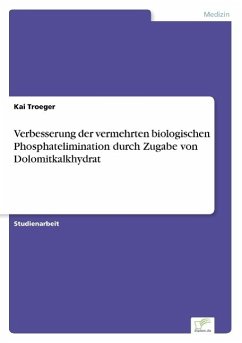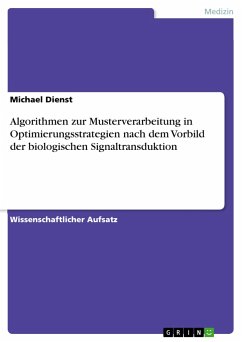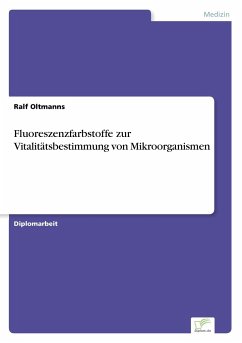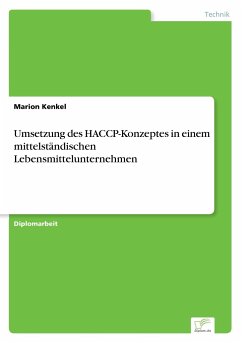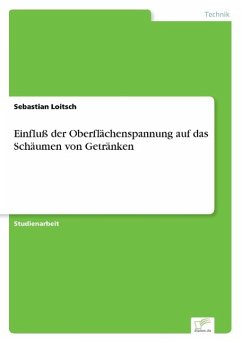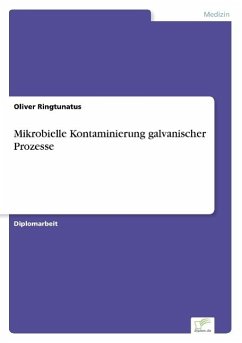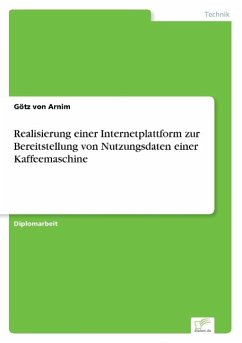Studienarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Medizin - Biomedizinische Technik, Note: 1,3, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (Siedlungswasserwirtschaft, Technische Chemie), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Anforderungen und das Verständnis um die Erhaltung der Natur und ihrer Ressourcen steigen ständig. Es wurde erkannt, dass die industrielle Entwicklung und unsere damit entstandene Zivilisation die Natur stark beanspruchen. Den Menschen, besonders in den Industrienationen, ist dieses Naturverständnis leider weitestgehend verloren gegangen. Umso größer sind damit die Ansprüche, die an die Abwasserreinigung gestellt werden: Allein der Phosphoreintrag in das Oberflächengewässer in der BRD stammt zu 75% aus den kommunalen und industriellen Kläranlagen. Somit ist die Verminderung der Phosphorbelastung aus dieser Belastungsquelle von hoher Priorität.
Da infolge der Einführung von Mindestanforderungen für BSB (1979), N und P (1992) die Investitions- und Betriebskosten stark gestiegen sind, wächst das Interesse an kostengünstigen und effektiven Verfahren stetig. Biologische Reinigungsverfahren erwiesen sich in ihrer Eliminationsleistung schon immer als sehr effektiv. Allerdings benötigen sie möglichst konstante Randbedingungen (u.a. Temperatur, Zulaufkonzentrationen).
Hierbei kommt der biologischen Phosphorelimination in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung zu, was sich an den zahlreichen Forschungsarbeiten und der steigenden Anzahl an Kläranlagen, die dieses Verfahren bereits erfolgreich einsetzen, deutlich wiederspiegelt.
Das Forschungszentrum Karlsruhe besitzt eine biologische Kläranlage, die nach dem Prinzip der vorgeschalteten Denitrifikation mit zusätzlicher Simultanfällung betrieben wird. Seit der Planung der Anlage hat sich die Mitarbeiterzahl und somit die Abwassermenge um ca. die Hälfte reduziert, wodurch die Belastung von 3000 EWG auf 1000 EWG gesunken ist. Aufgrund der Tatsache, dass die Kläranlage in einen
kleinen Vorfluter einleitet, orientieren sich die Einleit-Grenzwerte der wasser-rechtlichen Genehmigung an den Anforderungen für Kläranlagen der Größenklasse 4 mit Grenzwerten für NO3-N von 18 mg/L und für Pges von 3 mg/L.
Das Abwasser hat im Vergleich zu üblichem kommunalen Abwasser eine sehr hohe Stickstoffkonzentration (80 - 100 mg/L N) mit hohen Ammoniumspitzen zur Zeit der größten hydraulischen Belastung [Ansbach, 1997]. Aufgrund des dadurch resultierenden ungünstigen BSB5/N-Verhältnisses wird seit Neuestem zur weitergehenden N-Elimination Kantinenabfall extern dosiert. Durch diese Dosierung der externen
C-Quelle und bei geringen Anlagenbelastung herrschen günstige Bedingungen für eine Bio-P.
Bereits seit längerer Zeit wird über Simultanfällung die Einhaltung des P-Grenzwertes garantiert. Da im Laufe des Betriebes die Fällmittelmengen bei konstanter P-Fracht im Zulauf zurück gingen, lag die Vermutung nahe, dass sich bereits eine Bio-P in der Betriebskläranlage eingestellt hat. Die grundsätzliche Möglichkeit, Phosphor durch eine Bio-P auf der Betriebskläranlage zu eliminieren, wurde mit einer Laborklär-anlage bereits erfolgreich getestet.
Auch in der Literatur wird beschrieben, dass bei schwach belasteten Anlagen ohne Anaerobbecken und bei ausreichender Nährstoffversorgung eine Bio-P erzielt werden kann. Durch den Einsatz von Kalk kann hierbei die Eliminationsleistung stabilisiert und die Schlammstruktur, die häufig v.a. bei Bio-P-Anlagen Probleme bereitet, verbessert werden.
In der vorliegenden Arbeit sollten in einer Laborkläranlage eine Bio-P, wie schon in vorrangegangenen Untersuchungen, aufgebaut und die Eliminationsleistung durch die Zugabe von externen C-Quellen und Dolomitkalkhydrat optimiert werden, wobei die Betriebskläranlage wieder mit der Laborkläranlage simuliert werden sollte. Als Erstes sollte wiederum versucht werden, ...
Die Anforderungen und das Verständnis um die Erhaltung der Natur und ihrer Ressourcen steigen ständig. Es wurde erkannt, dass die industrielle Entwicklung und unsere damit entstandene Zivilisation die Natur stark beanspruchen. Den Menschen, besonders in den Industrienationen, ist dieses Naturverständnis leider weitestgehend verloren gegangen. Umso größer sind damit die Ansprüche, die an die Abwasserreinigung gestellt werden: Allein der Phosphoreintrag in das Oberflächengewässer in der BRD stammt zu 75% aus den kommunalen und industriellen Kläranlagen. Somit ist die Verminderung der Phosphorbelastung aus dieser Belastungsquelle von hoher Priorität.
Da infolge der Einführung von Mindestanforderungen für BSB (1979), N und P (1992) die Investitions- und Betriebskosten stark gestiegen sind, wächst das Interesse an kostengünstigen und effektiven Verfahren stetig. Biologische Reinigungsverfahren erwiesen sich in ihrer Eliminationsleistung schon immer als sehr effektiv. Allerdings benötigen sie möglichst konstante Randbedingungen (u.a. Temperatur, Zulaufkonzentrationen).
Hierbei kommt der biologischen Phosphorelimination in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung zu, was sich an den zahlreichen Forschungsarbeiten und der steigenden Anzahl an Kläranlagen, die dieses Verfahren bereits erfolgreich einsetzen, deutlich wiederspiegelt.
Das Forschungszentrum Karlsruhe besitzt eine biologische Kläranlage, die nach dem Prinzip der vorgeschalteten Denitrifikation mit zusätzlicher Simultanfällung betrieben wird. Seit der Planung der Anlage hat sich die Mitarbeiterzahl und somit die Abwassermenge um ca. die Hälfte reduziert, wodurch die Belastung von 3000 EWG auf 1000 EWG gesunken ist. Aufgrund der Tatsache, dass die Kläranlage in einen
kleinen Vorfluter einleitet, orientieren sich die Einleit-Grenzwerte der wasser-rechtlichen Genehmigung an den Anforderungen für Kläranlagen der Größenklasse 4 mit Grenzwerten für NO3-N von 18 mg/L und für Pges von 3 mg/L.
Das Abwasser hat im Vergleich zu üblichem kommunalen Abwasser eine sehr hohe Stickstoffkonzentration (80 - 100 mg/L N) mit hohen Ammoniumspitzen zur Zeit der größten hydraulischen Belastung [Ansbach, 1997]. Aufgrund des dadurch resultierenden ungünstigen BSB5/N-Verhältnisses wird seit Neuestem zur weitergehenden N-Elimination Kantinenabfall extern dosiert. Durch diese Dosierung der externen
C-Quelle und bei geringen Anlagenbelastung herrschen günstige Bedingungen für eine Bio-P.
Bereits seit längerer Zeit wird über Simultanfällung die Einhaltung des P-Grenzwertes garantiert. Da im Laufe des Betriebes die Fällmittelmengen bei konstanter P-Fracht im Zulauf zurück gingen, lag die Vermutung nahe, dass sich bereits eine Bio-P in der Betriebskläranlage eingestellt hat. Die grundsätzliche Möglichkeit, Phosphor durch eine Bio-P auf der Betriebskläranlage zu eliminieren, wurde mit einer Laborklär-anlage bereits erfolgreich getestet.
Auch in der Literatur wird beschrieben, dass bei schwach belasteten Anlagen ohne Anaerobbecken und bei ausreichender Nährstoffversorgung eine Bio-P erzielt werden kann. Durch den Einsatz von Kalk kann hierbei die Eliminationsleistung stabilisiert und die Schlammstruktur, die häufig v.a. bei Bio-P-Anlagen Probleme bereitet, verbessert werden.
In der vorliegenden Arbeit sollten in einer Laborkläranlage eine Bio-P, wie schon in vorrangegangenen Untersuchungen, aufgebaut und die Eliminationsleistung durch die Zugabe von externen C-Quellen und Dolomitkalkhydrat optimiert werden, wobei die Betriebskläranlage wieder mit der Laborkläranlage simuliert werden sollte. Als Erstes sollte wiederum versucht werden, ...