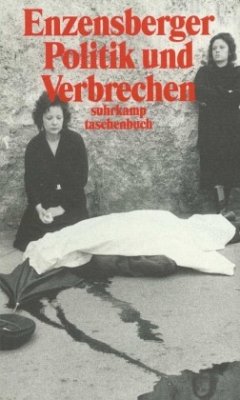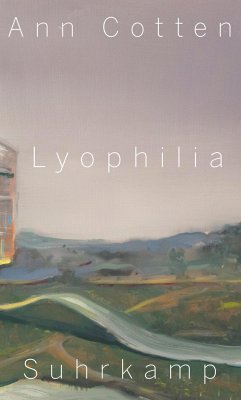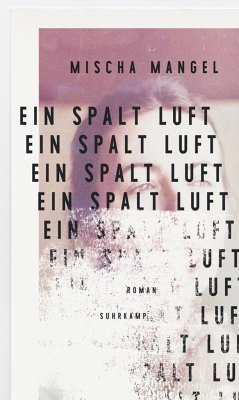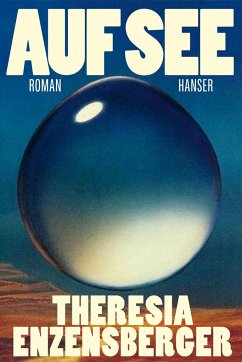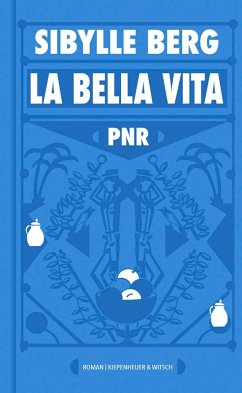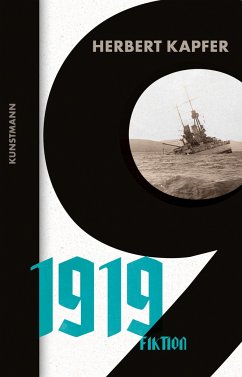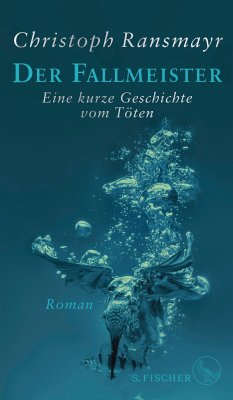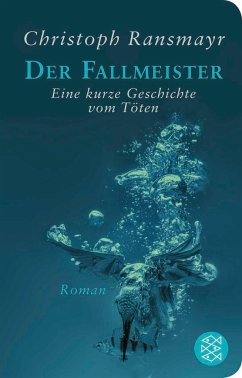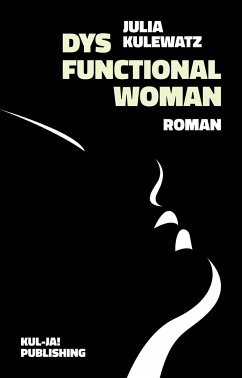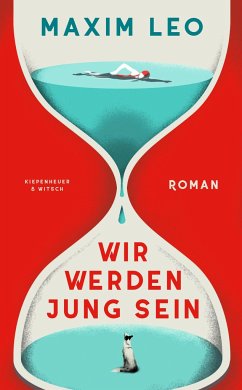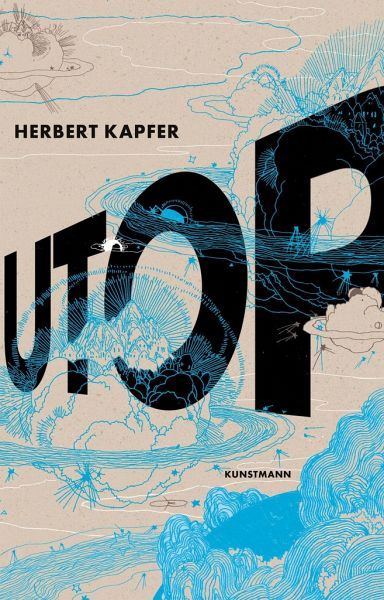
UTOP

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Utopisches dringt in dargestellte Wirklichkeiten, zerdehnt und sprengt geschichtliche Rahmen. In UTOP verweben sich in drei Teilen - Siedler, Jünger und Geister - Erzählungen, Episoden und Szenarien von Arbeiterrevolten, Vorkriegs-Bohème und Geschlechterkampf, Sekten- und Siedlungsgründungen, Bodenreform und sozialrevolutionären Experimenten, von der Züchtung primitiver Arbeitsgeschöpfe, gigantischen Raumflottengefechten und der innigen Begegnung eines terrestrischen Raketenoffiziers mit einer friedliebenden Marsitin.Auf einem Utopistenkongress mit den großen Geistern aller Völker und...
Utopisches dringt in dargestellte Wirklichkeiten, zerdehnt und sprengt geschichtliche Rahmen. In UTOP verweben sich in drei Teilen - Siedler, Jünger und Geister - Erzählungen, Episoden und Szenarien von Arbeiterrevolten, Vorkriegs-Bohème und Geschlechterkampf, Sekten- und Siedlungsgründungen, Bodenreform und sozialrevolutionären Experimenten, von der Züchtung primitiver Arbeitsgeschöpfe, gigantischen Raumflottengefechten und der innigen Begegnung eines terrestrischen Raketenoffiziers mit einer friedliebenden Marsitin.Auf einem Utopistenkongress mit den großen Geistern aller Völker und Epochen, ergreifen u.a. Hannah Arendt, Ernst Bloch, Donatella Di Cesare, Charles Fourier, Thomas More, Simone Weil und die Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung das Wort. Und im Haus der Intelligenz entbrennt ein Streit über die biologische Unsterblichkeit. UTOP ist ein Roman mit Zeitluken in die Gegenwart, dessen Handlung von zahlreichen Stimmen überliefert wird.