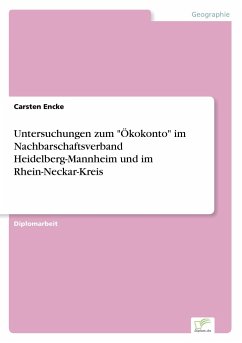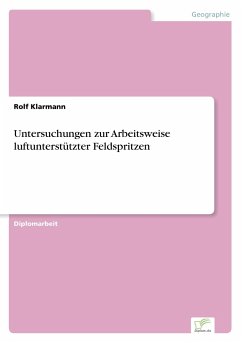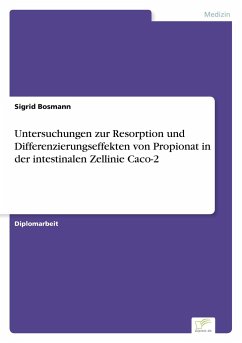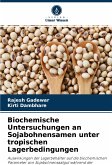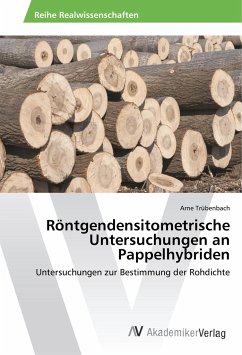Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz, Note: 2,1, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Chemie und Geowissenschaften, Geographisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, Entwicklungschancen und der Umsetzung des sog. Ökokontos und möchte dieses Thema anhand von konkreten Beispielen, Erhebungen und Analysen v.a. für einen praktischen Zugang ausleuchten.
Seit Bestehen der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sollte gewährleistet sein, dass Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. Am Ort des Eingriffes oder in unmittelbarer Nähe sollten auf Dauer Maßnahmen zur Förderung ökologischer Strukturen stattfinden.
Die Realität hat gezeigt, dass diesen Anforderungen selten in vollem Umfang entsprochen wurde. Pflanzgebote in Privatgärten von Neubaugebieten und ähnliches konnten nicht den erwünschten Effekt bringen. Ein Grundsatzproblem bei der Umsetzung der Eingriffsregelung war der stückwerkhafte Charakter der naturverbessernden Maßnahmen. Häufig werden kleine Ecken oder Ränder an Baugebieten in irgendeiner Weise begrünt oder es werden mit viel Aufwand Dächer bepflanzt und kleine Tümpel angelegt oder ähnliches. Es gibt zudem immer einen sog. time-lag-Effekt, denn vom Eingriffszeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt, an dem durch Kompensationsmaßnahmen Natur und Landschaft wieder hergestellt sein soll, vergeht eine mitunter sehr lange Zeit, in der wichtige Funktionen des Naturhaushaltes nicht vorhanden sind.
Im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes ist dies alles nicht sonderlich effektiv, und so richtet sich seit ein paar Jahren große Aufmerksamkeit auf das sog. Ökokonto .
Das kommunale Ökokonto ist ein Instrument des modernen Flächenmanagement, welches einen vorsorgenden Ausgleich an anderer Stelle ermöglichen soll (Flächenbevorratung bzw. Maßnahmenbevorratung), um all die negativen Effekte der herkömmlichen Ausgleichspraxis zu dämpfen.
Gang der Untersuchung:
Zunächst wurden allgemeine Fragen zum Themenkomplex Flächenverbrauch Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung Ökokonto behandelt.
Dann folgten Kapitel zu den für die hier untersuchten Kommunen wichtigen Akteure Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg und Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim .
Anhand von konkreten Projekten im Bereich des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim wurde auf Ausgleichsmaßnahmen und deren Eignung für die Konzeption des Ökokontos eingegangen.
Mittels einer schriftlichen Befragung (Fragebögen mit 22 bzw. 25 Fragen) der Städte und Gemeinden der gesamten Rhein-Neckar-Region (56 Gemeinden) konnte schließlich untersucht werden, wie die Umsetzung in der Praxis aussieht.
Angesichts der Tatsache, dass mittlerweile allerhand Schriften und theoretische Abhandlungen zu diesen Themen existieren, wurde es als sehr wichtig angesehen, über praktische Erfahrungen, Sichtweisen und Anregungen der betroffenen Gemeinden vor Ort zu erfahren. Gemeinden mit und ohne Ökokonto wurden gleichermaßen befragt. Von den 56 Fragebögen waren 45 ausgefüllt und auswertbar.
Die gestellten Fragen zielten z.B. auf die praktische Handhabung des Ökokontos, die Thematik / Problematik der Bewertungsverfahren oder die Art möglicher aufwertungsgeeigneter Flächen/Maßnahmen, usw.
Bei den Gemeinden, die über kein oder noch kein Ökokonto verfügten, galten die Fragen v.a. den Perspektiven und diesbezüglichen Plänen.
Abgesehen von der schriftlichen Befragung fanden mit einigen Gemeindevertretern persönliche Gespräche statt, was zusätzliche Eindrücke und Einblicke ermöglicht hat.
Die Auswertungsergebnisse wurden in entsprechenden Schaubildern und Diagrammen veranschaulicht.
Sowohl die konkreten Beispiele, als auch die Ergebnisse der Umfrage und der Gespräche waren...
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, Entwicklungschancen und der Umsetzung des sog. Ökokontos und möchte dieses Thema anhand von konkreten Beispielen, Erhebungen und Analysen v.a. für einen praktischen Zugang ausleuchten.
Seit Bestehen der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sollte gewährleistet sein, dass Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. Am Ort des Eingriffes oder in unmittelbarer Nähe sollten auf Dauer Maßnahmen zur Förderung ökologischer Strukturen stattfinden.
Die Realität hat gezeigt, dass diesen Anforderungen selten in vollem Umfang entsprochen wurde. Pflanzgebote in Privatgärten von Neubaugebieten und ähnliches konnten nicht den erwünschten Effekt bringen. Ein Grundsatzproblem bei der Umsetzung der Eingriffsregelung war der stückwerkhafte Charakter der naturverbessernden Maßnahmen. Häufig werden kleine Ecken oder Ränder an Baugebieten in irgendeiner Weise begrünt oder es werden mit viel Aufwand Dächer bepflanzt und kleine Tümpel angelegt oder ähnliches. Es gibt zudem immer einen sog. time-lag-Effekt, denn vom Eingriffszeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt, an dem durch Kompensationsmaßnahmen Natur und Landschaft wieder hergestellt sein soll, vergeht eine mitunter sehr lange Zeit, in der wichtige Funktionen des Naturhaushaltes nicht vorhanden sind.
Im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes ist dies alles nicht sonderlich effektiv, und so richtet sich seit ein paar Jahren große Aufmerksamkeit auf das sog. Ökokonto .
Das kommunale Ökokonto ist ein Instrument des modernen Flächenmanagement, welches einen vorsorgenden Ausgleich an anderer Stelle ermöglichen soll (Flächenbevorratung bzw. Maßnahmenbevorratung), um all die negativen Effekte der herkömmlichen Ausgleichspraxis zu dämpfen.
Gang der Untersuchung:
Zunächst wurden allgemeine Fragen zum Themenkomplex Flächenverbrauch Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung Ökokonto behandelt.
Dann folgten Kapitel zu den für die hier untersuchten Kommunen wichtigen Akteure Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg und Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim .
Anhand von konkreten Projekten im Bereich des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim wurde auf Ausgleichsmaßnahmen und deren Eignung für die Konzeption des Ökokontos eingegangen.
Mittels einer schriftlichen Befragung (Fragebögen mit 22 bzw. 25 Fragen) der Städte und Gemeinden der gesamten Rhein-Neckar-Region (56 Gemeinden) konnte schließlich untersucht werden, wie die Umsetzung in der Praxis aussieht.
Angesichts der Tatsache, dass mittlerweile allerhand Schriften und theoretische Abhandlungen zu diesen Themen existieren, wurde es als sehr wichtig angesehen, über praktische Erfahrungen, Sichtweisen und Anregungen der betroffenen Gemeinden vor Ort zu erfahren. Gemeinden mit und ohne Ökokonto wurden gleichermaßen befragt. Von den 56 Fragebögen waren 45 ausgefüllt und auswertbar.
Die gestellten Fragen zielten z.B. auf die praktische Handhabung des Ökokontos, die Thematik / Problematik der Bewertungsverfahren oder die Art möglicher aufwertungsgeeigneter Flächen/Maßnahmen, usw.
Bei den Gemeinden, die über kein oder noch kein Ökokonto verfügten, galten die Fragen v.a. den Perspektiven und diesbezüglichen Plänen.
Abgesehen von der schriftlichen Befragung fanden mit einigen Gemeindevertretern persönliche Gespräche statt, was zusätzliche Eindrücke und Einblicke ermöglicht hat.
Die Auswertungsergebnisse wurden in entsprechenden Schaubildern und Diagrammen veranschaulicht.
Sowohl die konkreten Beispiele, als auch die Ergebnisse der Umfrage und der Gespräche waren...