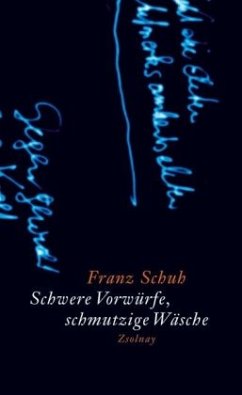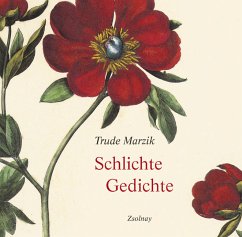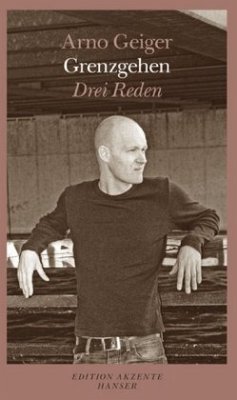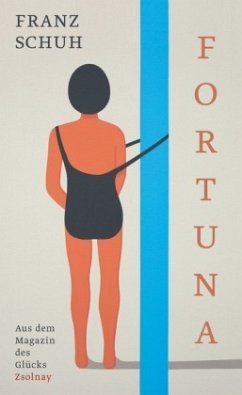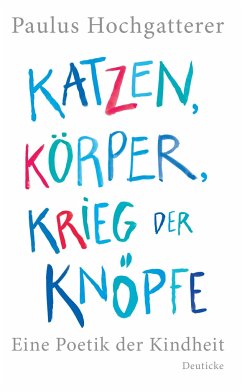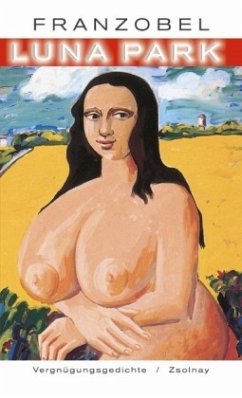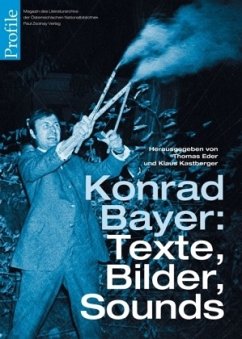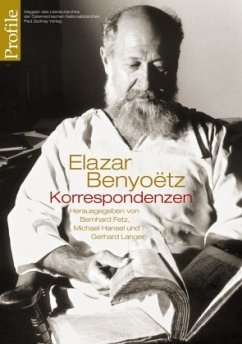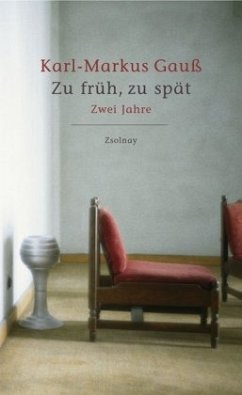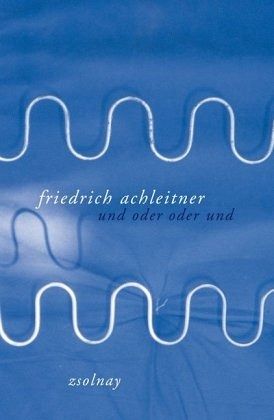
und oder oder und
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
14,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Geschichten von einarmigen Banditen in Secondhandläden, von Eulen in Athen, weißen Kannibalen im Innviertel und dem Justemilieu der heimischen Architekturszene: Auch in Friedrich Achleitners neuem Buch wird, wie es ein Kritiker treffend formulierte, "mit minimalem Aufwand maximale Wirkung erzielt". Wie ein Akrobat steigt der Autor, einst Mitglied der legendären Wiener Gruppe um H. C. Artmann und Konrad Bayer, auf das Drahtseil und vollführt in seinen Prosaminiaturen Gedankenkapriolen voller Witz und absurdem Humor.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.