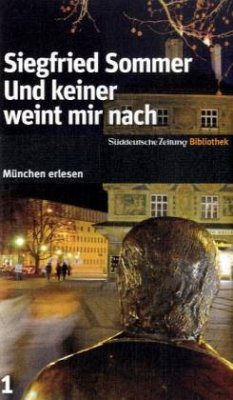Siegfried Sommer: „Und keiner weint mir nach”
Ein jeder richtiger Münchner hat brav die Kolumnen von „Blasius dem Spaziergänger” gelesen und deshalb eine ziemlich präzise Vorstellung, wie Sigi Sommers Kindheit verlaufen sein muss: Die Buben haben im Hinterhof mit Schussern gespielt, den Altvorderen das abendliche Bier von der Gassenschenke geholt und außer dem spanischen Rohr des Herrn Lehrer eigentlich nichts gefürchtet auf der Welt. Mädchen konnte man an den Zöpfen ziehen. Später reizten sie mit Kussmund und heranwachsenden Brüsten zu noch schöneren Spielen. Sonnige Kindheit, Wonnen der Vorstadtjugend. Oder so ähnlich. Über diese Kindheit, diese Irrungen und Wirrungen der Pubertät, hat Sigi Sommer auch seinen Erstlingsroman geschrieben: „Und keiner weint mir nach”. Ein Erfolgsbuch, das verfilmt und in viele Sprachen übersetzt wurde.
Die heutige Lektüre rückt die etwas entglittene Erinnerung wieder zurecht. Das Buch ist ganz anders. Hart, herb und schonungslos – und wahrscheinlich gerade deshalb das beste Stück Literatur von Sigi Sommer. Bert Brecht nannte diesen Roman den besten der Nachkriegszeit.
Der Knie Leo, der Rupp Bubi, der Leer Biwi und die anderen Früchterl aus dem Altbau Mondstraße 46 spielen zwar im Hinterhof und in den Isarauen, aber wenn einem Buben beim Spielen das Auge ausgeschossen wird, dann hat das nichts von lieblicher Kindheit. Das Kleinbürgermilieu wird auch nicht verklärt, sondern als „Wirsching-Mief und Rindsfettgeranzel” geschildert, geprägt durch erstaunliche Niedertracht in öden Ehen und zwischen missgünstigen Nachbarn.
Am allerschlimmsten aber steht es um die Liebe. Marilli Kosemund, das schöne rothaarige Mädchen, das sich zum Flitscherl mausert, will den enttäuschten Leo mit milden Geldgaben entschädigen. Mit diesem Geld versucht er's bei Nutten, aber die wollen „kein Kind” als Kundschaft. „Nicht einmal eine Hure hat mich mögen. Nicht einmal für Geld.”
Da lernen wir die ganze Verletzlichkeit der vermeintlichen Vorstadtstenzen kennen. Leo fantasiert sich in verschiedene Rollen, um Eindruck zu schinden, weiß aber nicht, wie er selber ist. „Mein Gott, er war ja noch gar keiner. Nein, ein Halber war er. Ach nein, nicht einmal ein Halber war er ganz.” In der kalten Gewissheit, dass ihm keiner nachweinen wird, nimmt er die tödliche Dosis von Tabletten seiner Oma. Bubi verschmort als Panzerschütze, Biwi stirbt beim Afrikafeldzug an Typhus. Eine betrogene Generation. Die einzigen politischen Zeilen des Buches erzählen, wie Vater Rupp, der brave Beamte, nach der Todesnachricht „vom Feld der Ehre” zum Hitler-Foto an der Wand hinaufzischt: „Du dreckiger Hund, du Hund, du Hund, du Hund!”
Brecht hatte schon recht mit seinem Lob. Der Roman bietet keine umfassende Stadtansicht (die hat uns der Spaziergänger und Hinterhofpoet später in einfühlsamen und kenntnisreichen, wenn auch oft beschönigenden Miniaturen beschert), aber authentische Porträts einer bösen alten Zeit. CHRISTIAN UDE
Siegfried Sommer Foto: K. Huhle/SZ Photo
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
»Sommers Buch rührt; es rührt, weil es ein seltsam reines Buch ist.« WOLFGANG KOEPPEN