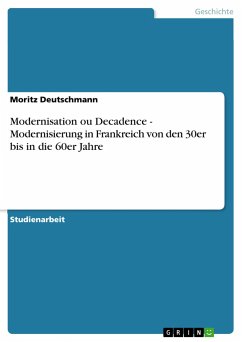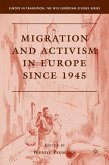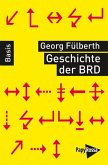"Das ganze Land soll 'umgekrempelt' werden" - Mit diesen Worten betitelte die Tageszeitung "Die Welt" im Mai 1968 die Pläne zum Gutachten der Sachverständigenkommission des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie sich nur wenige Jahre nach Abschluss der Gebietsreform im Jahre 1975 herausstellte, veränderte sich in der Tat die kommunale Landkarte durch die Zusammenlegung von Städten und Gemeinden von Grund auf. Ausgehend von den Ursachen und Motiven der Reform, welche insbesondere auf eine Leistungsfähigkeit der Verwaltung abzielten, stellt der Autor systematisch den Reformprozess in 'umgekrempelten' Kommunen anhand von sechs Fallbeispielen aus der Region Ostwestfalen-Lippe dar. Hatte dabei die örtliche Politik sowie die Bevölkerung ein Mitspracherecht oder wurde die Reform im Düsseldorfer Landtag 'von oben' entschieden? Kritisch hinterfragt der Autor zudem die Auswirkungen der Reform, etwa inwieweit heute bei der Bevölkerung eine neue Identität in den neu gegründeten Kommunen entstanden ist.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Reiner Burger liest David Merschjohanns Regionalstudie über die kommunale Gebietsreform in Ostwestfalen-Lippe mit Gewinn. Merschjohanns Arbeit mit den Fall-Kommunen Höxter, Detmold, Hille, Preußisch Oldendorf, Paderborn und Warburg eröffnet Burger Einsichten in die Zusammenhänge kommunaler Selbstverwaltung und politischer Partizipation. Wenn der Autor mit Bourdieu die Bedeutung politischer Perönlichkeiten in den Kommunen erörtert, staunt Burger über die Modernität und Multiperspektivität der Studie.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Eine sorgfältige Regionalstudie zur kommunalen Gebietsreform am Beispiel Ostwestfalen-Lippe
Der Historiker Edgar Wolfrum hat in seinem Buch "Die geglückte Demokratie" die Phase von 1959/60 bis 1973 als Zeit der "Dynamik und Liberalisierung" beschrieben. Denn in diesen "langen sechziger Jahren" fand in der Bundesrepublik Deutschland ein tiefgreifender Wandel überkommener Werte und Lebensstile statt, es kam zur inneren Demokratisierung. Weitgehend ungebrochen waren der Zukunftsoptimismus und der Glaube an wissenschaftsbasierte Entscheidungen. Politikern galt es deshalb geradezu als geboten, Fortschritt administrativ "von oben" zu planen. Das sollte auch für die kommunalen Verwaltungsstrukturen gelten. Im kollektiven Gedächtnis nicht nur der Verwaltung selbst, sondern auch der Bevölkerung gilt die Gebietsreform bis heute als die Verwaltungsreform schlechthin.
Für Nordrhein-Westfalen erklärt sich das schon aus dem Umstand, dass die Neuformierung von Ministerpräsident Heinz Kühn (SPD) und seinem Innenminister Willi Weyer (FDP) im Ländervergleich besonders konsequent vorangetrieben wurde. Hatte das bevölkerungsreichste Bundesland 1966 noch 2355 Gemeinden - wobei in 1901 weniger als 5000 Einwohner lebten -, sind es seit Abschluss der Reform Mitte der Siebzigerjahre nur noch 396. Auch die Landkreise (in Nordrhein-Westfalen heißen sie heute kurz "Kreise") wurden neu zugeschnitten, aus ursprünglich 57 wurden 31. Durch die Gebietsreform bekam das 1946 von den britischen Besatzern gegründete Bundesland seine heutige innere Gestalt.
Dass die damit verbundenen tiefgreifenden Veränderungen mitunter zu heftigem lokalen Widerstand führten, ist kein Wunder. Landesweit wahrnehmbar artikulierte er sich vor allem im Ruhrgebiet und dort ganz besonders in Wattenscheid, wo man sich dagegen wehrte, Bochum zugeschlagen zu werden. Angeführt vom Textilunternehmer Klaus Steilmann gelang es dem Wattenscheider "Aktion Bürgerwille e.V.", das erste Volksbegehren in der Geschichte Nordrhein-Westfalens zu initiieren. Es zielte darauf, die Gebietsreform komplett zu kippen. Dass das Volksbegehren dann recht deutlich am Unterschriftenquorum scheiterte, verweist jedoch darauf, dass das Vorhaben (für das die sozialliberale Regierung von Beginn an die Unterstützung der oppositionellen CDU hatte) den Bürgern in anderen Landesteilen weitgehend einleuchtete. Auch vor Gericht hatte die Reform mit einigen wenigen Ausnahmen Bestand. Von den mehr als hundert Klagen, die Gemeinden, Städte und Kreise zwischen 1968 und 1978 beim nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof in Münster gegen die diversen Neuordnungsgesetze einreichten, waren nur fünf erfolgreich. Im sogenannten Nikolaus-Urteil vom 6. Dezember 1975 erhielten unter anderem Wesseling (das zu Köln gekommen war), Monheim (ursprünglich zu Düsseldorf) und Gladbeck (das Bottrop zugeschlagen worden war) ihre Selbständigkeit zurück.
Gerade im ländlichen Raum war die Reform unumgänglich, weil viele kleinere Gemeinden ohne hauptamtliche Verwaltungsbeamte auskommen mussten und also eine moderne, den wachsenden Ansprüchen der Bürger gerecht werdende Administration nicht möglich war. David Merschjohann untersucht in seiner Paderborner Dissertation Aspekte der kommunalen Gebietsreform in Ostwestfalen-Lippe anhand der Beispiele Höxter, Detmold, Hille, Preußisch Oldendorf, Paderborn und Warburg. Bescheiden formuliert der Autor den Anspruch, er wolle dazu beitragen, Lücken auf dem Feld der Regionalstudien zu schließen. Merschjohann leistet weit mehr als das. Er hat eine moderne, multiperspektivische Studie vorgelegt, die sich nicht mit regionalem Klein-Klein begnügt, sondern in einen größeren Rahmen eingebettet ist. Anders als bei manch anderem wissenschaftlichen Erstlingswerk ist gerade das Kapitel zum allgemeinen politischen und administrativen Kontext kein Pflichtprogramm. Merschjohann gelingt es, so unterschiedliche Aspekte wie die grundlegenden Ideen zur modernen kommunalen Selbstverwaltung (Stein/Hardenberg) oder die Grundfragen sich weiter ausdifferenzierender politischer Partizipation mit der allgemeinen Geschichte der nordrhein-westfälischen Verwaltungsreform zu verweben. An seinen konkreten Fall-Kommunen arbeitet der Autor entlang der Thesen des Soziologen Pierre Bourdieu auch heraus, welche Bedeutung (politische) Persönlichkeiten bei der Stimmungs- und Entscheidungsbildung haben. So war es - wie Steilmann in Wattenscheid - auch im Detmolder Raum ein Unternehmer, der den Widerstand organisierte. In Höxter wiederum - wo ein Schützenverein versuchte, die Reformgegner zu sammeln - war es vor allem dem Einsatz des Oberkreisdirektors und CDU-Landtagsabgeordneten Paul Sellmann zu verdanken, dass die 77 Gemeinden des Kreises von einem freiwilligen Gebietsveränderungsantrag überzeugt werden konnten.
Der Düsseldorfer Historiker Christoph Nonn hat vor einigen Jahren auf das Paradoxon hingewiesen, dass die Planungseuphorie schon längst wieder vorbei war, als die nordrhein-westfälische Gebietsreform 1975 abgeschlossen war. Der in dieser Deutlichkeit danach nie wieder ausgeprägte Zukunftsoptimismus war spätestens Ende 1973 mit der Ölkrise zu Ende. Ähnlich wie seit Beginn des Ukrainekriegs die aktuelle Ampelregierung - die 2021 mit dem Remix-Anspruch "Mehr Fortschritt wagen" angetreten ist - standen auch vor fünf Jahrzehnten nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern Krisenbewältigung und Pragmatismus mit einem Mal (wieder) ganz oben auf der Tagesordnung. Zu einer der Ära Kühn vergleichbaren Phase der Planungs- und Reformeuphorie kam es in Nordrhein-Westfalen bisher nicht mehr. Ende der Neunziger scheiterte der damalige Ministerpräsident Wolfgang Clement (SPD) mit seinem Vorhaben, die beiden Landschaftsverbände in NRW abzuschaffen. Wenige Jahre später wollte die schwarz-gelbe Landesregierung unter Jürgen Rüttgers (CDU) die fünf Regierungsbezirke des Landes sowie die beiden Landschaftsverbände zu drei Einheiten für das Rheinland, das Ruhrgebiet und Westfalen zusammenlegen. Doch der Reformeifer erlahmte bald, weil vor allem Westfalen - das sich im Vergleich mit dem Rheinland chronisch benachteiligt sieht - erhebliche Bedenken artikulierte. REINER BURGER
David Merschjohann: "Umgekrempelt". Die kommunale Gebietsreform in Ostwestfalen-Lippe (1966 -1975).
Brill Schöningh, Paderborn 2022, 495 S., 74,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main