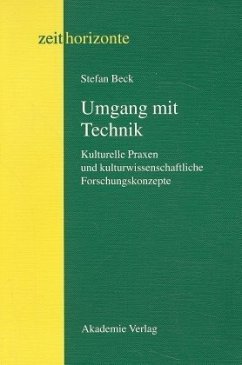Unter Rückgriff auf neue Arbeiten der Techniksoziologie, -ethnologie und -philosophie wird ein Modell vorgeschlagen, mit dem der Umgang mit alltäglicher Technik unter kulturwissenschaftlicher und praxistheoretischer Perspektive konzeptualisiert werden kann. Technik wird hierbei als materielles, soziales und kulturelles Konstrukt verstanden, als ein komplex "gestalteter" Erfahrungs- und Handlungszusammenhang, der beide Optionen in sich trägt, den Zwang zum alltäglichen Arrangement mit der "technischen Welt" wie die Chance, sich in ihr mit der Kunst des Eigensinns auch Freiräume erkämpfen zu können.

Die Erfolgsgeschichte der Techniker ist auch eine Chronik der Vorurteile
Um 1800 bürgerte sich durch die Reform des Hochschulwesens eine Trennung von reiner Wissenschaft und angewandter Technik ein, die dem sozialen Ansehen der technischen Intelligenz zunächst schadete. Der zweite Band der "Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt" bietet in fünfzehn Beiträgen durchweg informative, mitunter pointierte Analysen der Technik vor dem Hintergrund der Bilder, die sich die Gesellschaft von ihr machte. Michael Fessner untersucht das gesellschaftspolitische Denken Carl Julius von Bachs (1847-1931), Volker Husberg die Anschauungen des politisch umstrittenen Technikhistorikers Carl von Klickostroem. Stefan Willeke beschreibt die Technokratiebewegung der Zwischenkriegszeit, Helmut Maier seziert die nationalsozialistische Technikideologie. Maria Osietzki betrachtet die Elektrifizierung kulturhistorisch. Die Popularisierung der Elektrotechnik gelang, als die gesellschaftlichen Ängste vor der Elektrizität mit den Mitteln sprachlicher und bildlicher Symbolisierungen abgebaut wurden.
Von der Dreschmaschine über den Dosenöffner bis zum Computer bringt fast jede neue Gerätegeneration verschiedene Anpassungsmechanismen in Bewegung: Alte Handlungssequenzen müssen vergessen und durch andere, gebrauchskonforme ersetzt werden. Die Tatsache, daß bei der Anpassung an den technischen Wandel zumeist nicht Maschinen, sondern Menschen auf der Strecke bleiben, ist - wie Stefan Beck in seiner Monographie zum "Umgang mit Technik" darlegt - von der deutschsprachigen Volkskunde und ihrer modernen Nachfolgerin, der Kulturanthropologie, kaum untersucht worden.
Der Autor möchte diese Blindheit eines Fachs, dessen Thema der Alltag ist, auf die "soziale Identität der Disziplin" und die "Konstruktion ihrer Forschungsgegenstände" zurückführen. In einer beschaulichen "Beobachtung der volkskundlichen Beobachtung" nennt Stefan Beck Ursachen dafür, daß der Zusammenhang von Technik und Alltagsleben ethnologisch kleingeschrieben wird. Er skizziert, was ein bei Handlung und Bedeutung ansetzender "style of reasoning" für die Veranschaulichung des Gegenstands leisten könnte. Becks Darlegungen sind selbst allerdings nicht anschaulich: Keine noch so bescheidene Fallstudie des Umgangs mit widerspenstigen oder zweckentfremdeten Geräten erleichtert das Lesen.
Dagegen ist die technikphilosophische Schrift François Dagognets geradezu konkret: Sie betrachtet nicht nur an Beispielen das seit der Antike wiederkehrende Motiv von Handarbeit und Kontemplation, Sinnlichkeit und Sinn, sondern erörtert auch von Experten entwickelte Techniken, die dem menschlichen Leben von der Zeugung bis zum Tod nachhelfen (Medizin, Arzneimittelkunde, Psychopharmakologie, Genforschung). Außerdem betrachtet der Autor einige nach wie vor ungelöste moralische Fragen, die sich aus der Anwendung dieser Biotechniken ergeben.
Nun wendet sich das Buch zwar an alle, die sich für Technik und Technikphilosophie interessieren; als Arbeitsbuch ist es jedoch - und das macht diese Monographie bereits zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zu einem technikgeschichtlichen Dokument - für jene gedacht, die sich auf die Aufnahme in eine der französischen Eliteschulen vorbereiten, gleichviel, ob sie eine Beamten-, Offiziers-, Professoren- oder Ingenieurslaufbahn anstreben. An diesem Traktat läßt sich also ermessen, was man im intellektuellen Gepäck mitbringen müßte, wollte man in die Führungselite der französischen Republik aufsteigen und sich den rabiaten Auslesetechniken stellen. ALEXANDRE MÉTRAUX
Burkhard Dietz, Michael Fessner, Helmut Maier (Hrsg.): "Technische Intelligenz und ,Kulturfaktor Technik'". Kulturvorstellungen von Technikern und Ingenieuren zwischen Kaiserreich und früher Bundesrepublik Deutschland. Waxmann Verlag, Münster 1996. 325 S., br., 49,90 DM.
Stefan Beck: "Umgang mit Technik". Kulturelle Praxen und kulturwissenschaftliche Forschungskonzepte. Akademie Verlag, Berlin 1997. 398 S., br., 74,- DM.
François Dagognet: "L'essor technolonique et l'idée de progrès". Armand Colin, Paris 1997. 172 S., br., 98,- FF.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main