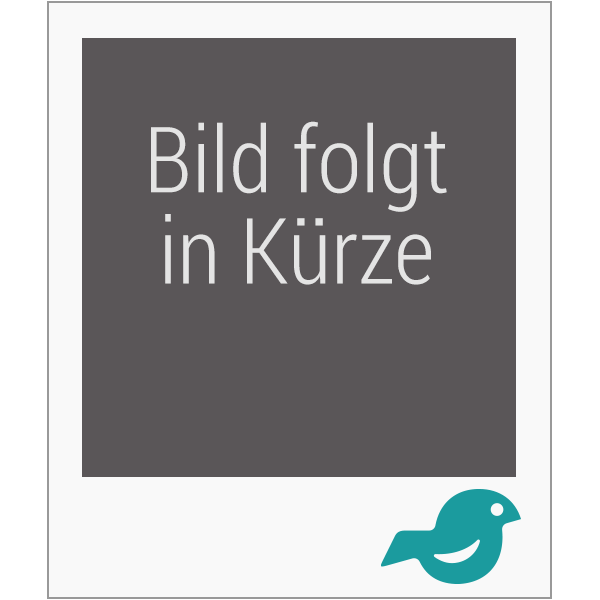Was ist typisch für die Deutschen? Sind sie Autonarren, Sandburgenbauer und disziplinierte Fußballer? Wie steht es mit der deutschen Gemütlichkeit, mit der Naturbegeisterung, Ordnungsliebe und dem deutschen Fleiß? Was ist dran an der Behauptung, die Deutschen hätten keinen Humor?
In diesem Buch kommt manch typisch Deutsches auf den Prüfstand. Realität und Vorurteil werden beleuchtet, Herkunft und Wirkung von Pauschalurteilen befragt, die jüngsten Entwicklungen beschrieben. Muß nicht von zwei Deutschland-Bildern ausgegangen werden? Löst die Globalisierung die nationalen Konturen auf? Ist "typisch deutsch" nur noch ein Vorurteil, über das es sich trotzdem nachzudenken lohnt?
Rezension:
- "... Hier kommet ein wunderbares Büchlein ins Spiel: "Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen?" Witzig erhellend und umfassend stellt sich hier der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger dem Thema. Ob Trachten, speisen, Landschaften, Architektur, Geschichte, Verhalten, Symbole, er zieht alles heran, was den Deutschen ausmacht oder ausmachen soll." (Rolf-Bernhard Essig, Berliner Illustrierte)
In diesem Buch kommt manch typisch Deutsches auf den Prüfstand. Realität und Vorurteil werden beleuchtet, Herkunft und Wirkung von Pauschalurteilen befragt, die jüngsten Entwicklungen beschrieben. Muß nicht von zwei Deutschland-Bildern ausgegangen werden? Löst die Globalisierung die nationalen Konturen auf? Ist "typisch deutsch" nur noch ein Vorurteil, über das es sich trotzdem nachzudenken lohnt?
Rezension:
- "... Hier kommet ein wunderbares Büchlein ins Spiel: "Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen?" Witzig erhellend und umfassend stellt sich hier der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger dem Thema. Ob Trachten, speisen, Landschaften, Architektur, Geschichte, Verhalten, Symbole, er zieht alles heran, was den Deutschen ausmacht oder ausmachen soll." (Rolf-Bernhard Essig, Berliner Illustrierte)

Kant und Kohl, Beckenbauer und Barbarossa, Goethe, Goebbels und Guildo Horn - sie alle haben eines gemeinsam: Man rechnet sie unter die Deutschen. Aber wüsste man nicht darum, könnte man dann aufgrund ihres Wesens auf die Herkunft schließen? Stehen sie für den typischen Deutschen? Und falls ja: Was zeichnet einen solchen aus? Fleiß und Ordnungsliebe? Sekundärtugenden, mit denen man eine Regierung so gut leiten kann wie ein Konzentrationslager? Setzt der Deutsche auf Gemütlichkeit? Ist er naturgemäß motorisiert, samstäglicher Lustwäscher und allzeit bereiter Raser? Liegestuhlmarkierer und Sandburgenbauer, Naturkind und Wandervogel? Ein analfixierter Verwaltungsfetischist, dem Ordnung das ganze Leben ist? Zäh wie Windhund, kalt wie Stahl, hart wie altes Fensterleder? Fragen, auf welche die Volkskundler uns eindeutige Antworten bis heute schuldig geblieben sind. Einer der profiliertesten Vertreter des Faches, Hermann Bausinger aus Tübingen, gibt nun eine Antwort, die uns nicht zufriedenstellen soll ("Typisch deutsch". Verlag C. H. Beck, München 2000. 160 S., br., 17,90 DM). "Der Deutsche", resümiert der Autor souverän, sei "romantisch veranlagt und rückwärtsgewandt, schwärmerischer Anhänger der Natur und des Natürlichen, organisiert in Vereinen, zufrieden in der selbstgewählten, gemütlich ausstaffierten Enge, sesshaft und trinkfest". Zum Glück weiß keiner besser um die Sinnlosigkeit solcher Pauschalisierungen als Bausinger selbst. Überhaupt ist ihm sein Unterfangen, den Charakter des deutschen Michel, vermessen zu wollen, auf sympathische Weise fragwürdig. Schon zu Beginn seiner Expedition ins Ungewisse räumt er der Frage nach "Sinn und Unsinn der Typisierung" erfreulich breiten Raum ein. Pauschalurteile prägen unsere Wahrnehmung, ja machen diese überhaupt möglich. Erst die Unterstellung, alle Deutschen seien Raser und litten rechtsseitig unter schwerem Bleifuß, ermöglicht die Beobachtung, dass hierzuland bisweilen unbeherrscht durch die Gegend gekachelt wird; was zwar in vielen Einzelfällen leicht beweisbar ist, angesichts der auf überfüllten Autobahnen sich dahinstauenden Motoristenmasse aber auch gut zu widerlegen. "So wird das auffallende Verhalten Einzelner oft schnell als nationale Eigenart interpretiert." Jede Kollektivbezeichnung setzt Typisierung voraus und Typisierung in Gang, gleichzeitig ist jede Typisierung aber auch eine Entlastung - man glaubt, das Fremde benannt und verstanden zu haben. Ferner ist zu fragen, wer die Typisierung überhaupt vornimmt: ein Deutscher oder ein Ausländer? Charakterisierungen anderer, darauf verwies schon Norbert Elias in seinen "Studien über die Deutschen", sind häufig Kontrastbilder zum eigenen Erfahrungshintergrund; weshalb sich ein deutscher Soziologe zunächst von einer gewissen Betriebsblindheit frei machen muss. Bausinger bestimmt das Deutsche nicht aus der Perspektive des Exoten, der vor allem ex negativo urteilt, sondern, wie es sich gehört, aus sicherer Entfernung und direkt vom Zentrum aus, durchweg neugierig und unstreng historisch, er gelangt vom Nibelungenlied bis zur "Kanakensprache" der Kölner Rap-Gang "Sons of Gastabeita", von der alten Reichsherrlichkeit bis zur neuen deutschen Lockerheit. Zumal vieles, was heute als tief und treulich deutsch empfunden wird, ohnehin eine romantisierende Erfindung des neunzehnten Jahrhunderts ist: wie etwa die bürgerliche Familieninszenierung "Deutsche Weihnacht", das gemeinschaftliche Ringen und Singen in allerlei Vereinen oder der tief verwurzelte Aberglaube an Pflicht und Hausordnung. Nach sorgfältiger Prüfung macht Bausinger schließlich ein Angebot: "Das lebendige Bewusstsein regionaler Unterschiede, das die Suche nach dem typisch Deutschen erschwert, ist typisch Deutsch." In diesem Sinne markiert Bausinger ein noch leidlich in Stämme gegliedertes Nationalvolk, das sich weniger durch eine lange gemeinsame Geschichte definiert als durch die Vielzahl seiner Traditionen, Vorlieben, Schwänke, Gewohnheiten. Ist von Nationalstolz die Rede, sei vor allem ein lokalpatriotisch geprägter "Regionalstolz" gemeint; so wie sich ein wie auch immer geartetes deutsches Nationalgericht stets doch nur als Regionalgericht entpuppt. Was dem Schwaben sein Spätzle, dem Thüringer sein Kloß, das ist dem Berliner die Bulette, dem Friesen der Teebeutel. Und dem Düsseldorfer niemals das Kölsch.
OLIVER SCHMITT
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Oliver Schmitt, man merkt es gleich, ist skeptisch was Typisierungen angeht. Mit diesem Buch kann er sich jedoch sogleich anfreunden, weil der Autor selbst diese Vermessung des deutschen Charakters "auf sympathische Weise fragwürdig" findet. Bausinger prüfe sorgfältig vom Nibelungenlied bis zur ‚Kanakensprache‘ der Kölner Rap-Band ‚Sons of Gastabeita‘ und komme zu dem Schluß, dass typisch deutsch "‘das lebendige Bewußtsein regionaler Unterschiede‘" sei, welches eine Typisierung gerade erschwere. Eine Auffassung, die Schmitt zu billigen scheint: "Was dem Schwaben sein Spätzle...das ist dem Friesen sein Teebeutel. Und dem Düsseldorfer niemals das Kölsch."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH