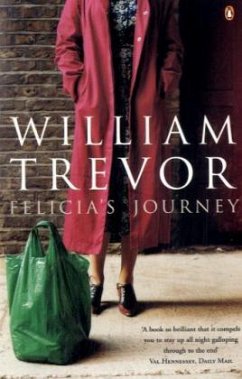William Trevor reist mit Felicia / Von Ingeborg Harms
Das Leben ist eine Reise. Hier hat die Prosa ihr ältestes Motiv. William Trevor entfaltet es in seiner ursprünglichen Form als Reise zum Tode und über ihn hinaus. Seine so ungewitzte wie leutselige Protagonistin Felicia verläßt ihr irisches Heimatstädtchen mit der Rente ihrer Großmutter und zwei Plastiktüten in der Hand, um im Industriegebiet von Mittelengland Johnny Lysaght, den Vater ihres werdenden Kindes, aufzuspüren. Johnny war dem Mädchen am Hochzeitstag ihres Bruders begegnet; er ging, als mit dem Abfahren des Brautpaars das Konfettiwerfen anfing, auf dem Bürgersteig vorbei und lächelte sie an. Daraus wird ein kurzer Urlaubsflirt für ihn.
Für Felicia, die seiner vagen Auskunft glaubt, er arbeite im Lager eines Rasenmäherwerks, beginnt ein Ausflug ohne Rückkehr. Hinter sich läßt sie die Dämmerexistenz der Arbeitslosigkeit zurück, das trübe Krankenbett der Großmutter, den Heißhunger der in einem Steinbruch beschäftigten Brüder und den sachten Egoismus eines Vaters, der die Tochter aus Bequemlichkeit zu Hause hält. Unterwegs verwandelt sich die lockende Wohlgestalt des augenzwinkernden Johnny, den Felicia nie wieder sehen wird, in die bleiche Drohnengestalt des Mr. Hilditch, einem gleich Fritz Langs Kindermörder M so netten wie fetten Unbekannten, der sie in sein Auto und später in sein Haus, eine wahre Blaubartbude, lädt.
Trevors Roman hat zwei Hauptfiguren, Felicia und den Mann, dem ihre Reise gilt. In einem gewissen Sinn sind Johnny und Mr. Hilditch dieselbe Person. Beide sind Söhne, die die Mutter nicht entließ. Felicia macht den fatalen Versuch, die Adresse ihres Geliebten von Mrs. Lysaght zu erfahren, und trifft auf die Bitterkeit versteinerter Liebe: "Was ist mit Johnny? hab ich zu seinem Vater gesagt. Er hat dagestanden, gerade aus dem Regen reingekommen, das Wasser ist auf den Fußboden getropft, einen Schritt von da, wo du jetzt stehst. Bedeutet Johnny dir gar nichts? hab ich gefragt, und er hat bloß weggeguckt, eine Wasserlache um die Füße. Hör mal, hab ich gesagt, aber wozu sollte er zuhören? Er wollte weg, und warum sollte er da zuhören? Du kriegst regelmäßig Geld, hat er gesagt."
Die Wut der Mutter kehrt sich nicht gegen den Mann, der sie in ihrer Schwangerschaft verlassen hat, sondern gegen die "zuckersüßen Nattern", die die Männer umgarnen. Also kappt sie die Schnur, die ihren Sohn an eine andere Frau zu binden droht. Mr. Hilditchs nymphomanische Mutter war für die Zukunft ihres Sohnes nicht weniger fatal. Sie verführte ihn zum Inzest, als andere Männer sie verließen. Die Kameradschaft, die bis in den Tod verbindet, lautet die Inschrift eines Kriegerdenkmals, das den kleinen Hilditch in einem von der Mutter frequentierten Heilbad einst beeindruckt hat. Mr. Hilditch ist dem Mutterleib nie ganz entkommen, der hat ihn wie die Nation ihre Krieger im Griff. Wenn die Frauen, die er aufliest, weiterziehen wollen, beseitigt er sie, die zu begleiten ein regressiver Mechanismus ihm verbietet. Als Hilditch Felicia zur Abtreibung überredet, ist das nicht nur eine weitere seiner monströsen Taten, sondern auch der perverse Ausdruck der Sehnsucht, geboren zu werden um jeden Preis.
Die mutterlose Felicia hingegen ist immer draußen. Sie ist die, die nicht heimkehren kann. Nachdem sie Mr. Hilditch entkommen und ihren Träumen entwachsen ist, sucht sie keinen Anschluß an die triste Idylle ihrer irischen Jungmädchenzeit, sondern wählt den Abstieg ins Stadtstreicherleben und überläßt sich so endgültig der Fremde. Und doch ist dieser Tiefpunkt bei Trevor keine Katastrophe. Nicht physische Entbehrungen, sondern die Hypotheken der familiären und, wie die Romankonstruktion impliziert, der Geschichte im großen ziehen Trevors Gestalten ins Unglück. Felicia verliert die Unterstützung ihres Vaters, als dieser erfährt, daß Johnny in Wahrheit bei der britischen Armee sein Geld verdient, dem Erzfeind der Familie, seit der Großvater 1916 beim irischen Aufstand umkam.
Ruhe vor der Wucht sich vererbender Verletzungen, die die zarten Züge individuellen Lebens entstellen, finden Trevors skurrile Helden in temporären namenlosen Gruppen, der Heilsarmee, dem Teeausschank für Obdachlose, dem wechselnden Kantinenpersonal einer Fabrik. Im Verzicht auf gesellschaftliche Identität findet Felicia ein sprödes Glück unter ziehenden Wolken mit der Sonne auf ihrem Gesicht. Ihre Gedanken füllt keine Zukunft, sondern die Erinnerung an Elsie, Beth, Sharon, Gaye, Jakki und Bobbi, von denen Mr. Hilditch ihr im Wahn erzählte. "Ahnten sie, was sie erwartete, kurz bevor es soweit war? Ihre Trauer besteht darin, sich das zu fragen."
Felicia steht für eine Geschichte der Verlierer, die lückenhaft, unwahrscheinlich und sehr vergänglich ist. Zu ihren Subjekten gehört auch Mr. Hilditch. Mit müheloser Präzision und zarter Rücksicht zeichnet Trevor die Existenz der äußersten Unschuld und die der empörendsten Verschuldung in gleichmütiger Nachbarschaft. Weil sein Blick sich der intimen Welt Felicias und Hilditchs so unaufdringlich wie wachsam anschmiegt, erlöst er beide aus den Verstrickungen ihrer Geschichte. Nicht das Elend hat das letzte Wort, sondern die Verwunderung über das Spiel von Fülle und Entzug. Hilditch, und das ist die kühnste Wendung in diesem Thriller, hat keine Erinnerung an das Ende seiner weiblichen Bekanntschaft: " - der Augenblick des Weggangs war jedesmal so schmerzlich, daß etwas in ihm unbewußt die dazugehörigen Einzelheiten ausgelöscht hatte."
Trevors jüngster Roman, für den der in England lebende irische Autor zwei bedeutende Literaturpreise seines Gastlandes, den Whitbread und den Sunday Express Award erhielt, ist zugleich eine lakonische Sozialreportage, wie sie sonst nur durch filmische Mittel erreicht wird, und subtiles Psychogramm mit starken lyrischen Momenten. Keine seiner Figuren stürzt in den statistischen Ruch des bloß Beispielhaften ab. Die Welt der Fleischfabriken, Putzjobs und feuchten Unterführungen ist von einer Vitalität, die Trevor mit mikroskopischer Einsicht in unverwechselbaren Szenen festhält. In den schäbigen Winkeln unserer mit kathedralenlosen Großstadtstreifen bandagierten Länder entdeckt sein strenger Realismus allegorische Muster, die immer und überall auf den Fluch der Stagnation und auf das Glück der Reise deuten, die noch in ihren verkrüppelsten Formen "die Lebenden von den Toten trennt".
William Trevor: "Felicias Reise". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Thomas Gunkel. Rotbuch Verlag, Hamburg 1995. 272 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main