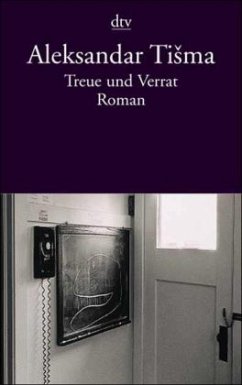Auch im sozialistischen Novi Sad ist Mitte der sechziger Jahre die Erinnerung an das "Dritte Reich" noch überall präsent. Am Beispiel seines Protagonisten stellt Aleksandar Tisma die Frage, ob nach den Schrecken der Vergangenheit menschliches Glück noch gedeihen kann. "Treue und Verrat" ist der Abschluss eines fünfbändigen Romanzyklus und erzählt von der Liebe des ruhelosen Sergije zu Inge, der Enkelin eines deutschen Juden, die mit dem Sohn eines Nazis verheiratet ist.

Aleksandar Tisma schließt mit "Treue und Verrat" seinen Romanzyklus ab · Von Lothar Müller
Die Schauplätze machen in den Romanen des serbischen Schriftstellers Aleksandar Tisma den Figuren die Hauptrolle streitig: die ehemalige Judengasse, die dem neuen Boulevard weichen muß; die Häuser, die enteignet oder abgerissen werden; die Wohnungen, die von heute auf morgen verlassen, die Geschäfte, die aufgegeben werden müssen. Die Synagoge, die "wegen ihrer berühmten Akustik und aus Mangel an Gläubigen" in einen Konzertsaal verwandelt wurde. Sie alle sind Orte der Unverläßlichkeit. Die Zeit, die an ihnen vergeht, ist eine Zeit zwischen zwei Kriegen: dem erinnerten der Vergangenheit und dem jederzeit vorstellbaren künftigen.
Miroslav Bam, einer der wenigen Überlebenden der Judenvernichtung während der Okkupationszeit, betrachtet am Ende des Romans "Das Buch Blam" (1985, dt. 1995) die Fassaden des Hauptplatzes in Novi Sad: "Ihre Silhouetten sehen aus wie zerstört, als hätten sie sich unter der schrecklichen Hitze eines schweren Kriegsgeräts aufgelöst und wären beim Abkühlen zu asymmetrischen, klobigen Ruinen erstarrt. Das ist eine Szenerie aus dem nächsten Krieg ..." Die Stadt Blams ist die Stadt seines Autors, der im Jahre 1924 als Sohn einer jüdischen Mutter und eines serbischen Vaters in der Hauptstadt der Vojvodina geboren wurde. Aleksandar Tisma hat Novi Sad in die Weltkarte der Literatur in diesem Jahrhundert eingezeichnet. Aber das Porträt dieser Stadt sucht man bei ihm vergebens. Ihr Zentrum ist keine Sehenswürdigkeit, sondern ein Ereignis: das Massaker der ungarischen Besatzer an den Juden und Serben vom Januar 1942, der tausendfache Tod an der vereisten Donau. Damit war der Untergang des alten Novi Sad besiegelt, in dem Serben, Kroaten, Juden, Russen, Ungarn und Deutsche trotz aller Differenz eine verläßliche Heimat hatten. Um dieses Zentrum kreisen die fünf Bücher Tismas, die er seinen "Pentateuch" nennt, obwohl es in dieser Thora keinen Gott und statt eines Messias, auf den sich hoffen ließe, nur die Gewißheit gibt, daß sich verläßlich nirgends wohnen läßt. Mit der Übersetzung des Romans "Treue und Verrat" (1983) liegt dieser in den achtziger Jahren entstandene Zyklus nun vollständig auf deutsch vor.
Dem überlebenden Juden Blam, der in der Nachkriegszeit dem Phantasma künftiger Verfolgung erliegt, hat Tisma in "Kapo" (1987, dt. 1997) den überlebenden Täter gegenübergestellt, den Juden, der Auschwitz entkommt, weil er mit der SS paktiert. In dieser Figur ist die Dämonologie der Erinnerung ins Extrem getrieben. In "Treue und Verrat" stehen scheinbar alltäglichere Protagonisten im Mittelpunkt. Aber auch sie sind aus der Bahn geworfen, durchtränkt von den Schrecken der Kriegszeit, die in diesem Buch freilich bereits weiter zurückliegt. Man schreibt das Jahr 1962. Sergije Rudic, Serbe aus Novi Sad, Jahrgang 1924, arbeitet in einem Verlagshaus in Belgrad als Lektor und Zensor. Die aus westlichen Verlagen übernommenen Liebes- und Abenteuerromane, die er auf "schädliche Tendenzen" durchmustert, haben "die düstere politische Erbauungsliteratur" bei den Lesern verdrängt. Sergije aber entstammt dieser düsteren Welt, er war als junger Mann an Aktionen gegen die Besatzer und an einer Gefängnisrevolte beteiligt. Tisma aber macht aus ihm einen grandiosen, lakonischen Gegenentwurf zum Partisanenmythos in der jugoslawischen Nachkriegsliteratur. Der heldenhafte Aufstand erweist sich bei näherer Betrachtung als schwärmerisch-pubertärer Dilettantismus, dem die Genossin und Geliebte zum Opfer fällt. Nach dem Krieg enden die diplomatische Karriere des Helden und seine erste Ehe in einem Mord, den er an seinem Nebenbuhler begeht. Und während er später die Liebesheftchen redigiert, scheitert die zweite Ehe.
All das erzählt Tisma fernab von allem übersichtlich-betulichen Nacheinander. Wie stets ist die Gegenwart bei ihm löchrig, zerrissen, porös und kaum je imstande, der andrängenden Vergangenheit und der unberechenbaren Zukunft ein Terrain eigener Herrschaft abzuringen. Wie so oft ist die Wohnungsfrage das Einfallstor der Geschichte. Eine nach Österreich verschlagene Generationsgefährtin Sergejis aus dem deutschstämmigen Bevölkerungsteil in Novi Sad hat Erbansprüche auf die Wohnung von Sergijes Eltern. Tisma gewinnt der Genealogie dieser Konstellation immer neue Rückblicke auf die Zeit der Flüchtlingsströme und Besetzungen ab, ohne dabei die Wohnungsaffäre symbolisch zu überlasten. Unvermeidlich und lakonisch steigt aus ihr das untergegangene Novi Sad auf, in einer Prosa, die das Ornament und das Dekorative nicht kennt. Selten genug erlaubt sie sich eine Metapher oder einen Vergleich, und wenn, dann sind beide zerschlissen, unspektakulär oder gar unbeholfen. Ganz bei sich ist diese Sprache vor allem dort, wo sie Inventur ist, Instrument des Aufschubs, der Verzögerung und Unterbrechung des Erzählens durch den Ansturm der Fülle von biographischen Partikeln, der Anekdoten des Schreckens, der politischen Intrigen, der Allgegenwart des Todes. Alle Zukunftsgewißheit des jugendlichen Helden erlischt in dem Blick, den er auf die verrenkte Leiche seiner Gefährtin wirft. Es ist eine eher unscheinbare Ironie, wenn der gelangweilte Lektor und seine Kollegen gelegentlich mit der Idee einer "Typologie des Unterhaltungsromans" spielen. Doch steckt darin einiger Ernst. Tisma setzt die ganze Wucht seiner literarischen Meisterschaft daran, die Sehnsucht des Publikums der frühen sechziger Jahre nach einem Ausbruch aus der Düsternis der Nachkriegszeit in die Welt der geglückten Liebe zu konterkarieren. Er tut das, indem er der Erlösungshoffnung scheinbar Nahrung gibt und die Wohnungsaffäre in eine Liebesgeschichte überführt, die alle Anzeichen der Idylle trägt. Sergije verliebt sich in Inge, die Wohnungserbin, statt ihr und ihrem Mann gegenüber energisch die Interessen seiner Eltern zu verfolgen.
Es gehört aber zu den strengen Gesetzen in Tismas Welt, daß die Figuren bis in ihre Sexualität von den geschichtsmächtigen Energien der Illusion und Destruktion bestimmt sind. Sergeji und Inge stürzen sich in die fünftägige Idylle wie in einen lang ersehnten Urlaub vom mißglückenden Leben. Ein Fluß flüstert, die Erfüllung scheint vollkommen. Aber Tisma läßt darüber die Schatten jener Vergewaltigungen fallen, ohne die kein Absatz über den Krieg, die Judenverfolgung und das Flüchtlingselend endet. "Sie ist eben trotz allem eine Deutsche, denkt er blasphemisch, und als er sie ins Hotel, in sein oder ihr Zimmer zurückgebracht hat, fällt er mit der Raserei des Eroberers und zugleich des Sklaven über sie her, der sich seiner Herrin bemächtigt hat."
Wenn Tisma erotische Attraktion schildert, so gilt der erste Blick oder Griff des Mannes stets der Hüfte der Frau. In den gefährdetsten Figuren seiner Welt, den Kindern, kehrt dieses Motiv als Risiko wieder. Sergejis Tochter aus seiner zweiten gescheiterten Ehe kommt mit einer Hüftluxation auf die Welt, die zur Behinderung wird, weil Sergije zu schwach war, eine Operation gegen seine Frau durchzusetzen. Es hätte dieses massiven Hinweises nicht bedurft, um den Leser auf die Gefahren zu verweisen, die die Sexualität - als Fortpflanzung in die Zukunft hinein - für die Protagonisten bereithält. Stets pflegen bei Tisma Untreue, Verrat und Ehebruch oder auch die undramatische Erstarrung des Alltags diese Zukunft zu durchkreuzen. Die böse Skizze der tristen Ehe von Sergijes Eltern dient dieser Parallelisierung von historisch-politischer Enttäuschung und Desillusionierung der Körper.
Aus dem Umstand, daß Inge, mit ihrem Mann seit Jahren kinderlos, von Sergije sogleich schwanger wird, ließe sich in der Typologie des Unterhaltungsromans womöglich ein gutes Ende, eine Befreiung von den Dämonen der Vergangenheit, gewinnen. Nicht bei Tisma. Kühl verzichtet er auf die Möglichkeit, die Katastrophe von Inges Ehemann, dem Sohn eines der Nazis von Novi Sad, vorantreiben zu lassen. Gnadenlos führt er den Partisanen ins Zentrum seiner Illusion zurück. Dort begeht er den Verrat, von dem der Romantitel spricht: nicht an der Geliebten, sondern an seinem Freund aus Jugendtagen, dem Juden Eugen Patak. Er ist in diesem Buch der überlebende Jude, der alle seine Angehörigen verloren hat. Ein Mann, der von der Macht der Worte träumt, ein Büchernarr, dem das Lesen zu einer Droge geworden ist, ohne die er nicht leben kann. Eugen hat einst gegen Sergijes aus schwärmerischer Liebe statt aus politischer Reife geborene Heldentat opponiert. Statt sich Eugens Wahrheit zu stellen, bleibt der ehemalige Partisan im Bann seiner Geschichtslegende und will den Freund zwingen, ihm bei der Beseitigung von Inges Ehemann zu helfen. Mit dem Selbstmord, den der verratene Freund statt des Mordes vollzieht, endet der Roman. Roh, hastig und ohne daß der Erzähler dem unausgetragenen Kind noch ein Wort gönnte.
Mit Eugen, wiederum einem jüdischen Opfer, versinkt die Hoffnung in der Donau, daß in der geschilderten Gegenwart, im Jugoslawien des Jahres 1962, die Nachkriegszeit endlich zu Ende gehen könnte. Aleksandar Tisma hat in seinem "Pentateuch" noch zwanzig Jahre später gegen die Illusion angeschrieben, dieser Schritt heraus aus der Welt der "düsteren politischen Erbauungsliteratur" sei möglich, ohne zuvor die Legenden der Partisanenmythologie zu zerstören und das volle Ausmaß der Zerstörung, Vernichtung und des Zerfalls seit jener Zäsur des Januar 1942 zur Kenntnis zu nehmen. Die Stadt Novi Sad, wie sie dem Leser des "Pentateuch" in den verwirrenden Schichten und Geschichten, den Genealogien ihrer Straßen, Häuser und Bewohner als literarisches Mahn- und Denkmal ist eine der europäischen Hauptstädte der Weltliteratur. Tisma knüpft wie in allen Romanen so auch hier nicht an den historischen Roman, sondern an die Tradition des Desillusionsromans an. Er hat in "Treue und Verrat" eine riskante, gelegentlich die Kolportage streifende Konstruktion nicht gescheut, um seine Diagnose der Depravierung aller Lebensenergien tiefer als nur in der Ideologiekritik historisch-politischer Illusionen zu verankern: in der Geschichte der scheiternden sexuellen Idylle.
Aleksandar Tisma: "Treue und Verrat". Roman. Aus dem Serbischen übersetzt von Barbara Antkowiak. Carl Hanser Verlag, München und Wien 1999. 304 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Das Leben hat Sergij der meisten Illusionen beraubt: Während des Krieges im jugoslawischen Widerstand engagiert, erlebt er im Gefängnis den Tod seiner Freundin; seine erste Frau hintergeht ihn, die zweite verlässt ihn nach der Geburt der gemeinsamen Tochter. Eine Mischung aus Nähe und Distanz bestimmt auch das Verhältnis zu seinen Eltern und seinem einzigen Freund Eugen. Erst die Begegnung mit Inge bringt die Veränderung: Sergij, bisher tiefer Gefühle unfähig, verliebt sich. Als er Gefahr läuft, Inge wieder zu verlieren, fasst er einen folgenschweren Entschluss. Schonungslos setzt Aleksandar Tisma den Finger auf die Wunden seiner Charaktere. In Rückblenden erfährt der Leser von den Ursprüngen ihrer Hilflosigkeit – und erkennt lange vor den Figuren selbst deren Unvereinbarkeit. Ein bewegender Roman, bei dem man recht bald weiß, dass man kein Happy End erwarten darf. (www.parship.de)