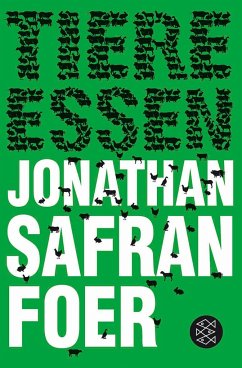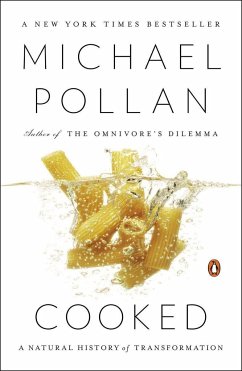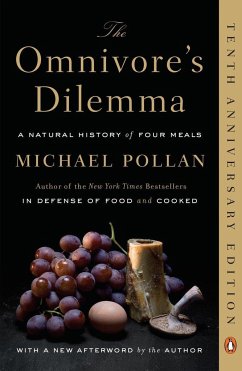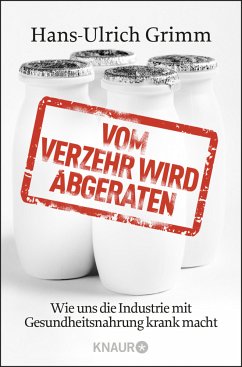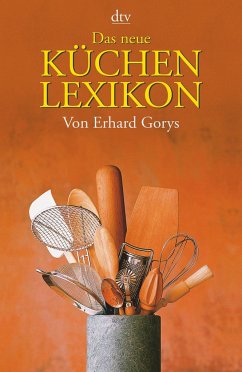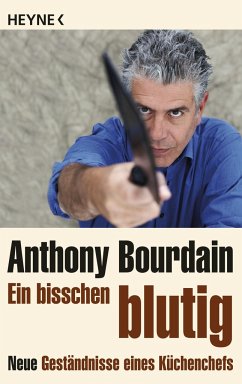Nicht lieferbar
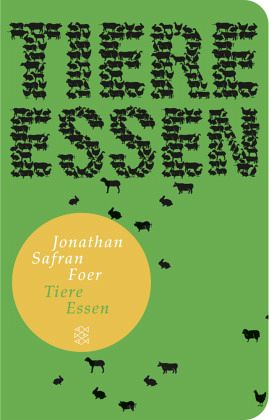
Jonathan Safran Foer
Gebundenes Buch
Tiere essen
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





'Tiere essen' ist ein leidenschaftliches Buch über die Frage, was wir essen und warum. Als Jonathan Safran Foer Vater wurde, bekamen seine Fragen eine neue Dringlichkeit: Warum essen wir Tiere? Würden wir sie auch essen, wenn wir wüssten, wo sie herkommen?
Foer stürzt sich mit Leib und Seele in sein Thema. Er recherchiert auf eigene Faust, bricht nachts in Tierfarmen ein, konsultiert einschlägige Studien und spricht mit zahlreichen Akteuren und Experten. Vor allem aber geht er der Frage auf den Grund, was Essen für den Menschen bedeutet.
Foer stürzt sich mit Leib und Seele in sein Thema. Er recherchiert auf eigene Faust, bricht nachts in Tierfarmen ein, konsultiert einschlägige Studien und spricht mit zahlreichen Akteuren und Experten. Vor allem aber geht er der Frage auf den Grund, was Essen für den Menschen bedeutet.
Jonathan Safran Foer wurde 1977 geboren und studierte in Princeton Philosophie und Literatur. Seine ersten beiden Romane »Alles ist erleuchtet« und »Extrem laut und unglaublich nah« waren sensationelle Erfolge. Sie wurden mehrfach ausgezeichnet und in 38 Sprachen übersetzt. Zuletzt erschienen sein Roman »Hier bin ich« (2016) sowie das Sachbuch »Wir sind das Klima!« (2019). Foer gilt als einer der bedeutendsten amerikanischen Gegenwartsautoren. Er lebt in New York.
Isabel Bogdan, geboren 1968 in Köln, studierte Anglistik und Japanologie in Heidelberg und Tokyo. Sie lebt in Hamburg und arbeitet als Übersetzerin u.a. von Jane Gardam, Jonathan Safran Foer, Nick Hornby und als Autorin und Herausgeberin. 2011 erhielt sie den Hamburger Förderpreis für Literatur, 2006 den für literarische Übersetzung. 2014 wurde sie zusammen mit Maximilian Buddenbohm zur Bloggerin des Jahres gewählt (wasmachendieda.de).
Brigitte Jakobeit, Jahrgang 1955, lebt in Hamburg und übersetzt seit 1990 englischsprachige Literatur, darunter die Autobiographien von Miles Davis und Milos Forman sowie Bücher von John Boyne, Paula Fox, Alistair MacLeod, Audrey Niffenegger, J. R. Moehringer und Jonathan Safran Foer.
Isabel Bogdan, geboren 1968 in Köln, studierte Anglistik und Japanologie in Heidelberg und Tokyo. Sie lebt in Hamburg und arbeitet als Übersetzerin u.a. von Jane Gardam, Jonathan Safran Foer, Nick Hornby und als Autorin und Herausgeberin. 2011 erhielt sie den Hamburger Förderpreis für Literatur, 2006 den für literarische Übersetzung. 2014 wurde sie zusammen mit Maximilian Buddenbohm zur Bloggerin des Jahres gewählt (wasmachendieda.de).
Brigitte Jakobeit, Jahrgang 1955, lebt in Hamburg und übersetzt seit 1990 englischsprachige Literatur, darunter die Autobiographien von Miles Davis und Milos Forman sowie Bücher von John Boyne, Paula Fox, Alistair MacLeod, Audrey Niffenegger, J. R. Moehringer und Jonathan Safran Foer.

Produktdetails
- Fischer Taschenbücher 51285
- Verlag: FISCHER Taschenbuch
- Originaltitel: Eating Animals
- Artikelnr. des Verlages: 1015661
- 3. Aufl.
- Seitenzahl: 576
- Erscheinungstermin: 15. Mai 2013
- Deutsch
- Abmessung: 147mm x 119mm x 24mm
- Gewicht: 264g
- ISBN-13: 9783596512850
- ISBN-10: 3596512859
- Artikelnr.: 36796914
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
»Eine brillante Mischung aus Recherchejournalismus und Autobiografie.« taz
"Es ist investigativ, philosophisch, ökologisch nachfragend, aber vor allem interessant!"
Gebundenes Buch
"Tiere essen" von Jonathan Safran Foer verdeutlicht, welche Ausmaße die heutige Massentierhaltung, vor allem in den USA, angenommen hat.
Aufgrund der Geburt seines ersten Kindes, hat sich Foer auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was man heute alles als "Fleisch" …
Mehr
"Tiere essen" von Jonathan Safran Foer verdeutlicht, welche Ausmaße die heutige Massentierhaltung, vor allem in den USA, angenommen hat.
Aufgrund der Geburt seines ersten Kindes, hat sich Foer auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was man heute alles als "Fleisch" aufgetischt bekommt und vor allem, was sein Kind mit seiner Nahrung alles aufnimmt. Er selbst hat schon immer zwischen Vegetarier und Fleisch-Esser geschwankt, doch die Recherchen haben ihn nun vollkommen zum Vegetarismus bewegt. Und das kann ich gut verstehen!
Illegale nächtliche Besuche in Massentierbetrieben und Gespräche mit Beschäftigten bringen die Grausamkeit, die den Hühnern, Puten, Schweinen, Rindern sowie Fischen angetan wird mit voller Wucht ans Tageslicht. Es ist wirklich pervers, abartig und vor allem rücksichtslos, zu was Menschen fähig sind, nur um möglichst viel Fleisch für minimales Geld rauszuschlagen.
Er versucht in keinster Weise, den Leser zum Vegetarier zu bekehren. Jedem sollte aber zumindest klar werden, was er isst und woher das ganze Fleisch (bzw. Eier) kommt. Ich bin selbst auch kein Vegetarier, esse aber nur sehr wenig Fleisch. Ganz darauf verzichten kann ich auch nicht, aber irgendwie muss dieser Wahnsinn gestoppt werden.
Ich habe auch vorher schon gewusst, dass die Massentierhaltung grausame Tierquälerei ist, aber das Buch hat mir dies noch einmal deutlich gemacht. Jeder sollte dieses Buch, zumindest ansatzweise, gelesen haben und nicht vor allem die Augen verschließen.
Weniger
Antworten 20 von 28 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 20 von 28 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nachdem ich es gelesen hatte, habe ich direkt eine handvoll Exemplare bestellt, die ich zu Weihnachten verschenken werde - nicht so sehr, weil das Thema Fleischkonsum für mich etwas ganz Neues wäre oder weil ich den in jedem Fall wertvollen Informationsgehalt des Buches schätze, …
Mehr
Nachdem ich es gelesen hatte, habe ich direkt eine handvoll Exemplare bestellt, die ich zu Weihnachten verschenken werde - nicht so sehr, weil das Thema Fleischkonsum für mich etwas ganz Neues wäre oder weil ich den in jedem Fall wertvollen Informationsgehalt des Buches schätze, sondern weil mich besonders beeindruckt, wie Foer mit dem inneren Zwiespalt der (vermutlichen Mehrheit aller) Menschen umgeht, die Tierquälerei und alle tatsächlichen Umstände der Tierfabriken für grausam halten, sich hinsichtlich ihres Konsums aber gerade entgegengesetzt zu ihrer eigenen Überzeugung verhalten.
Vor diesem Problem stehen sicher viele Veganer_innen und Vegetarier_innen im täglichen Gespräch mit omnivoren Menschen. Oft erhält man aufrichtig gemeinte Zustimmung für die eigene Lebensweise und die Argumente, ohne dass das Gegenüber daraus Konsequenzen für sein Lebenskonzept ableiten würde.
Foer schreibt:"Ich habe mit Aktivisten gesprochen, die ständig verblüfft und frustriert waren, weil es keine Übereinstimmung zwischen gesundem Menschenverstand und der Essensentscheidung gibt. Ich kann das nachvollziehen, aber ich frage mich doch, ob man nicht gerade bei dieser Irrationalität von Essen ansetzen sollte."
Ich denke, damit spricht er zunächst vielen Menschen aus der Seele. Er verweist nun darauf, dass "Essen" als Kulturgut und traditionsbehaftete Lebensart zu vielschichtig ist um mit einer einseitigen Aufzählung theoretischer Aspekte fundamental verändert werden zu können.
Bei der Lektüre dieses Buches können sicher beide "Seiten" etwas lernen - die bereits überzeugten Nicht-Fleischesser_innen und auch diejenigen, die trotz aller Argumente das Verzehren von Tierleichen nicht kategorisch ablehnen.
Hierzu noch einmal ein Zitat: "Auf die Massentierhaltung zu reagieren erfordert über reines Informiertsein hinaus die Fähigkeit zu sagen:´das geht mich etwas an', und dabei geht es auch um Gegensätze wie Wunsch und Verstand, Fakt und Mythos oder sogar Mensch und Tier."
Weniger
Antworten 9 von 11 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 9 von 11 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Das Buch "Tiere essen" befaßt sich mit einem sehr neutralen Blick auf das Thema "Fleisch essen -ja oder nein". Der Autor selbst wird zum strengen Vegetarier während seiner Nachforschungen. Er vermeidet jedoch jede Missionierung des Lesers. Er zeigt die Tatsachen auf …
Mehr
Das Buch "Tiere essen" befaßt sich mit einem sehr neutralen Blick auf das Thema "Fleisch essen -ja oder nein". Der Autor selbst wird zum strengen Vegetarier während seiner Nachforschungen. Er vermeidet jedoch jede Missionierung des Lesers. Er zeigt die Tatsachen auf ohne einen Zwang zum Fleischverzicht auszuüben. Seine neutrale Darlegungsweise vermeidet ein schlechtes Gewissen beim Leser. Man kann sich unbefangen mit den aufgedeckten Tatsachen und Details befassen und seine ganz eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ein sehr gelungenes Buch.
Weniger
Antworten 17 von 29 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 17 von 29 finden diese Rezension hilfreich
Wer sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt hat, ob der Verzehr von Fleisch notwendig und sinnvoll ist, wird bei diesem Hörbuch auf sachliche Weise mit Informationen versorgt, vor denen wahrscheinlich ein Großteil der Menschen in unseren Industrieländern bewusst die Augen …
Mehr
Wer sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt hat, ob der Verzehr von Fleisch notwendig und sinnvoll ist, wird bei diesem Hörbuch auf sachliche Weise mit Informationen versorgt, vor denen wahrscheinlich ein Großteil der Menschen in unseren Industrieländern bewusst die Augen verschließt. Wenn sich nach diesem Buch viele dazu entscheiden würden, nur noch Tiere zu essen, die ein lebenswertes Leben in artgerechter Tierhaltung gelebt haben, wäre schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung getan.
Weniger
Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch Eine Pflichtlektüre - nicht nur für Vegetarier !!
Antworten 5 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für