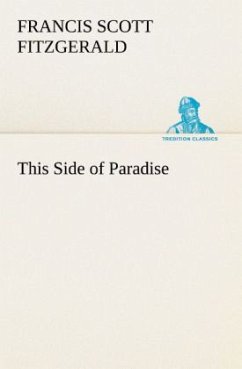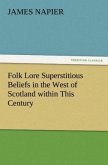This book is part of the TREDITION CLASSICS. It contains classical literature works from over two thousand years. Most of these titles have been out of print and off the bookstore shelves for decades. The book series is intended to preserve the cultural legacy and to promote the timeless works of classical literature. Readers of a TREDITION CLASSICS book support the mission to save many of the amazing works of world literature from oblivion. With this series, tredition intends to make thousands of international literature classics available in printed format again worldwide.

Sommernächte, Champagner und die fatal verstreichende Zeit: Warum kein Film an diesen Roman heranreichen kann
Im Jahr 1924 sah das Leben für Francis Scott Fitzgerald verheißungsvoll aus. Noch nicht 30-jährig hatte er zwei Romane veröffentlicht, von denen der erste, "This Side of Paradise" (1920), sich aus dem Stand so gut verkaufte, dass seine Verlobte Zelda Sayre, Tochter aus gutem Südstaaatenhause, sich endlich davon überzeugen ließ, dass er eine gute Partie sei. Acht Tage nach der Veröffentlichung heiratete sie ihn endlich. Die beiden bekamen eine Tochter, Frances Scott, genannt Scottie. Der Roman "The Beautiful and the Damned" (1922) erschien. Selbst im nicht leicht zu beeindruckenden New York fiel das junge Ehepaar durch Exzentrik auf. Die Prohibition tranken sie sich einfach schön, tanzten auf Tischen, und ihre Neigung, voll bekleidet in öffentliche Brunnen zu springen, muss schon als Hobby bezeichnet werden. Sie hatten alles auf ihrer Seite, was ein geltungs- und vergnügungssüchtiges Paar sich nur wünschen kann - Jugend, Schönheit und den Neid und die Bewunderung ihrer Zeitgenossen. Ohne die Fitzgeralds wären die Roaring Twenties vermutlich eine sturztrockene Angelegenheit gewesen.
Den Sommer des Jahres 1924 verbrachte die junge Familie in Südfrankreich. Sie mieteten sich eine Villa in Valescure, einem Dorf in der Nähe von Saint-Raphaël, das wiederum auf halber Strecke zwischen Saint-Tropez und Cannes liegt. Dort arbeitete Fitzgerald an einem Roman, den er seinem Verleger in einem Brief folgendermaßen angekündigt hatte: "Ich will etwas Neues schreiben - etwas Außerordentliches und Schönes und Einfaches + Komplexes." Es sollte das Beste werden, das er jemals geschrieben hat - nach Ansicht vieler, unter anderem auch seiner eigenen, der beste amerikanische Roman aller Zeiten: "The Great Gatsby".
Die Handlung spielt im Sommer 1922 in einem Teil New Yorks, den Fitzgerald gut kannte, weil er in dieser Zeit selbst dort gelebt hatte: in Great Neck, an der Nordküste Long Islands, eine halbe Autostunde von Manhattan entfernt. Gegenüber, durch einen schmalen Wasserstreifen getrennt, aber in Sichtweite, liegt Sands Point, das in den zwanziger Jahren der noblere Wohnort war. Dort wohnte das alte Geld, (wobei alt bei amerikanischem Geld natürlich relativ ist), während sich in Great Neck eher die Emporkömmlinge ansiedelten, die Möchtegern- und Neu-Reichen, die den amerikanischen Traum zu leben versuchten, während er denen auf der gegenüberliegenden Küste in die Wiege gelegt worden war.
Aus Great Neck machte er West Egg, aus Sands Point East Egg; und als Erzählperspektive wandte Fitzgerald den eigentlich immer gut funktionierenden Kniff an, die Geschichte aus Sicht eines staunenden Außenseiters wiederzugeben, der irgendwann selbst in die Ereignisse hineingezogen wird. Nick Carraway heißt der Ich-Erzähler, ein Mann um die 30, der sich an der Börse versucht und vor kurzem erst an die Ostküste gezogen ist, und zwar nach West Egg, also in den weniger respektablen der beiden Orte. Er hat dort ein bescheidenes Häuschen mit Blick auf die Bucht gemietet, und schnell wird die Aufmerksamkeit des Lesers auf das viel größere Nachbargrundstück gelenkt, das ein gewisser Jay Gatsby bewohnt, den der Erzähler anfangs nur dem Hörensagen nach kennt. Ein Neffe Hindenburgs soll er sein, ein Alkoholschmuggler oder ein Mörder - Genaues weiß niemand, was natürlich unendlich reizvoll ist.
Es dürfte wohl selten eine Figur so wirkungsvoll in einen Roman eingeführt worden sein wie Jay Gatsby. Die Schriftstellerin Edith Wharton bemängelte in einem Brief, den sie Fitzgerald nach der Lektüre schrieb, dass er Gatsbys Werdegang zu knapp geschildert habe - es gibt nur eine kurze Zusammenfassung im sechsten Kapitel - aber an der Exposition kann wohl niemand etwas auszusetzen finden: Über mehrere Kapitel sind über Gatsby nur die Gerüchte zu erfahren, die man sich über ihn erzählt, und so wächst die Neugierde des Lesers im selben Maße wie die des Erzählers: Wer ist dieser Mann, der - bis auf Heerscharen von Angestellten - alleine in dieser protzigen, einem Rathaus in der Normandie nachempfundenen Villa wohnt, zu der neben einem marmornen Swimmingpool mehr als vierzig Morgen Rasen und Gärten gehören? Jeden Abend weht von dort der Lärm einer rauschenden Party auf Nicks Grundstück herüber, parken Wagen in mehreren Reihen vor der Auffahrt, lässt die funkelnde Festbeleuchtung den Mond blass aussehen und wirft ein hartes Schlaglicht auf sein eigenes bescheidenen Dasein.
Wie es der Zufall will, lebt gegenüber in East Egg eine Kusine zweiten Grades von Nick, Daisy, zusammen mit ihrem Mann, dem so sportlichen wie reichen Tom Buchanan. So findet Nick Anschluss an die New Yorker Society, beginnt eine Affäre mit einer Freundin der beiden, einer berühmten Golfspielerin, entdeckt, dass Tom seine Daisy mit der Frau eines Automechanikers betrügt, lernt diese auch kennen - und findet sie unangenehm. So nimmt dieser Sommer seinen vielversprechenden Anfang, und eines Abends wird auch Nick schließlich zu einer jener Partys bei seinem Nachbarn eingeladen. Und diese Party, die im dritten Kapitel geschildert wird, dürfte die mit Abstand beste Party sein, die jemals beschrieben wurde. Worte wie Sommernächte, Flüstern, Sekt und Sterne schaffen eine Atmosphäre, deren Magie kein Film jemals einfangen könnte, weil weder die Wirklichkeit noch ein Abbild von ihr es mit den Verführungskünsten von Fitzgeralds Ton aufnehmen kann.
"Die Bar ist in vollem Gange, Cocktailrunden überschwemmen den Garten, bis alles von Geschnatter und Gelächter erfüllt ist. Es fallen beiläufige Bemerkungen, Fremde werden einander vorgestellt und der Name des neuen Bekannten sofort wieder vergessen. Frauen fallen sich begeistert in die Arme, die sich nie dem Namen nach kannten. Die Lichter werden immer heller, während sich die Erdkugel langsam von der Sonne abwendet, und nun spielt das Orchester gelbe Cocktailmusik, und die Oper aus den Stimmen der Gäste rutscht eine Tonlage höher. Von Minute zu Minute perlt das Gelächter leichter, breitet sich immer großzügiger aus und strömt bei jeder heiteren Bemerkung. Die Grüppchen wechseln rascher, wachsen durch neue Gäste an, lösen sich auf und bilden sich im selben Atemzug wieder neu. Die ersten Wanderer sind unterwegs, selbstbewusste junge Frauen, die sich unter die Solideren und Behäbigeren mischen, für einen kurzen, fröhlichen Augenblick zum Mittelpunkt einer Gruppe werden und dann triumphierend durch das wogende Meer aus Gesichtern, Stimmen und Farben im ständig verändernden Licht weiter ziehen."
Fitzgerald, der einmal behauptet hat, dass das Verb in einem Satz immer das Wichtigste sei, auch wenn er sich vor allem im Finden von ausgefallenen, oftmals synästhetischen Adjektiven unerreicht gezeigt hat ("gelbe Cocktailmusik") tupft seine Sätze so leicht und rhythmisch hin, dass die Partyszene bei der Lektüre zu vibrieren scheint. Unmöglich, die Schönheit seiner Sprache ins Deutsche zu übertragen, so einen swingenden Sound gibt das Deutsche nicht her (die eleganteste Übersetzung scheint mir noch die von Johanna Ellsworth zu sein). Seine Personenbeschreibungen sind herrlich: "Sie hatte das Kinn gehoben, als ob sie darauf etwas balancierte, das leicht herunterfallen konnte"; seine Dialoge hinreißend: "Sie hat sich mit jemandem gestritten, der vorgibt, ihr Mann zu sein", sagt eine junge Frau etwa erklärend zu Nick, als sie vor einer Sängerin stehen, die mitten im Gesang plötzlich in Tränen ausbricht, sich in einen Sessel fallen lässt und in Tiefschlaf versinkt. Oder: ",Was unternehmen wir nach dem Essen?', fragte Daisy, ,und morgen und für die nächsten dreißig Jahre?'"
An diesem Abend lernt Nick seinen ominösen Nachbarn auch persönlich kennen. Und wenn Sie zu den beneidenswerten Menschen gehören, die "The Great Gatsby" tatsächlich noch nicht gelesen und also noch vor sich haben (auch wenn es dafür bei einer Gesamtlänge von 188 Seiten keine wirklich gute Ausrede gibt), möchte ich Ihnen das Vergnügen daran nicht nehmen, indem ich hier noch erzähle, wie es kommt, dass es am Ende des Romans drei Tote gibt. Oder was der wahre Grund dafür ist, dass Gatsby ein Haus an diesem zweifelhaften Küstenort von Long Island bezogen hat. Oder welch tragende Rolle noch Gatsbys Wagen, einem eierschalengelben Rolls-Royce mit grünen Ledersitzen, zukommen wird.
Aber vermutlich haben Sie es längst gelesen. Und wissen also, dass dieser Roman über einen mysteriösen reichen Mann, der nicht nur seinen Nachbarn ins Rätseln brachte, sondern auch den Autor selbst (später bekannte er, von Gatsby nie eine klar umrissene Vorstellung gehabt zu haben), in Wahrheit natürlich von etwas ganz anderem erzählt. Auf der Folie des Strebens nach Ansehen, Ruhm und Geld, kurz dem American Dream, das alle Charaktere treibt, geht es um die schmerzvolle Erkenntnis, dass sich die Zeit nicht anhalten lässt. Die Vergangenheit ist unwiederbringlich vorbei - und doch kann ihr niemand entrinnen. Davon erzählt "The Great Gatsby", auf dessen Seiten das Wort Zeit insgesamt 87 Mal vorkommt und das Thema Vergänglichkeit wieder und wieder anklingt. ("Und ich hatte immer wieder nur diesen einen Gedanken: ,Das Leben ist so kurz, das Leben ist so kurz . . .'"; "So fuhren wir auf unserem Weg durch die kühle Dämmerung dem Tod entgegen.")
In jenem kurzen Sommer an der Côte d'Azur, als Fitzgerald "The Great Gatsby" schrieb, hatte Zelda eine Affäre mit einem französischen Piloten, dämpfte ihr Mann seine Eifersucht mit weißem Portwein, Bordeaux und Mousseux, schluckte Zelda eine gerade noch harmlose Überdosis Schlaftabletten, stritt man sich mit dem Kindermädchen über britische Politik. Sechs Jahre später wurde bei Zelda Schizophrenie diagnostiziert, ihr Mann war da längst dem Alkohol verfallen. Er starb 1940 im Alter von nur 44 Jahren an einem Herzinfarkt, Zelda kam nicht zur Beerdigung. Sie starb acht Jahre später, als in dem Krankenhaus, in dem sie zur Behandlung war, ein Feuer ausbrach, vor dem sie nicht fliehen konnte, weil sie in Erwartung von Elektroschocks eingesperrt war. In den gemeinsamen Grabstein von Zelda und Francis Scott Fitzgerald, diesem schönen und verdammten Paar, ist der dramatische Schlusssatz aus "The Great Gatsby" gemeißelt: "So rudern wir weiter gegen den Strom, unaufhörlich der Vergangenheit entgegen." Soll keiner sagen, Fitzgerald hätte nicht gewusst, dass all das Lärmen und Feiern vergeblich ist.
JOHANNA ADORJÁN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main