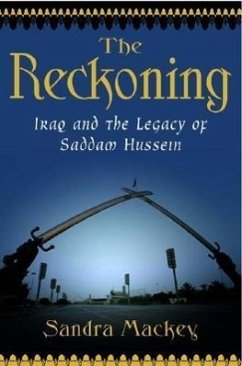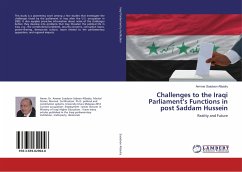Saddam Hussein is high on America's enemies listbut does an Iraq without him hold the seeds of the next Yugoslavia? To the dismay of many in the West, the Gulf War ended with Saddam Hussein still in control, still defiant, and determined to use any means of striking back. This book sounds an urgent note of caution: a future Iraq without Hussein could be even more unstable and more problematical to the security of the United States. The Reckoning is an account of the forceshistorical, religious, ethnic, and politicalthat produced Saddam's dictatorship. Forged after World War I from the Mesopotamian region of the collapsed Ottoman Empire, Iraq's people have never had a national identity or a sense of common purpose. Hussein, ruling by terror rather than persuasion, has pitted the various ethnic groups, religious interests, and tribes against each other and in so doing achieved the destruction of Iraq's middle class and civilized society. After he goes, however he goes, the country could be the site of conflict even more vicious than the Balkan wars.

Der Irak ist ein von den Briten geschaffener Staat ohne nationale Identität und Geschichte, den sich Saddam Hussein untertan gemacht hat
SANDRA MACKEY: The Reckoning. Iraq and the Legacy of Saddam Hussein, W. W. Norton & Company, New York 2002. 415 Seiten, 19,50 US-Dollar.
Die amerikanische Journalistin Sandra Mackey ist in Europa eher unbekannt. Nach Lektüre ihres Buches über den Irak, seine Geschichte, seine ethnischen und religiösen Gruppen, seine sozialen Schichtungen, seine Suche nach nationaler Identität und seine Leiden unter dem Tyrannen Saddam Hussein wird man sich den Namen der Autorin merken müssen. Sandra Mackey gelingt es, in einem faszinierend geschrieben Werk die Geschichte des Irak in den Zusammenhang der nahöstlichen Probleme zu stellen: in den Konflikt mit Israel, den Kampf mit den Kurden, in die jahrhundertelange Feindschaft mit den Persern, in die von den Briten begonnene, von den USA fortgesetzte koloniale Dominierung und, natürlich, in den Kontext mesopotamischer und islamischer Geschichte. Inmitten dieses fast unentwirrbaren Flechtwerkes steht der Diktator Saddam Hussein, dessen Handlungen die Autorin erklärt, deutet, vor allem aber verabscheut.
Gesellschaft der Clans
Ein Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte eines Landes, das eigentlich keine zusammenhängende Geschichte hat und dessen Bewohner seit der Staatsgründung durch die Briten lange ohne nationale Identität waren: Es ist der Tribalismus, die Aufteilung der Gesellschaft in Clans, in engere und weitere Stammesverbände. Außer auf der Arabischen Halbinsel habe diese „Mystik” der Beduinen kaum eine solch entscheidende Rolle gespielt wie im Irak, erläutert die Autorin. Und deshalb ist die von Sandra Mackey erwähnte „große Schwäche arabischer Gesellschaften” besonders im Irak ausgeprägt. Diese Schwäche besteht darin, dass die Interessen des Stammes die Sorge um das Gemeinwohl aller „Staatsbürger” überschreiten.
Überhaupt ist der Irak eine Ausgeburt des Kolonialismus: Zusammengesetzt aus dem, was nicht zusammen gehört, war der neue Staat von Anfang an ein „Rezept fürs Desaster”, wie sich der erste britische Kolonialverwalter, Sir Percy Cox, am Ende des Ersten Weltkrieges äußerte. Denn zusammen gewürfelt wurde das Land aus dem kurdischen Mosul, dem sunnitischen Bagdad und dem schiitischen Basra. Die schiitische Mehrheit schlossen die Briten von der Herrschaft aus. Die sunnitische Minderheit der Region Bagdad hingegen sollte die Kurden im Norden und die Schiiten im Süden in einen Staat zusammenzwingen. Zum König machten die Briten Faisal aus dem Herrscherhaus der aus Mekka stammenden Haschemiten.
Von Demokratie hielten die Briten nichts. Den einzigen Führer der „Opposition”, Said Talib al-Naqih, ließ Sir Percy Cox zum Tee bitten, dann in einen Panzerwagen geleiten und ins britische Ceylon ins Exil schaffen. Der Mann hatte gefordert, der Irak müsse von Irakern regiert werden.
Wie formt man aber einen Nationalstaat aus einem Mesopotamien, das Jahrhunderte als Hinterhof des Osmanischen Reiches galt, dessen Kultur und dessen wirtschaftliche Grundlage, die ausgeklügelten Bewässerungssysteme, 1258 von den Mongolen rücksichtslos vernichtet, dessen Menschen damals zu Hunderttausenden abgeschlachtet worden waren? Die Baathpartei versuchte es mit den Segnungen des durch den Ölboom ermöglichten Wohlstandes und mit einer massiven Erziehungs- und Bildungsoffensive. Und Saddam Hussein versuchte es mit dem Rückgriff auf eine Geschichte, welche „der Irak” eigentlich gar nicht hatte: Er berief sich auf Sumerer und Babylonier, er glorifizierte die arabischen Feldzüge gegen die Perser, und er versuchte, an die glorreiche Zeit anzuknüpfen, in der Bagdad unbestrittene Metropole des islamischen Weltreiches war.
Doch Husseins Werben um den Islam war immer mit Gefahr verbunden. Denn instinktiv war dem Despoten klar, dass besonders der schiitische Islam ein Feind der laizistischen Ideologie der Baathpartei war. So ließ Saddam Hussein zwar schiitische Schreine renovieren, ließ aber auch wichtige Religionsführer grausam ermorden.
Und dann gelang doch noch ein Überraschungserfolg im endlosen Kampf des Regimes um nationale Zusammengehörigkeit. Am Ende des achtjährigen Gemetzels zwischen dem Irak und dem Iran mit seinen mehr als einer Million Toten und mit seinem Parallelkrieg gegen die irakischen Kurden gab es plötzlich so etwas wie ein Nationalgefühl. Die Kurden hatten eingesehen, dass sie gegen Bagdads Armee nichts ausrichten konnten – und dass ihnen auch kein anderer Staat der Region Unabhängigkeit geben würde. Sogar die Schiiten im Süden hatten gegenüber ihrem Staat eine gewisse Loyalität entwickelt. Sie waren nicht zu ihren Glaubensbrüdern jenseits der Grenze übergelaufen. Vielmehr erwiesen sie dem irakischen Staat – oder etwa nur arabischen Stammesgesellschaft ? – ein gewisses Maß an Loyalität. Der durch den Ölboom ermöglichte, wenn auch oft bescheidene Wohlstand gab dabei ebenso den Ausschlag wie die Bemühungen der Regierung, Bildung und Ausbildung in alle Teile des Landes zu tragen.
Verheerende Niederlage
Doch der Erfolg war möglicherweise kurzlebig. Um seine Macht nach der Niederlage im Krieg um Kuwait wieder zu festigen, griff Saddam Hussein auf die alten Stammesstrukturen zurück. „Was es heute gibt”, schreibt Sandra Mackey, „ist eine Stammesgesellschaft, in welcher die Führungsmannschaft des Staates aus Husseins Verwandten und Verbündeten zusammen gesetzt ist.” Der Sicherheitsapparat, der das Volk unterdrücke, komme aus diesen Stämmen. Die Beamten in den Ministerien, früher gut ausgebildete Kader, seien heute von städtischer Kultur unberührt. Bei Sandra Mackey stößt man auf eine Fundgrube von Wissen und intelligenten Auslegungen irakischer Geschichte und Gegenwart. Ob die amerikanischen Landsleute der Autorin diese Zusammenhänge kennen? Bevor sich die Herren Bush, Rumsfeld, Cheney und Wolfowitz zusammen mit Kollegin Rice in ihr irakisches Abenteuer stürzen, wäre ihnen die Lektüre von Sandra Mackeys „Abrechnung”, wie man den Titel übersetzen könnte, sehr zu empfehlen.
HEIKO FLOTTAU
Die Krise um den Irak: Neue politische Bücher zum drohenden Krieg
Grüner Nebel aus Rauchbombem liegt über dem nord-kuwaitischen Sand, auf dem amerikanische Marine-Soldaten den Angriff auf den Irak proben.
Foto: AP
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Sandra Mackeys glänzendes Buch über den Irak
Sandra Mackey: The Reckoning. Iraq and the Legacy of Saddam Hussein. Verlag W.W. Norton & Company, New York/London 2002. 415 Seiten, 22,50 Pfund.
Im vorletzten Stadium politischer Entscheidungsprozesse verdichten sich in der Regel alle Daten und Urteile zu einer einzigen und letzten Alternative: ja oder nein. Im Fall der Diktatur Saddam Husseins steht der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vor der Frage, ob der von diesem Regime ausgehenden Bedrohung des regionalen und des Weltfriedens notfalls auch militärisch zu begegnen sei. Der amerikanische Präsident Bush wiederum muß entscheiden, ob die Vereinigten Staaten notfalls auch ohne Mandat des Sicherheitsrates mit eigenen Streitkräften die Entwaffnung und einen politischen Wechsel im Irak einleiten sollen. Wenn ein Entscheidungsprozeß in diesem Stadium angelangt ist, wenn nur über das Ja und das Nein noch gestritten wird, dann gerät all das, was es zuvor an abwägenden Urteilen, an Motiven und unterschiedlichen Erklärungen gab, aus dem Blickfeld. Das muß man bedauern, denn dadurch werden nicht nur alle Differenzierungen plattgewalzt. Es macht auch den Streit selbst auf eigentümliche Weise unfruchtbar. Vermeiden läßt sich das in diesem Stadium allerdings kaum, eben weil es in der Natur solcher Entscheidungsprozesse liegt.
Trotzdem bleibt die Möglichkeit, sich tiefgründiger mit dem anstehenden Problem zu beschäftigen. Dafür ist es nie zu spät. Denn selbst nach einer getroffenen und durchgesetzten Entscheidung ist das politische Problem, um das es geht, meist noch keineswegs aus der Welt geschafft. Vielmehr taucht es in veränderter Form samt einer Menge von Folgeproblemen neu auf. Sollte also die Bedrohung durch Saddam Husseins Ambitionen, in den Besitz von Massenvernichtungswaffen zu gelangen, eliminiert worden sein, ist damit noch lange nicht klar, ob sich aus der dann entstandenen Lage nicht andere, ebenfalls sehr gefährliche Bedrohungen ergeben werden.
Genau diese Frage greift die amerikanische Journalistin Sandra Mackey auf. Ihr ausführlicher und auf langjährigen Recherchen im Nahen Osten beruhender Bericht stellt eine glänzende Mischung aus aktualitätsbezogener Geschichtsschreibung und abgewogener politischer Analyse dar. Wir erfahren von der Leidensgeschichte der Bevölkerung in einem Land, das über Generationen hinweg nur Objekt auswärtiger politischer Interessen war; von den religiösen, ethnischen, politischen und sozialen Trennlinien, die weder ein irakisches Staats- noch ein Nationalbewußtsein aufkommen ließen, und von dem Ölreichtum, der für ein paar Jahre das Land aufblühen ließ, bevor es dann durch die von Saddam Hussein begonnenen Golfkriege in tiefstes Elend gestürzt wurde.
Man muß diese lange und größtenteils deprimierende Geschichte der innerarabischen, innerislamischen und sozialen Spannungen und Kämpfe im Irak sowie die Geschichte der Auseinandersetzungen mit den Nachbarn und den weltpolitischen Bezugsmächten seit dem Ersten Weltkrieg zur Kenntnis genommen haben, um die tödliche Dramatik des jetzigen Regimes nachvollziehen zu können. Saddam Hussein hat es mit äußerst brutalem Terror nach innen und mit seinem kriegerischen Ausgreifen nach außen, erst gegen den Iran, dann gegen Kuwait, vermocht, die internen Trennlinien grob zuzudecken. Es geschah dies zu enormen menschlichen Kosten und wurde durch die Sanktionen der Vereinten Nationen seit dem Ende des zweiten Golfkrieges in der Wirkung leider verstärkt. Der Machthaber sitzt auch heute fest im Sattel. Er ist es, der den Irak zu einem Schurkenstaat gemacht hat.
Die panarabisch motivierten Kämpfe gegen das Ottomanische Reich vor und im Ersten Weltkrieg, die von den Briten aus Eigeninteresse geförderte matte Monarchie, die revolutionären Illusionen der Bath-Partei und zuletzt der als sozialer Kitt genutzte Antisemitismus und Antiamerikanismus, all das steht als Folie hinter den Umrissen eines von einigen sunnitischen Clans kontrollierten, während Saddam Husseins schrankenloser Herrschaft immer weiter ausgepreßten Landes. Aber so paradox es klingen mag - gerade weil diese Herrschaft alle Ansätze einer zivilen Gesellschaft ausradiert hat, sind der Diktator und seine Machtapparate die einzigen Klammern, welche die Reste der widerstrebenden politischen Kräfte in der Gesellschaft zusammenhalten. Gleichviel wie der Abgang Saddams sich vollziehen wird, auch danach werden der Irak und seine nähere Umgebung aller Voraussicht nach ein Hort der Instabilität bleiben. Dies ist Sandra Mackeys These, die sie mit viel Überzeugungskraft begründet.
Gegen ein gewaltsames Aus für die versteckten Aufrüstungsprogramme spricht dies zwar nicht. Denn wenn diese Programme einen derart bedrohlichen Charakter haben, wie die amerikanische und die britische Regierung annehmen, und diese Annahmen sind ja nun wahrlich nicht aus der Luft gegriffen, dann kann es im Interesse des Weltfriedens unabdingbar werden, die Entwaffnung des Irak, die Zerstörung seiner Arsenale mit und Fabriken für Massenvernichtungswaffen auch gegen Widerstand zu vollstrecken. Aber zugleich muß man sich darüber klar sein, daß dies andere Probleme nach sich ziehen wird. Ohne eine wenigstens potentiell konsensfähige Langzeitvision für ihre politische Zukunft in staatlichem Verbund oder in einer anderen Form sind die Interessen der Kurden im Norden, der Sunniten im Zentrum und der Schiiten im Süden des Landes nicht miteinander auszugleichen. Eine solche Vision kann aber nicht, wie bei früheren Versuchen der Staatsgründung und Staatsstabilisierung, von außen kommen, allenfalls dann, wenn sie von vertrauenswürdigen Exilpolitikern mitgetragen und in Angriff genommen würde. Darauf zu bauen hieße auf ein Wunder hoffen.
WILFRIED VON BREDOW
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main