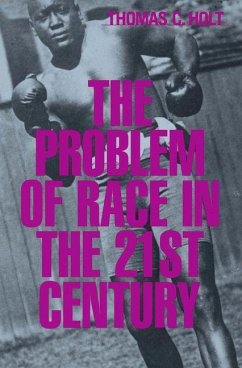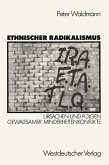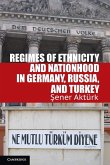As disturbing as it is enlightening, this work reveals the radical nature of change as it relates to race and its cultural phenomena. It offers conceptual tools and a new way to think and talk about racism as social reality.
No detailed description available for "The Problem of Race in the Twenty-first Century".
No detailed description available for "The Problem of Race in the Twenty-first Century".

Weiße Herablassung: Thomas C. Holt spricht vom Rassismus der Gegenwart, ohne sich die Mühe der Beobachtung zu machen
Das zwanzigste Jahrhundert hatte noch kaum begonnen, da veröffentlichte der fünfunddreißig Jahre alte schwarzamerikanische Aktivist W. E. B. Du Bois in seiner Essay-Sammlung "The Souls of Black Folk" (1903) den Satz: "Das Problem des zwanzigsten Jahrhunderts ist das Problem der Farbgrenze - das Verhältnis der dunkleren zu den helleren Rassen der Menschheit . . ."
Mit diesem Zitat eröffnet der schwarzamerikanische Historiker Thomas C. Holt sein Buch "The Problem of Race in the Twenty-First Century" und deutet mit dieser Eröffnung auch den intellektuellen Kontext an, in dem sein Buch nicht nur gelesen werden muß, sondern in dem es einzig verständlich wird. Denn wer Holts Buch in der naiven Erwartung angeht, dort Einsicht in die Zukunft des Rassenproblems, also insbesondere der sozialen Schwierigkeiten schwarzer Amerikaner, zu gewinnen, wird herb enttäuscht. Holts Buch ist ein so hoch abstrakter Diskurs über das amorphe Wesen des Rassismus und über die in wechselnden sozialen Kontexten sich ebenfalls ändernde Bedeutung des Begriffs der Rasse, daß einzelne Thesen, die über Gemeinplätze wie den der sozialen und ökonomischen Bedingtheit des Rassismus hinausgehen, kaum griffig werden.
Wer also nicht glauben will, daß Holts Verlag, Harvard University Press, hier einfach nur preziös artikulierte heiße Luft zwischen zwei Buchdeckeln auf den Markt gebracht hat, der muß versuchen, einerseits Holts vage Thesen vom skizzierten ideologischen Kontext her zu begreifen und andererseits die Funktion des Buches innerhalb eines ganz spezifischen institutionellen Rahmens zu erkennen.
Holt weist in seiner Erörterung des einleitenden Zitats darauf hin, daß Du Bois' Vorhersage natürlich auf der Erfahrungswelt des neunzehnten Jahrhunderts beruht, die von der massiven globalen Ausbeutung materieller und menschlicher Ressourcen und vom Aufstieg virulent rassistischer Ideologien geprägt war. Allerdings, so Holt, erkannte Du Bois bereits 1903 die Zeichen der Zukunft und konzipierte sein Buch "The Souls of Black Folk" als "Herausforderung an die sich formierende monopolkapitalistische Weltordnung". In der Tat sind die Werke von Du Bois von den dreißiger Jahren an stark marxistisch beeinflußt. Noch 1961, im Alter von 93 Jahren, wurde Du Bois Mitglied der Kommunistischen Partei Amerikas in der Überzeugung, daß die Quellen des Rassismus im Kapitalismus zu finden seien.
Holt folgt im wesentlichen dieser Gedankenführung. Er argumentiert, daß "Rasse" keine biologische Tatsache, sondern ein soziales Konstrukt ist und daß "die Bedeutung von Rasse und das Wesen des Rassismus sich mit der gegebenen gesellschaftlichen Formation eines bestimmten historischen Moments artikulieren (vielleicht sogar von ihr definiert werden)". Holt charakterisiert in den drei Essays seines Buches drei "gesellschaftliche Formationen", die er "Vor-Fordistisches", "Fordistisches" und "Nach-Fordistisches Regime" nennt. Das "Fordistische Regime" ist nach Henry Fords Fließbandproduktion in seiner Detroiter Autofabrik benannt und reicht vom frühen zwanzigsten Jahrhundert bis zur Rezession und Schuldenkrise der frühen siebziger Jahre. Die beiden anderen "social formations" umfassen die Jahrhunderte davor und die Jahrzehnte danach.
Im ersten Essay argumentiert Holt in der Nachfolge von Du Bois, der den afrikanischen Sklavenhandel den ersten globalen Wirtschaftsaustausch nannte, daß die "transatlantische Sklaverei . . . einen jener historischen Brüche markiert, die Produktion und Konsum, Mobilisierung von Arbeitskräften" sowie persönliche und politische Identität neu definieren. Er hält die Sklaverei für eine intellektuelle Vorbedingung der rationellen Massenproduktion und deutet die Zeitgleichheit von Kolonialismus (globaler Ausbeutung) und Nationalstaatenbildung in einen Kausalzusammenhang um, denn beide beruhen laut Holt auf der Definition rassischer Identität. Im zweiten Essay skizziert Holt das Zusammenwirken von liberalen Kapitalisten (wie Edward Filene), progressiven Sozialreformern (wie Leon Keyserling) und Staat bei der Entstehung der Massenkonsumgesellschaft.
"Während der langen Regierungszeit von Franklin Roosevelt gelang es Fordistischen Fürsprechern wie Filene und Keyserling, sich Zugang zur politischen Macht zu verschaffen und diese dazu zu benutzen, die Konsumgesellschaft national auszuweiten. In der Zeit des New Deal wurden die Südstaaten elektrifiziert. Die Agrarpolitik des New Deal beschleunigte den Ausschluß der Schwarzen aus der Landwirtschaft der Südstaaten und schuf so die gesellschaftliche Basis - ein städtisches Proletariat - für die Herausforderung des rassischen Systems dieser Region." Holt konzidiert die längst bekannten Folgen des Umzugs der schwarzen Bevölkerung vom ländlichen Süden in den industriellen Norden, nämlich "die Integration der Schwarzen in die Volkswirtschaft und der schwarzen Kultur in die nationale Kultur sowie das verstärkte direkte Eingreifen des Staates in die Regulierung des Verhältnisses der Rassen zueinander".
Im letzten Essay über das "Nach-Fordistische Regime" beschreibt Holt die Entstehung einer neuen hochbezahlten, städtischen Elite von "Dienstleistungsarbeitern", die selbst Dienstleistungen brauchen und so eine "neue, arme, nicht gewerkschaftlich organisierte, hauptsächlich aus Einwanderern bestehende Arbeiterklasse" schaffen. Holt stellt richtig fest, daß in der Neuen Ökonomie die "Schwarzen als Rasse keine wirtschaftliche Rolle spielen". Er ist nun mit der Interpretation der historisch neuen Erscheinung konfrontiert, daß der "dramatisch angestiegenen Anzahl Schwarzer mit mittleren Einkommen und ihrer sichtbaren Integration in die wichtigsten gesellschaftlichen Einrichtungen des amerikanischen Lebens" ein "massiver Ausschluß von Schwarzen aus der formalen Wirtschaft" entgegensteht. Holt erklärt die historisch neue Differenzierung der Klassenstruktur der schwarzen Bevölkerung, also die Entstehung von Ober-, Mittel- und Unterschicht, mit staatlichen Eingriffen wie etwa der bevorzugten Einstellung rassischer Minderheiten im Rahmen der "affirmative action"-Programme seit den frühen siebziger Jahren.
Erklärungsbedürftig wäre allerdings das trotz gefallener Rassenschranken rapide Anwachsen einer nicht integrierbaren schwarzen Unterschicht. Eine Erklärung müßte etwa die innere Kultur und das Sozialverhalten der schwarzamerikanischen Mittel- und Unterschicht sowie das reaktive Verhalten ihrer weißen Äquivalente untersuchen, wie es etwa der schwarzamerikanische Linguistik-Professor John H. McWhorter in seinem analytisch brillanten Buch "Losing the Race: Self-Sabotage in Black America" getan hat. In diese Niederungen der realen gesellschaftlichen Beobachtung möchte sich der Historiker Holt allerdings nicht begeben. Er kommt lieber zu dem Schluß, daß uns in der Gleichzeitigkeit von Integration der schwarzen Mittelschicht und Marginalisierung der schwarzen Unterschicht eine "neue Unbestimmbarkeit in unserer Messung rassischer Phänomene" begegnet.
Diese Auflösung einer präzisen analytischen Herausforderung in einer neblig prätentiösen Sprache, wie sie von linksorientierten, der Theorie zugeneigten Akademikern gepflegt wird, hat mit dem institutionellen Kontext zu tun, dem Holts Buch seine Inkarnation verdankt. Holt wurde im letzten Jahr eingeladen, die nach Nathan I. Huggins benannten Gastvorträge an der Harvard University zu halten, wo der 1989 verstorbene Huggins von 1980 an das W.E.B. Du Bois Institute leitete. Du Bois selbst hatte 1888 sein Studium in Harvard aufgenommen und 1895 dort sein Doktorat erworben. Zu den Huggins Lectures kommt die geisteswissenschaftliche Elite der Universität, insbesondere aber kommen die mehrheitlich schwarzen Professoren des Du Bois Institute, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, über Geschichte und Gegenwart des amerikanischen Rassenproblems nachzudenken.
Es wäre wohl kaum denkbar gewesen und hätte im gegenwärtigen Klima einer in der schwarzamerikanischen Elite bewußt kultivierten Empfindlichkeit sehr viel Mut verlangt, die Huggins Lectures mit der einzig möglichen Schlußfolgerung aus einer klarsichtigen Einschätzung der Gegenwart abzuschließen, wie sie etwa McWhorter formuliert. "Die Idee, daß für Schwarze der weiße Rassismus das Haupthindernis auf dem Weg zum Erfolg ist", so schreibt McWhorter, "ist heute einfach überholt." Holt jedoch schließt sein Buch mit einer Betrachtung, die, wie McWhorter darstellt, unter Schwarzamerikanern identitäts- und gruppenbildende Bekenntnisfunktion hat.
Holt attackiert die neokonservativen Intellektuellen, die für ein "farbenblindes" Amerika plädieren oder der optimistischen Ansicht sind, daß dies bereits existiert. "Eine solche Auffassung", schreibt Holt, "steht im eklatanten Widerspruch zu den überwältigenden Anzeichen dafür, daß heute der Rassismus jede Institution, jede Pore unseres täglichen Lebens durchdringt." Daß Harvard University Press Holts konfuses Buch auf den Markt gebracht hat, möchte man gern der Verpflichtung eines Universitätsverlags zuschreiben, die wichtigsten Vortragsreihen der Lehreinrichtung zu veröffentlichen. Denn sonst könnte man leicht den Verdacht schöpfen, daß Holt doch recht hat und daß eine Art Rassismus in der subtilen Form weißer Herablassung, die sich aus schlechtem Gewissen und mißverstandener moralischer Verpflichtung speist, noch immer eine wichtige amerikanische Institution im Griff hat.
SUSANNE KLINGENSTEIN
Thomas C. Holt: "The Problem of Race in the Twenty-First Century". Harvard University Press, Cambridge 2001. 146 S., geb., 15,95 brit. Pfund.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main